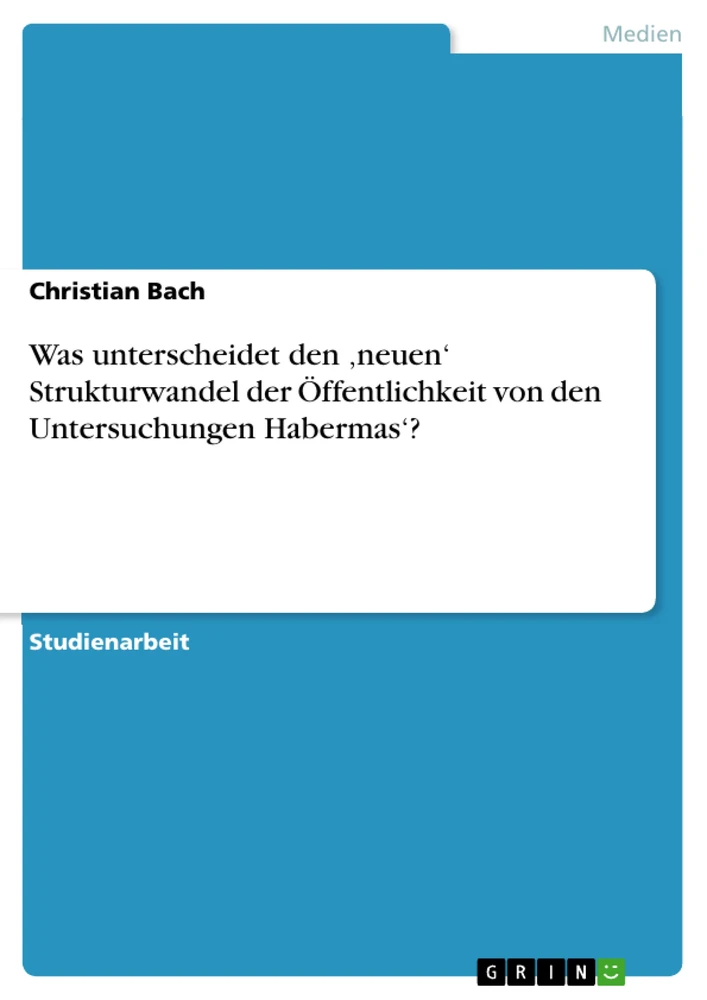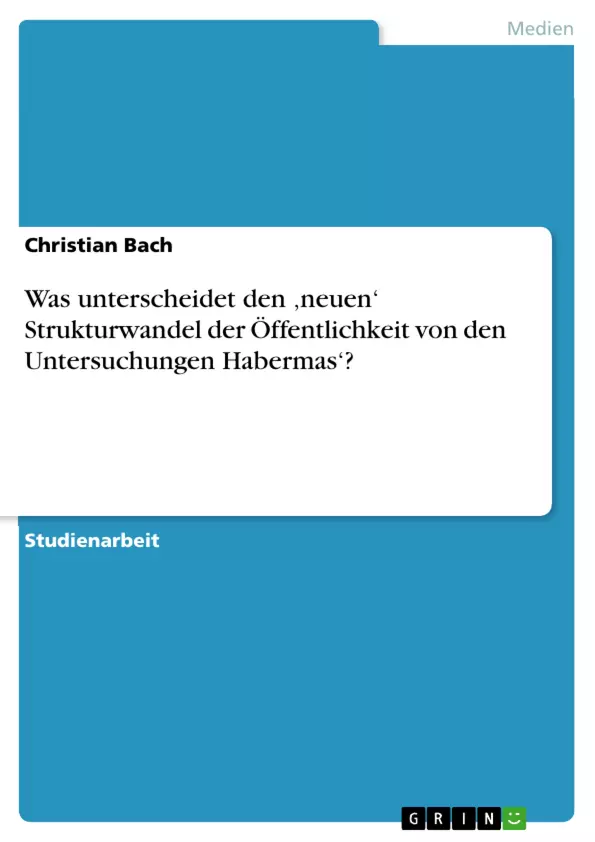0 Einleitung
Die Debatte über die Doktorarbeit des ehemaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg hat es erneut bewiesen: Das Internet kann zahllose Unbekannte zu einer Gruppe formen, von denen jeder für sich arbeitet und trotzdem mit Anderen kommuniziert. War vor ein paar Jahren der Fernseher noch das Leitmedium, hat sich nun das Internet durchgesetzt – und das nicht nur bei Informatikern oder Jugendlichen, sondern flächendeckend in Deutschland. Auf der einen Seite titelte das Magazin Der Spiegel „Netz besiegt Minister“ und auf der anderen Seite bildete sich eine Facebook-Gruppe, die innerhalb von 24 Stunden mehr als 300 000 Mitglieder vorweisen konnte (Vgl. dpa 2011, S. 1).
Die Herausbildung der Öffentlichkeit hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Diesen Umstand hat Jürgen Habermas bereits 1962 erkannt. Kurt Imhof hat diese Idee des „Strukturwandels der Öffentlichkeit“ weiterentwickelt und auf aktuelle Medien bezogen. Christoph Lieber fragt in dem Vorwort des Werkes „Beiträge zu Jürgen Habermas‘ »Strukturwandel der Öffentlichkeit«“:
„Wie ist es heute […] um demokratische Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum und die Funktion öffentlicher Meinung bestellt? Was bedeuten zunehmende Medialisierung von Politik und Amerikanisierung von Wahlkämpfen für einen emphatischen Begriff von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft als Korrektive staatlicher Politik?“ (Lieber 2003, S. 9).
Diese und weiteren Fragen stellt sich auch Kurt Imhof in genannten Aufsatz. Um die Unterschiede und Neuerungen im Gegensatz zu Habermas hervorzuheben, soll diese wissenschaftliche Arbeit folgende Frage beantworten: Was unterscheidet den ‚neuen‘ Strukturwandel der Öffentlichkeit von den Untersuchungen Habermas‘?
Dabei wird nach folgender Struktur vorgegangen: Zuerst wird das Verständnis von Habermas‘ „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ erläutert. Es folgen begriffliche Erläuterungen, um eine Grundlage für die folgenden Ausführungen zu schaffen. Dieser erste Abschnitt schließt mit Kritikpunkten an dem Werk, das durch die unaufhaltsame technische Weiterentwicklung viel Angriffsfläche liefert. Im zweiten Teil der Arbeit wird das ‚neue‘ Öffentlichkeitsverständnis von Kurt Imhof erklärt. Erneut wird auf Definitionen von grundlegenden Fachbegriffen aufgebaut – z. B. Politisierung oder Medialisierung. Daraufhin wird nach neuen Erkenntnissen, Entwicklungsdynamiken und Einflussgrößen bei der Untersuchung gefragt. ...
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 ,,Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Jürgen Habermas
- 1.1 Grundlegendes begriffliches Verständnis
- 1.1.1 Gesellschaft
- 1.1.3 Öffentlichkeit
- 1.2 Kritiken
- 2 ,,Politik im,neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Kurt Imhof
- 2.1 Das neue Begriffsverständnis nach Kurt Imhof
- 2.2 Neue Erkenntnisse
- 2.3 Entwicklungsdynamiken und Einflussgrößen
- 3 Zusammenfassung
- 4 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht, wie sich der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit von den Analysen Habermas' unterscheidet. Sie analysiert zunächst das Verständnis des "Strukturwandels der Öffentlichkeit" bei Habermas, einschließlich begrifflicher Erläuterungen und Kritikpunkte. Anschließend wird der neue Ansatz von Kurt Imhof untersucht, wobei auf Definitionen, neue Erkenntnisse und Einflussfaktoren eingegangen wird. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.
- Die historische Entwicklung des Begriffs der Öffentlichkeit und seine Transformation von der repräsentativen zur bürgerlichen Öffentlichkeit.
- Die Rolle der Medien im Wandel der Öffentlichkeit und der Einfluss von Faktoren wie Medialisierung und Politisierung.
- Kritikpunkte an Habermas' Theorie und die Weiterentwicklung des Konzepts des Strukturwandels der Öffentlichkeit durch Kurt Imhof.
- Die Auswirkungen des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit auf Politik und Gesellschaft.
- Die Bedeutung der öffentlichen Meinung und die Rolle der Zivilgesellschaft in der demokratischen Ordnung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der Thematik durch aktuelle Ereignisse wie den "Guttenberg-Skandal" dar. Sie zeigt die Notwendigkeit, den Wandel der Öffentlichkeit im Kontext der digitalen Medien zu untersuchen und stellt die Forschungsfrage: Was unterscheidet den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit von den Untersuchungen Habermas'?
- 1. ,,Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Jürgen Habermas: Dieses Kapitel erläutert Habermas' Konzept des "Strukturwandels der Öffentlichkeit" und beleuchtet die historischen Entwicklungen vom Druck zur bürgerlichen Öffentlichkeit. Es analysiert den Wandel vom klassischen Verständnis der Öffentlichkeit hin zum literarischen Publikum und zeigt die Kritikpunkte an Habermas' Theorie auf.
- 2. ,,Politik im,neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Kurt Imhof: Dieses Kapitel erklärt Imhofs neue Interpretation des Begriffs der Öffentlichkeit im Kontext der digitalen Medien. Es beleuchtet die neuen Erkenntnisse und Einflussfaktoren im digitalen Zeitalter sowie die Entwicklungsdynamiken des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit.
Schlüsselwörter
Öffentlichkeit, Strukturwandel, Jürgen Habermas, Kurt Imhof, Medialisierung, Politisierung, digitale Medien, öffentliche Meinung, Zivilgesellschaft, demokratische Ordnung, Kritik, Kritikpunkte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Habermas' „Strukturwandel der Öffentlichkeit“?
Habermas beschreibt den historischen Wandel von der repräsentativen zur bürgerlichen Öffentlichkeit und deren späteren Verfall durch die Medialisierung.
Wie erweitert Kurt Imhof die Theorie von Habermas?
Imhof bezieht aktuelle digitale Medien ein und analysiert Phänomene wie die Politisierung und die Amerikanisierung von Wahlkämpfen im „neuen“ Strukturwandel.
Welche Rolle spielt das Internet im neuen Strukturwandel?
Das Internet ermöglicht es Unbekannten, sich blitzschnell zu organisieren (z. B. Facebook-Gruppen), und hat das Fernsehen als Leitmedium abgelöst.
Was versteht man unter „Medialisierung der Politik“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem sich politische Akteure und Inhalte zunehmend an den Logiken und Formaten der Massenmedien orientieren müssen.
Warum ist die öffentliche Meinung für die Zivilgesellschaft wichtig?
Sie dient als Korrektiv staatlicher Politik und ist eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende demokratische Ordnung.
- Quote paper
- Christian Bach (Author), 2011, Was unterscheidet den ‚neuen‘ Strukturwandel der Öffentlichkeit von den Untersuchungen Habermas‘?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174725