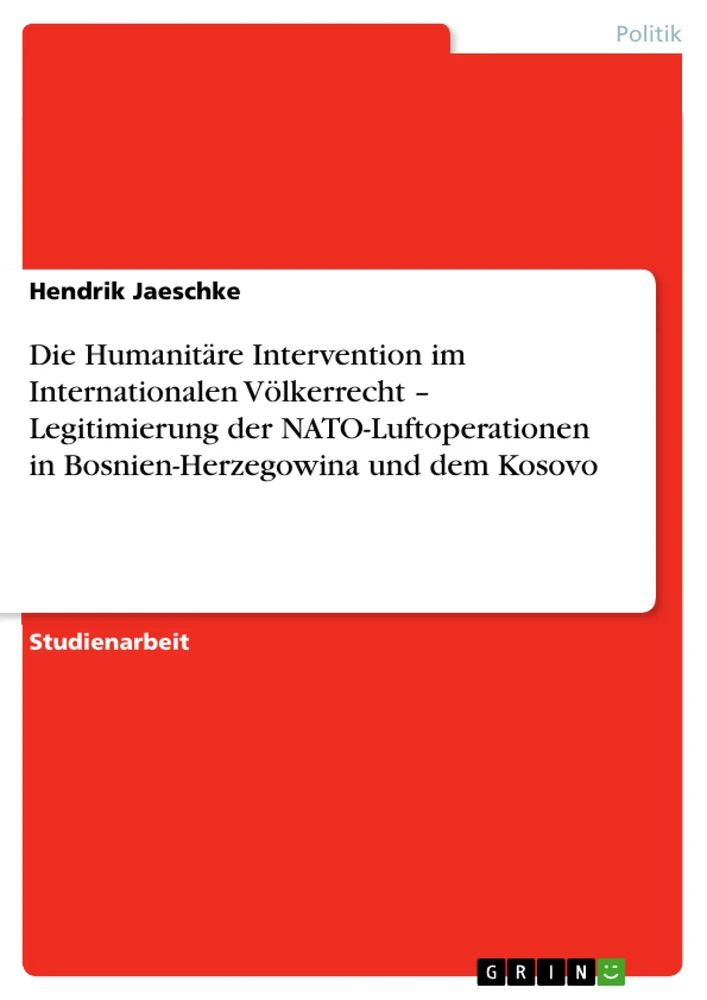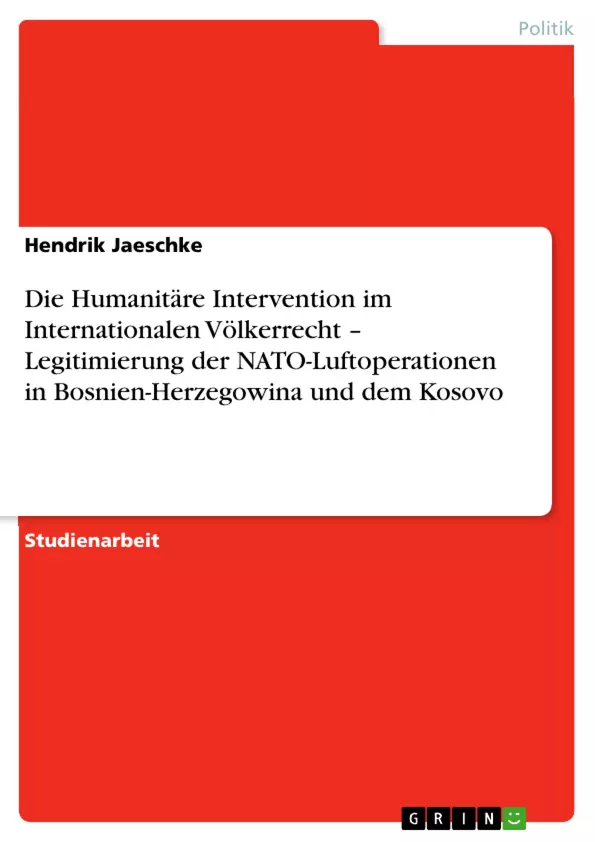Die Frage, wann ein Krieg gerechtfertigt ist und wann nicht ist oft schwer umstritten.
Doch geht es um die Verminderung, oder Vermeidung menschlichen Leids, erscheint eine militärische Intervention wahrscheinlicher. Nichtsdestoweniger stellt sich auch hier die Frage, ob und wie ein solcher Eingriff legitimiert werden kann. Da eine humanitäre Intervention einen nichterklärten Krieg darstellt und in die Souveränität einzelner Staaten eingreift, ist ihre Legitimierung an den UN-Sicherheitsrat gebunden. Dennoch fanden in der Vergangenheit Eingriffe multinationaler Verbände auch ohne ein UN-Mandat statt.
Hier stellt sich die Frage, ob diese Einsätze sich in der Zielsetzung – dem Schutz
von Menschen in einer humanitären Notlage – von denen unterscheiden, die mittels UN-Mandat durchgeführt wurden und ob ein Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien erwirkt werden konnte.
Ziel dieser Hausaufgabe ist es, die Rechtslage der Humanitären Intervention auszuarbeiten, um die entstehenden Problemaktiken bei dem Eingriff in die Souveränität des Kosovos und Bosnien-Herzegowinas zu erkennen, sowie festzustellen, ob die Zielsetzung, die Durchführung und der Erfolg, gemessen an einem Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien, militärischer Eingriffe sich auf Grund einer Legitimierung durch den UN-Sicherheitsrat voneinander unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Humanitäre Intervention als der gerechte Krieg?
- Die Humanitäre Intervention im Internationalen Völkerrecht
- Die Intervention in Bosnien-Herzegowina
- Exkurs: Der Krieg in Bosnien-Herzegowina
- Operation „Sky Monitor“
- Operation „Deny Flight“
- Operation „Deliberate Force“
- Die Zeit nach den Luftoperationen
- Die Intervention im Kosovo
- Exkurs: Der Kosovo-Konflikt
- Operation „Allied Force“
- Die Zeit nach der Luftoperation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtliche Grundlage und die praktische Anwendung von humanitären Interventionen im Internationalen Völkerrecht. Insbesondere werden die NATO-Luftoperationen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo analysiert, um die Legitimität von militärischen Interventionen ohne explizites UN-Mandat zu beurteilen.
- Die Definition und Rechtfertigung von humanitären Interventionen
- Die Spannungen zwischen Souveränität, Menschenrechtsschutz und der UN-Charta
- Die Rolle des UN-Sicherheitsrats bei der Legitimierung von Interventionen
- Die Analyse der Interventionen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo
- Die Auswirkungen von militärischen Interventionen auf die Beendigung von Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Humanitären Intervention ein und erläutert die Problematik des Eingriffs in die Souveränität von Staaten. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Frage, ob es einen „gerechten Krieg“ im Kontext der Humanitären Intervention geben kann. Kapitel 3 beleuchtet die rechtliche Grundlage der Humanitären Intervention im Internationalen Völkerrecht und diskutiert die Spannungen zwischen den beteiligten Prinzipien.
Kapitel 4 analysiert die Intervention in Bosnien-Herzegowina und setzt diese in den Kontext des dortigen Krieges. Im Detail werden die Luftoperationen „Sky Monitor“, „Deny Flight“ und „Deliberate Force“ betrachtet. Kapitel 5 untersucht die Intervention im Kosovo und beleuchtet die Operation „Allied Force“ im Detail. Die Kapitel 4 und 5 analysieren die Interventionen in Bezug auf die Rechtslage, die Zielsetzung und die Auswirkungen auf den jeweiligen Konflikt.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Internationales Völkerrecht, UN-Sicherheitsrat, NATO-Luftoperationen, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Staatensouveränität, Menschenrechte, Krieg, Waffenstillstand, Legitimität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Humanitären Intervention?
Es handelt sich um eine militärische Intervention in einem fremden Staat mit dem Ziel, massives menschliches Leid oder schwere Menschenrechtsverletzungen zu beenden.
Ist eine humanitäre Intervention völkerrechtlich legal?
Völkerrechtlich ist sie umstritten, da sie das Prinzip der staatlichen Souveränität verletzt. In der Regel ist ein Mandat des UN-Sicherheitsrats für die Legitimität erforderlich.
Wie unterschieden sich die NATO-Einsätze in Bosnien und im Kosovo?
In Bosnien-Herzegowina gab es UN-Resolutionen, die den Einsatz stützten, während die Operation „Allied Force“ im Kosovo ohne explizites UN-Mandat durchgeführt wurde.
Was war das Ziel der Operation „Deliberate Force“?
Ziel war es, die militärischen Fähigkeiten der bosnischen Serben zu schwächen, um sie zu Friedensverhandlungen und einem Waffenstillstand zu zwingen.
Können militärische Interventionen dauerhaften Frieden schaffen?
Militärische Eingriffe können oft einen Waffenstillstand erzwingen, die langfristige politische Stabilität erfordert jedoch meist zusätzliche zivile und diplomatische Maßnahmen.
- Quote paper
- Hendrik Jaeschke (Author), 2010, Die Humanitäre Intervention im Internationalen Völkerrecht – Legitimierung der NATO-Luftoperationen in Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174815