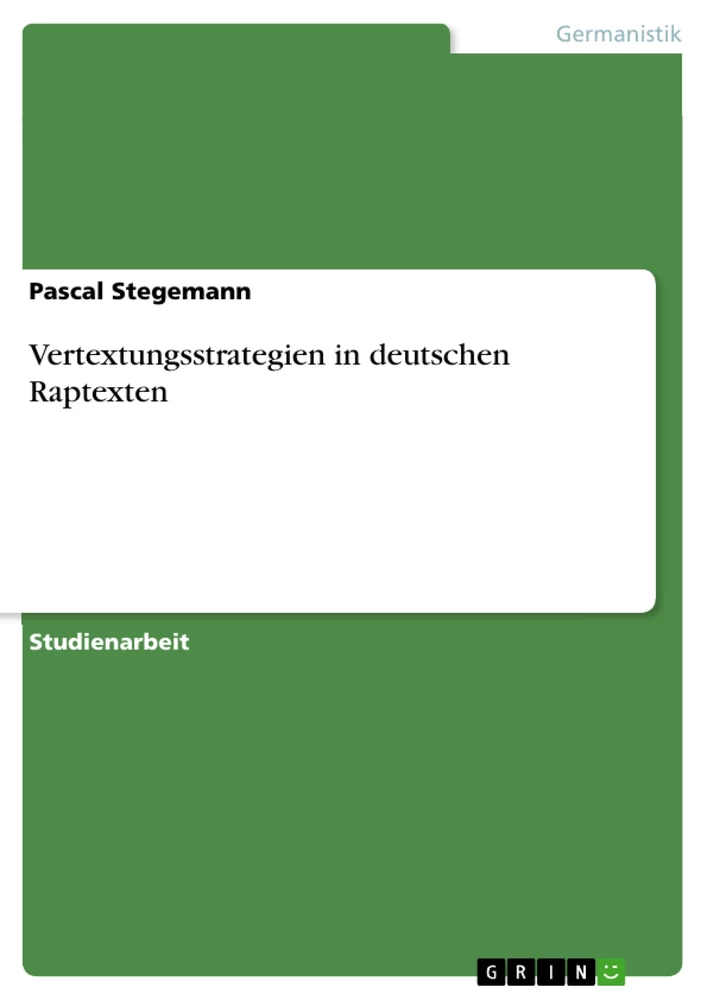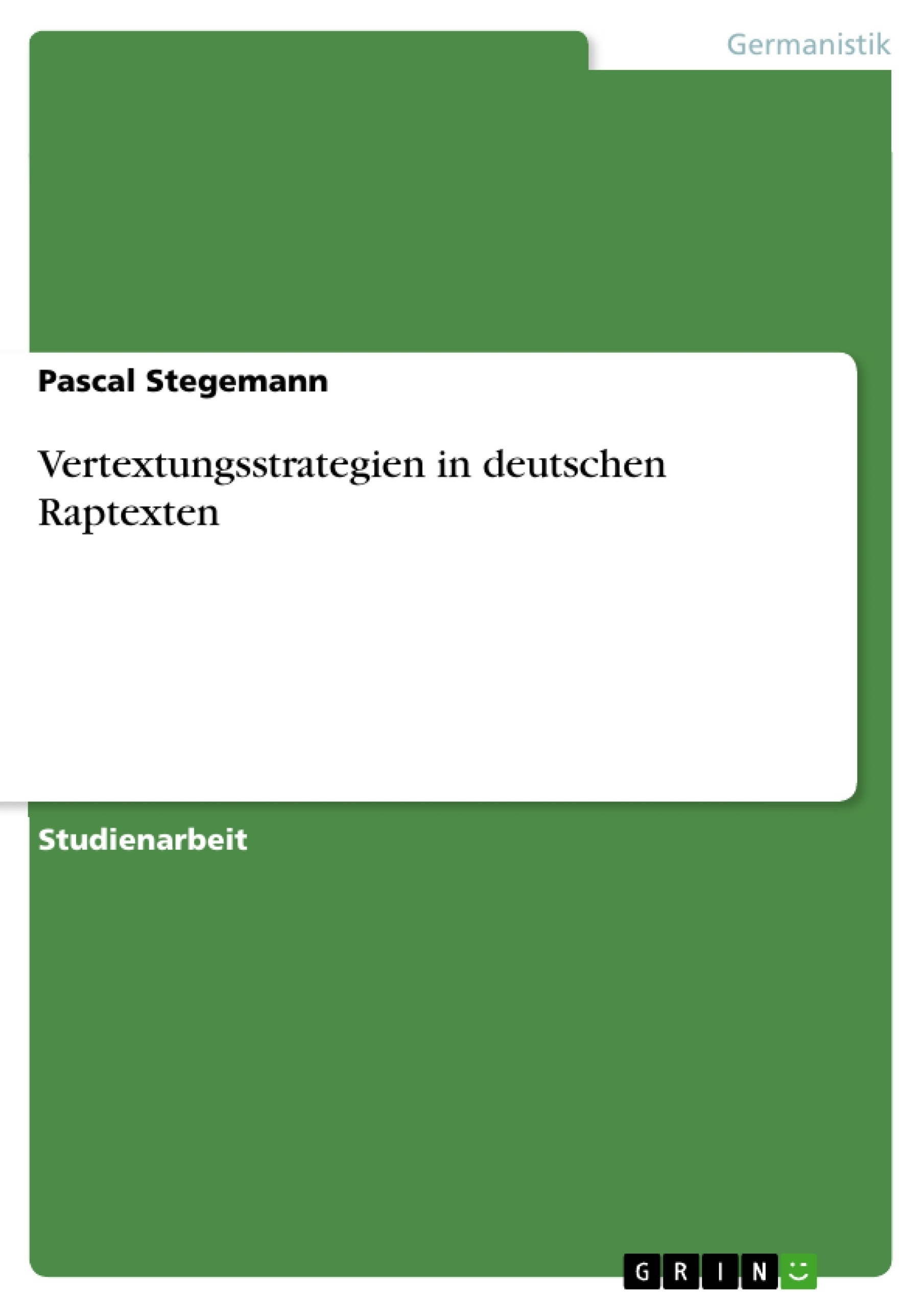I. Einleitung
Betrachtet man die Musikentwicklung der letzten Jahrzehnte, so fällt auf, dass immer mehr Songtexte von deutschen Künstlern wieder in deutscher Sprache verfasst werden. Während in den 1980er Jahren mit der Neuen Deutschen Welle ein Boom mit deutschsprachiger Musik einsetzte, so verschwand diese Entwicklung mit ein paar Ausnahmen in den 1990er Jahren nahezu komplett. Songs wurden auch von deutschen Künstlern größtenteils auf Englisch gesungen. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts kamen wieder deutschsprachige Texte an die Oberfläche und Bands mit deutschen Texten wie Juli, Silbermond oder auch Die Söhne Mannheims eroberten den Musikmarkt.
Wenn die eigene Muttersprache in Musik und Kultur erst zuungunsten einer fremden Sprache verschmäht wird, dann aber wieder Einzug in unsere Kulturprodukte findet, so sagt das viel über den Stellenwert einer Sprache aus.
Relevant ist dies insofern für die Sprachwissenschaft, als dass analysiert werden kann, auf welche Art und Weise in deutschen Songtexten kommuniziert wird. Dies soll das vorrangige Erkenntnisinteresse dieser Arbeit sein.
Eine genauere Untersuchung der Vertextungsstrategien der Songtexte als Modelle zur stilistischen Differenzierung von Texten soll dabei Erkenntnisse liefern, wie bei der Textsorte „deutsche Songtexte“ Inhalte und Botschaften sprachlich vermittelt werden.
Um sich dem Thema anzunähern, ist eine kurze Einführung in die Stilistik als Teilbereich der Linguistik notwendig, um die Voraussetzungen und Gegebenheiten für das Vorhandensein von Vertextungsstrategien festlegen und definieren zu können.
Als Untersuchungsobjekte dienen dabei drei deutsche Songtexte: 6 Meter 90 von der HipHop-Band Blumentopf, Adriano von Brothers Keepers und Traumreise von den Massiven Tönen. Da alle drei Songs dem deutschen HipHop-Genre entstammen, wird kurz auf den HipHop-Begriff und die wichtigsten Merkmale der HipHop-Kultur sowie dessen kulturellen Beitrag zur deutschen Sprache eingegangen, weil selbstverständlich wirkt und funktioniert Sprache nur im Kontext seiner spezifischen Kultur.
Ein Fazit soll die gewonnenen Erkenntnisse nochmals zusammenfassen und die Relevanz für die Linguistik und die Stilistik hervorheben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Der Stilbegriff in der Linguistik
- 1.1 Herkunft und Bedeutung
- 1.2 Stil als Abweichung der Normsprach
- 2. Vertextungsstrategien
- 3. Die HipHop-Kultur und Sprache
- II. Analyse der Vertextungsstrategien der Songtexte Traumreise, Adriano und 6 Meter 90
- 1. Massive Töne: Traumreise
- 2. Blumentopf - 6 Meter 90
- 3. Brothers Keepers - Adriano
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Vertextungsstrategien in deutschen Raptexten und analysiert die sprachliche Gestaltung von Musiktexten im Kontext der HipHop-Kultur. Das Ziel ist es, Erkenntnisse über die Art und Weise zu gewinnen, wie in deutschen Songtexten Inhalte und Botschaften sprachlich vermittelt werden.
- Stilbegriff in der Linguistik
- Vertextungsstrategien im Kontext von Raptexten
- HipHop-Kultur und Sprache
- Analyse von Songtexten aus der HipHop-Szene
- Relevanz für die Linguistik und Stilistik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Stilbegriff in der Linguistik. Dabei wird die Entstehung des Begriffs sowie seine Bedeutung im Kontext der Sprachwissenschaft dargestellt. Des Weiteren werden die Vertextungsstrategien als Modelle zur stilistischen Differenzierung von Texten vorgestellt. Die HipHop-Kultur und deren Einfluss auf die deutsche Sprache werden ebenfalls beleuchtet.
Im zweiten Kapitel erfolgt eine Analyse der Vertextungsstrategien in drei ausgewählten deutschen Songtexten: „Traumreise“ von den Massiven Tönen, „Adriano“ von Brothers Keepers und „6 Meter 90“ von Blumentopf.
Schlüsselwörter
Stil, Vertextungsstrategien, deutsche Raptexte, HipHop-Kultur, Stilistik, Linguistik, deutsche Sprache, Songtexte, Kommunikation, Sprachliche Gestaltung, Musiktexte, Analyse
Häufig gestellte Fragen
Was sind Vertextungsstrategien in der Rapmusik?
Vertextungsstrategien sind sprachliche und stilistische Mittel, mit denen Rapper ihre Botschaften strukturieren, Reime aufbauen und eine spezifische Wirkung beim Hörer erzielen.
Wie beeinflusst die HipHop-Kultur die deutsche Sprache?
HipHop bringt neue Wortschöpfungen, Slang und rhythmische Strukturen in die Sprache ein und dient als Medium zur stilistischen Differenzierung von Texten.
Welche Rolle spielt der „Stil“ in der linguistischen Analyse von Rap?
In der Linguistik wird Stil oft als Abweichung von der Normsprache betrachtet. Rap nutzt diese Abweichungen gezielt, um Authentizität und Gruppenzugehörigkeit auszudrücken.
Welche Songs werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht „6 Meter 90“ von Blumentopf, „Adriano“ von Brothers Keepers und „Traumreise“ von den Massiven Tönen.
Warum ist deutsches Rap-Songwriting für die Stilistik relevant?
Es zeigt, wie moderne Künstler die deutsche Sprache nutzen, um komplexe soziale und persönliche Inhalte in einer spezifischen Textsorte zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Pascal Stegemann (Autor), 2011, Vertextungsstrategien in deutschen Raptexten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174824