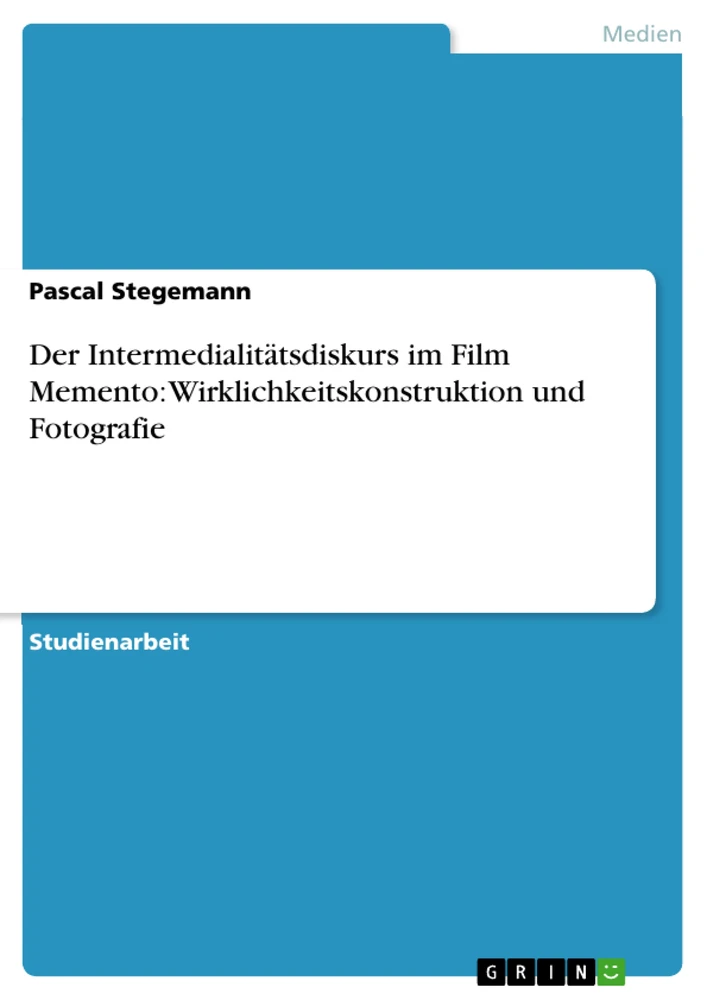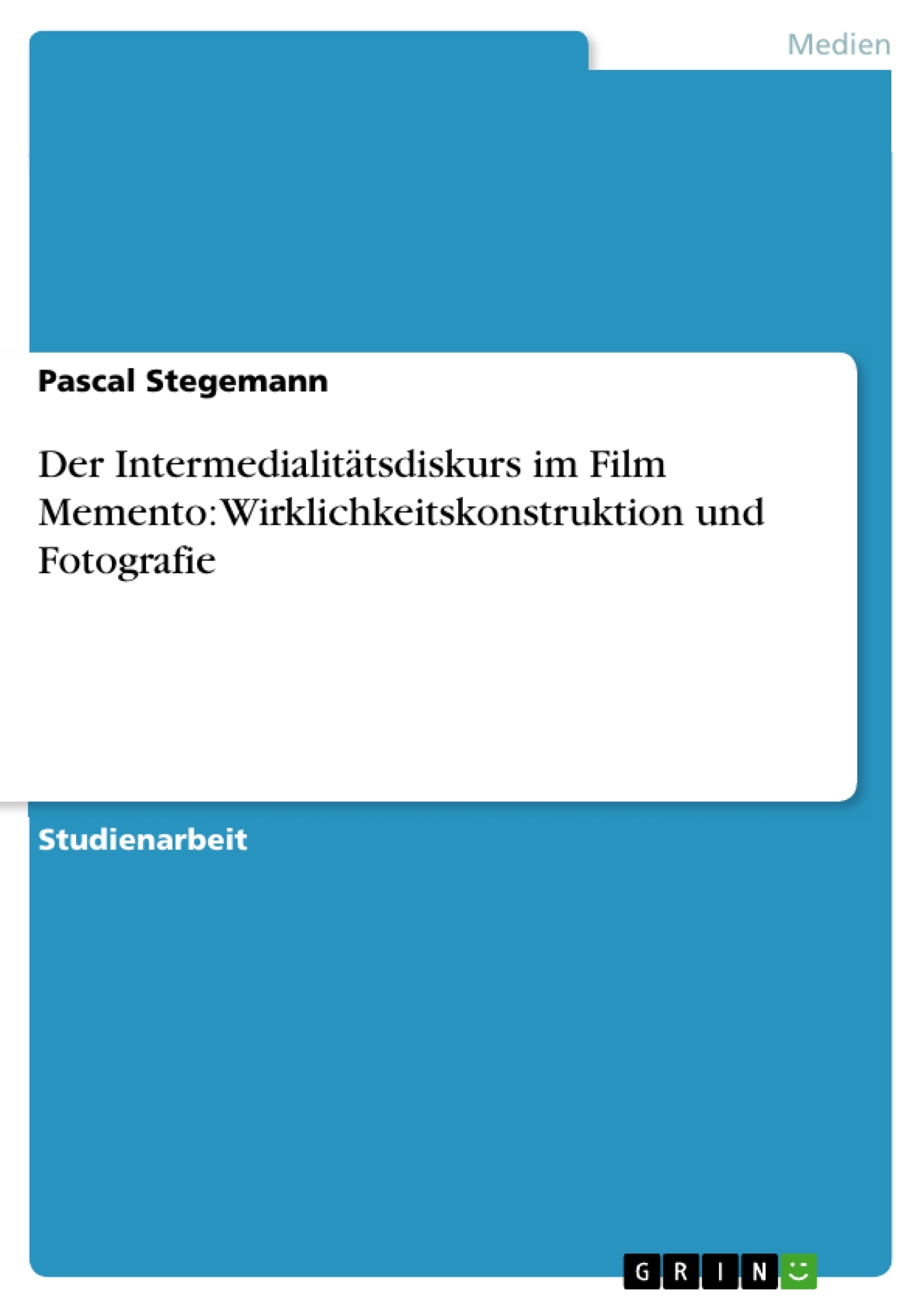I. Einführung
1. Theoretischer Hintergrund: Allgemeiner Intermedialitätsbegriff
Der Begriff der Intermedialität ist in den letzten Jahren zunehmend gebräuchlicher und alltagstauglich geworden. Er soll der immer offenkundigeren Tatsache, dass Medien nicht für sich alleine bestehen, sondern in komplexen, medialen Konfigurationen stets auf andere Medien bezogen sind, Rechnung tragen. Ein überstrapazierter egriff für ein Phänomen also, das sich kaum mehr eingrenzen lässt. Das dürfte zwei Gründe haben: Erstens den Boom der Neuen Medien und zweitens die daraus entstehende Notwendigkeit, alles miteinander vernetzen zu wollen.
1.1. Der Intermedialitätsbegriff in der Entwicklung
Der Intermedialitätsbegriff wurde im deutschen Sprachraum 1983 das erste Mal von Hansen-Löve verwendet und machte seitdem parallel zum Wandel des Medienbegriffs eine begriffliche und theoretische Entwicklung durch. Während Hansen-Löve seinen Intermedialitätsbegriff lediglich auf die Korrelation von Wort- und Bildkunst beschränkt, wählt Irina Rajewsky bei ihrer Definition einen anderen Weg und beschreibt Intermedialität als „Mediengrenzen überschreitende Phänomene, die mindestens zwei konventionell als distinkt wahrgenommene Medien involvieren."
Dabei grenzt sie drei verschiedene Phänomenbereiche gegeneinander ab: Die Medienkombination, d.h. ein Medienprodukt konstituiert sich aus mindestens zwei neuen Einzelmedien.
An zweiter Stelle wird der Medienwechsel genannt, d.h. Medientransformationen in weitestem Sinne wie beispielsweise Literaturverfilmungen oder Adaptionen. Den dritten Bereich bilden laut Rajewsky die intermedialen Bezüge, die beschreiben, dass sich innerhalb eines Textes eines Mediums Bezüge auf mindestens ein weiteres Medium befinden. Es geht also darum, dass ein Medium ein anderes repräsentiert und nicht etwa ein anderes enthält.
Bestimmte Aspekte eines Mediums können in einem anderen Medium mit dessen spezifischen Mitteln hervorgerufen oder simuliert werden.
Julia Kristeva beschreibt Intertextualität als eine „Transposition von Zeichensystemen“ und bezeichnet Intermedialität davon ausgehend als einen Kontakt zwischen verschiedenen Medien, als ein Zusammenspiel verschiedener Medien oder als Wechselwirkung zwischen Medien.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretischer Hintergrund: Allgemeiner Intermedialitätsbegriff
- Der Intermedialitätsbegriff in der Entwicklung
- Intermedialität und Postmodernismus
- Der postmodernistische Text nach Jacques Derrida
- Der postmodernistische Film und seine Merkmale
- Der Intermedialitätsdiskurs im Film Memento: Wirklichkeitkonstruktion und Fotografie
- Wirklichkeit
- Inhaltsangabe von Memento
- Fotografie als Medium zwischen Subjektivität und Objektivität
- Die Rolle des Mediums Fotografie in Memento
- Fotografie als mediale Konservierung von Fakten und bewusster Selbstbetrug
- Mediale Rekonstruktion der Wirklichkeit als Ausdruck einer komplexen Welt
- Auflösung von Zeit, Raum und Wahrnehmung durch die mediale Repräsentation
- Der Aufbau des Mediums Fotografie als Äquivalent zum strukturellen Prinzip des Films
- Fazit: Fotografie als identitätsstiftendes Medium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Mediums Fotografie im postmodernen Film, anhand des Beispiels von Christopher Nolans Memento. Der Fokus liegt auf der Analyse der Intermedialität, speziell des Verhältnisses von Film und Fotografie, und wie diese die Konstruktion der Wirklichkeit im Film beeinflussen.
- Der Intermedialitätsbegriff und seine Entwicklung
- Der postmodernistische Film und seine Merkmale
- Die Rolle der Fotografie in Memento als mediale Konservierung von Fakten
- Die Darstellung von Zeit und Raum im Film durch die mediale Repräsentation
- Die Bedeutung der Fotografie für die Konstruktion von Identität im Film
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Intermedialitätsbegriff und seine Entwicklung. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Intermedialität und Postmodernismus, wobei der postmodernistische Text nach Jacques Derrida sowie die Merkmale des postmodernistischen Films näher betrachtet werden.
Der Hauptteil der Arbeit analysiert den Film Memento im Hinblick auf seine Intermedialität, speziell die Rolle der Fotografie als Medium zwischen Subjektivität und Objektivität. Die Analyse beleuchtet, wie die Fotografie im Film verwendet wird, um Fakten zu konservieren und gleichzeitig eine bewusst verzerrte Darstellung der Wirklichkeit zu schaffen. Darüber hinaus wird untersucht, wie die mediale Repräsentation von Zeit und Raum im Film die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflusst.
Schlüsselwörter
Intermedialität, Postmodernismus, Film, Memento, Fotografie, Wirklichkeit, Subjektivität, Objektivität, mediale Repräsentation, Zeit, Raum, Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Intermedialität im Film?
Intermedialität beschreibt das Zusammenspiel verschiedener Medien innerhalb eines Werks, z. B. wenn die Fotografie als Medium im Film "Memento" eine zentrale Rolle spielt.
Welche Rolle spielt die Fotografie im Film "Memento"?
Die Fotografie dient dem Protagonisten Leonard als Ersatz für sein Kurzzeitgedächtnis, um Fakten festzuhalten und seine Identität zu konstruieren.
Warum gilt "Memento" als postmoderner Film?
Der Film nutzt eine nicht-lineare Erzählstruktur, hinterfragt die objektive Wahrheit und zeigt die Fragmentierung von Zeit, Raum und Wahrnehmung.
Ist Fotografie in "Memento" ein objektives Medium?
Nein, der Film zeigt, dass Fotografien zwar Fakten konservieren, ihre Interpretation jedoch subjektiv ist und sogar zum bewussten Selbstbetrug genutzt werden kann.
Was versteht Irina Rajewsky unter intermedialen Bezügen?
Es beschreibt, dass ein Medium (der Film) ein anderes Medium (die Fotografie) mit seinen spezifischen Mitteln repräsentiert oder simuliert.
- Quote paper
- B.A. Pascal Stegemann (Author), 2010, Der Intermedialitätsdiskurs im Film Memento: Wirklichkeitskonstruktion und Fotografie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174825