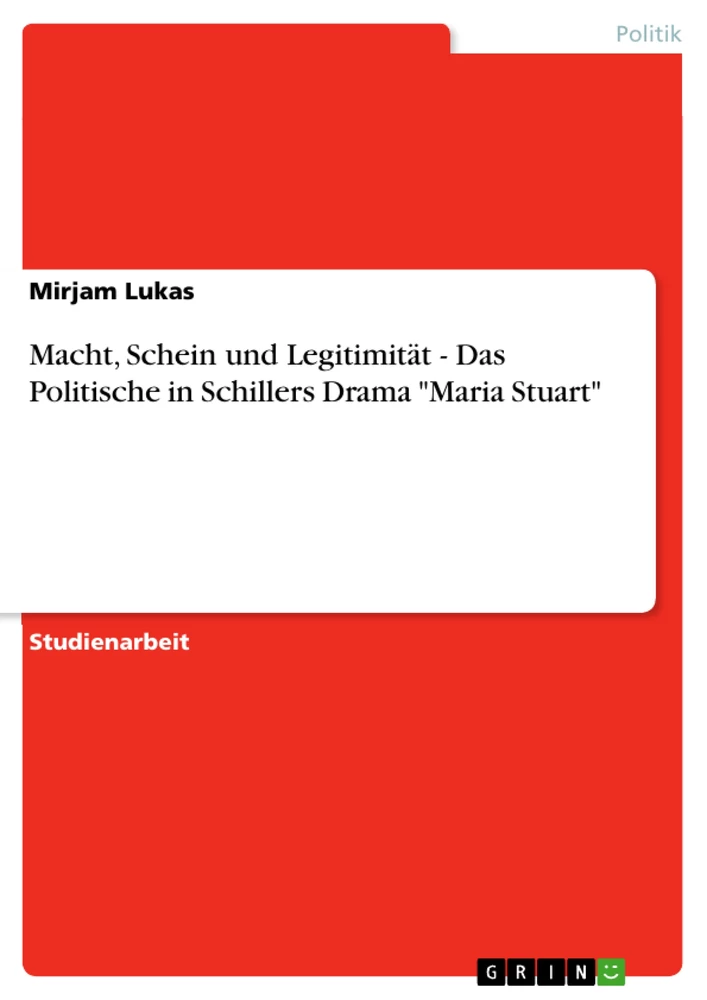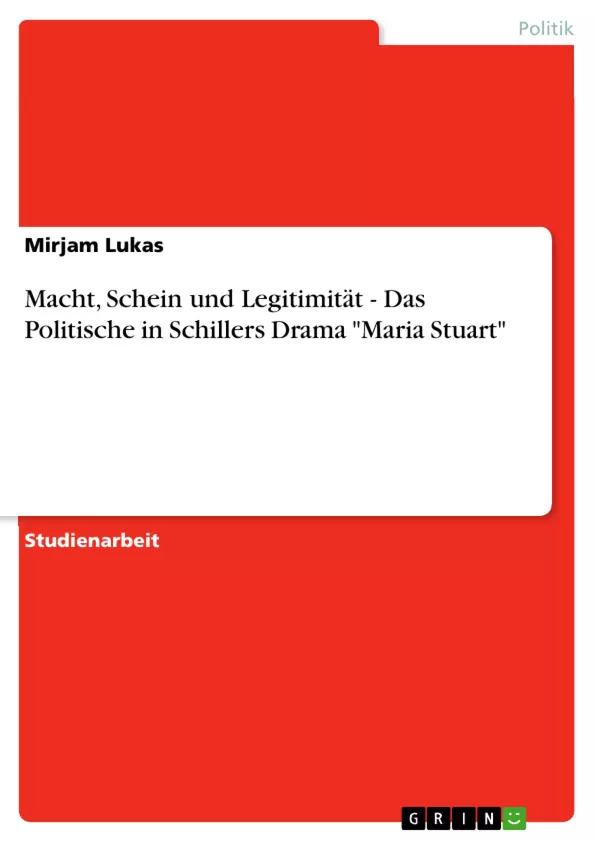1. Einleitung
Schon allein durch die Titelhelden Fiesko, Don Karlos, Maria Stuart oder Demetrius wird belegt, dass sich die Dramen von Friedrich Schiller überwiegend in den Gipfelzonen politischer Macht bewegen. Der private Raum persönlicher Krisen wird zum öffentlichen Feld politischer Krisen, indem Schiller seine Dramengestalten vor allem auf der politischen Bühne agieren lässt. Wie Schiller und seine Zeitgenossen in der Französischen Revolution erlebten, kommt dem absoluten Herrscher die einem irdischen Stellvertreter Gottes gemäße Machtvollkommenheit zu. Er selbst steht zwar über dem Gesetz, nicht jedoch über dem Recht. In dieser prinzipiellen Gefährdung der Mächtigen durch den Versuch der rechtmäßigen Erhaltung ihrer Macht schlägt die Stunde von Schillers politischen Helden. Als ihr Schöpfer nimmt Schiller zweifellos an ihrem Schicksal teil, doch ist er deshalb schon ein politischer Dichter?
Obwohl Schiller vorrangig die Herrschaft, die Regierung oder die Macht als einen großen Gegenstand präsentiert, lässt er sich laut Dolf Sternberger vorwiegend von einem poetischen Willen leiten. Die Protagonisten seiner Dramen liefern allesamt ein Beispiel dafür, dass es keine Freiheit von außen gibt, dass, wer die Herrschaft und somit die Macht anstrebt, die Freiheit der anderen verletzen oder umbiegen muss. Die bevorzugte unumschränkte Machtvollkommenheit von Schillers politischen Helden stigmatisiert diese zu Tyrannen und Despoten. So scheinen seine Helden Machiavelli gründlich gelesen zu haben, denn ihre Gedanken kreisen um Machtgewinn, Machtgebrauch, Machterhaltung und lösen, in deutlichem Gegensatz zu Schiller selbst, das politische Handeln von moralischer Verantwortung. Schiller selbst fühlt sich unwissend auf dem politischen Felde, weil die Politik in seinen Augen die Angelegenheit der Höfe und der geheimen Kabinette war, eine schwer zu durchdringende Kunst der Berechnung, fern von der vertraulicheren Sphäre des bürgerlichen Lebens, dem sich Friedrich Schiller zugehörig fühlt und zugehörig weiß. Der junge Schiller erkennt den Gegensatz zwischen dem „Kabinett“ und dem „Herzen“, denn dieser läuft ziemlich genau auf denjenigen zwischen „Kabale“ und „Liebe“ hinaus. Doch diese Gegenläufigkeit des Politischen und des Menschlichen beginnt in seinen Dramen allmählich zu verblassen und zu verschwimmen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politik in Maria Stuart
- Recht und Gerechtigkeit
- Kritik am Absolutismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert das Drama „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller aus einer politischen Perspektive. Er untersucht, wie Schiller die Themen Recht, Gerechtigkeit, Macht und Herrschaft im Kontext des 16. Jahrhunderts behandelt und welche Kritik er am Absolutismus übt.
- Die Darstellung des politischen und rechtlichen Konflikts zwischen Maria Stuart und Elisabeth I.
- Die Kritik an der Willkür und Ungerechtigkeit der Justiz im Drama.
- Die Auseinandersetzung mit der Frage der Macht und Herrschaft im Kontext der konstitutionellen Monarchie.
- Die Darstellung von Maria Stuart als Märtyrerin und Opfer politischer Machtspiele.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus auf die politische Thematik in Schillers Dramen legt. Er beschreibt Schillers Interesse an Machtstrukturen und die Konflikte, die aus dem Streben nach Macht und Herrschaft entstehen. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse von „Maria Stuart“ im Kontext der politischen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts.
Politik in Maria Stuart
Dieses Kapitel analysiert die politischen Inhalte des Dramas „Maria Stuart“. Der Text beleuchtet die Verbindung von Märtyrerdrama und politischem Trauerspiel, die im Drama deutlich wird. Er beschreibt den zeitgenössischen Diskurs über die konstitutionelle Monarchie und die parlamentarische Verfasstheit, die im Drama behandelt werden.
Recht und Gerechtigkeit
Dieser Abschnitt untersucht die Kritik an der Willkür und Ungerechtigkeit der Justiz, die im Drama dargestellt wird. Der Text fokussiert sich auf den Prozess gegen Maria Stuart und die Verletzung grundlegender Rechtsstandards. Er analysiert die Unzulässigkeit des Verfahrens gegen Maria Stuart, die weder als englische Staatsbürgerin anerkannt wird noch die Möglichkeit erhält, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen.
Schlüsselwörter
Schillers Drama „Maria Stuart“ befasst sich mit wichtigen Themen wie Recht, Gerechtigkeit, Macht, Herrschaft und Absolutismus. Die Analyse konzentriert sich auf die Kritik an der Willkür der Justiz, den Konflikt zwischen konstitutioneller und absolutistischer Monarchie sowie die Darstellung von Maria Stuart als Opfer politischer Machtspiele.
Häufig gestellte Fragen
Welche politischen Themen behandelt Schillers „Maria Stuart“?
Das Drama thematisiert Macht, Herrschaft, Legitimität sowie den Konflikt zwischen absolutistischer Willkür und dem Streben nach Gerechtigkeit.
Wie wird die Justiz im Drama kritisiert?
Schiller zeigt die Rechtswidrigkeit des Prozesses gegen Maria Stuart auf, die weder als englische Untertanin gilt noch faire Verteidigungsmöglichkeiten erhält.
Was symbolisiert der Konflikt zwischen Maria und Elisabeth?
Er steht für den Gegensatz zwischen moralischer Integrität („Herz“) und politischer Berechnung („Kabinett“ oder „Kabale“).
War Friedrich Schiller ein politischer Dichter?
Obwohl er politische Machtstrukturen meisterhaft darstellte, sah er sich selbst eher als poetischen Willen, der die menschliche Freiheit ins Zentrum stellte.
Was ist die Bedeutung der konstitutionellen Monarchie im Stück?
Die Arbeit analysiert, wie zeitgenössische Diskurse über eine durch Gesetze und Parlamente beschränkte Herrschaft in das Drama einfließen.
- Quote paper
- Mirjam Lukas (Author), 2010, Macht, Schein und Legitimität - Das Politische in Schillers Drama "Maria Stuart", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174890