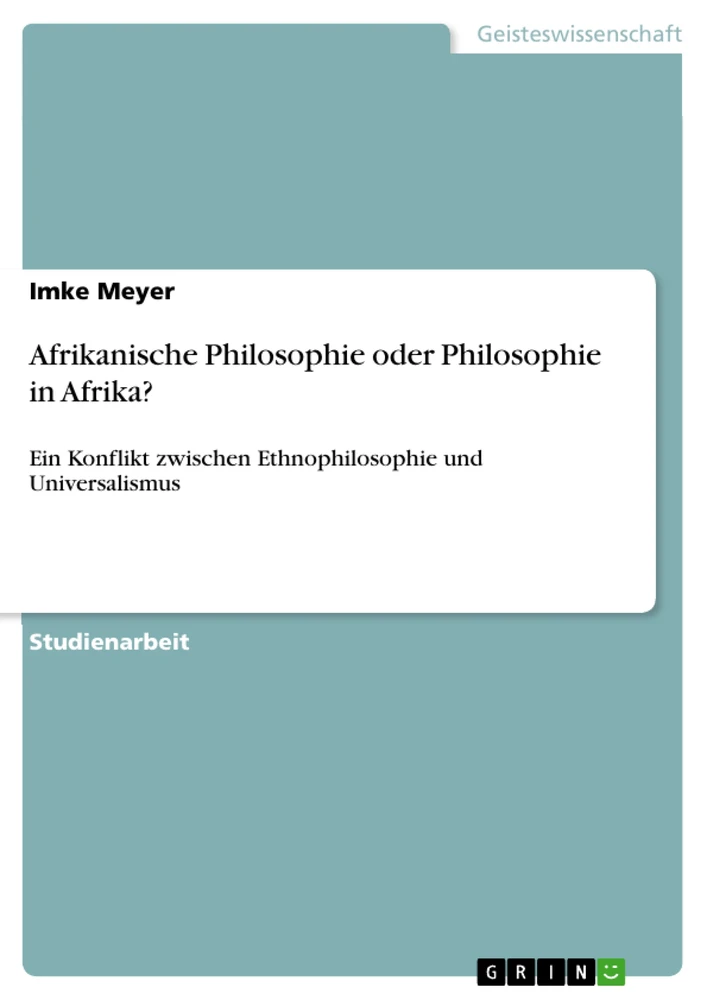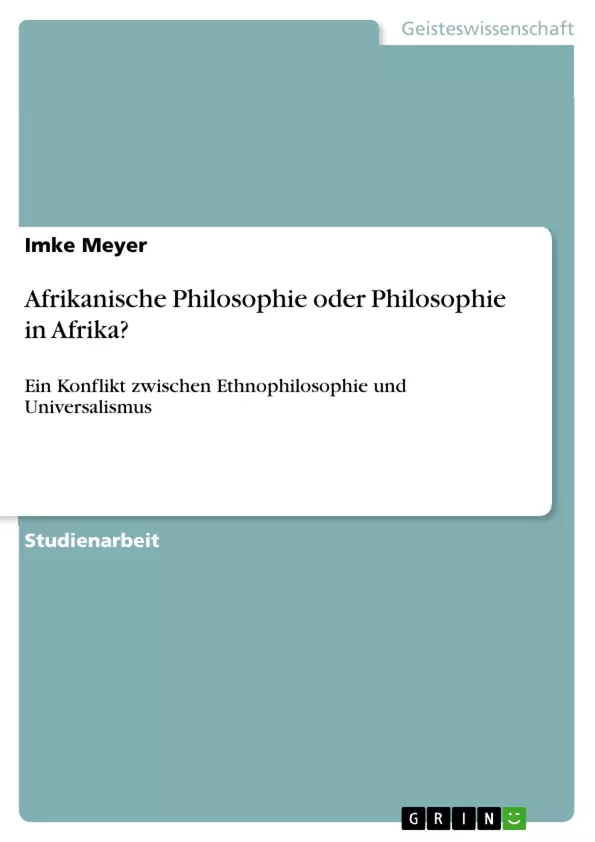Afrikanische Philosophie oder Philosophie in Afrika? Es gibt wohl keine Frage, die die Diskussion um die afrikanische Philosophie der Gegenwart so entscheidend geprägt hat wie diese. Im Zentrum dieser Frage steht dabei der Philosophiebegriff selbst. Dieser kann entweder als kulturgebunden oder aber als kulturunabhängig, d.h. universal verstanden werden. Der afrikanische Philosoph Paulin Jidenu Hountdonji fasst die Problematik folgendermaßen zusammen:
Was ist Philosophie oder genauer, was ist afrikanische Philosophie? Das Problem lautet, ob durch das Hinzufügen des Wortes „afrikanisch“ die habi-tuelle Bedeutung des Begriffes „Philosophie“ beibehalten bleibt oder ob es durch eine einfache Hinzufügung eines Adjektivs notwendigerweise zu ei-ner Änderung der Bedeutung des Substantivs kommt. Was zur Disposition steht, ist die Universalität des Begriffes „Philosophie“ jenseits seiner mögli-chen geographischen Applikationen.
Kulturgebundenheit und Universalität des Philosophiebegriffs scheinen also un-vereinbar einander gegenüberzustehen – zumindest dann, wenn es um den afri-kanischen Kontinent geht.
Aufgabe dieser wissenschaftlichen Arbeit soll es sein, den Konflikt zwischen den beiden konkurrierenden Grundpositionen darzustellen und miteinander zu verglei-chen. Dabei soll zunächst auf den belgischen Missionar Placide Tempels einge-gangen werden, der mit seinem 1946 publizierten Werk Bantu-Philosophie den Grundstein für die sogenannte Ethnophilosophie gelegt hat und damit als Vertreter des kulturgebundenen Ansatzes gesehen werden kann. Darauf folgt eine Analyse des universalistischen Ansatzes, vertreten durch den wohl schärfsten Kritiker der Ethnophilosophie: Paulin J. Hountondji. Als zusätzlichen Repräsentanten des uni-versalistischen Ansatzes soll der afrikanische Philosoph Kwasi Wiredu mit seinem Werk Philosophy and an African Culture vorgestellt werden. Den Schlussteil der Arbeit bildet eine kritische Gegenüberstellung der beiden Ansätze.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der ethnophilosophische Ansatz
- Placide Tempels: Bantu-Philosophie
- Allgemeines über das Werk
- Lebenskraft als zentraler Wert der Bantu-Philosophie
- Die Ontologie der Bantu
- Rezeption des ethnophilosophischen Ansatzes nach Tempels
- Der universalistische Ansatz
- Paulin J. Hountondi: Afrikanische Philosophie. Mythos und Realität.
- Allgemeines über das Werk
- Die Frage nach der Existenz afrikanischer Philosophie
- Die Rolle der afrikanischen Philosophen
- Philosophie als Geschichte
- Kwasi Wiredu: Philosophy and an African Culture
- Allgemeines über das Werk
- Traditionelle Philosophie vs. moderne Philosophie
- Rezeption des universalistischen Ansatzes nach Hountondji und Wiredu
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die afrikanische Philosophie, die sich um die Frage dreht, ob diese als kulturgebunden oder universell zu verstehen ist. Die Arbeit analysiert den Konflikt zwischen dem ethnophilosophischen und dem universalistischen Ansatz und stellt die wichtigsten Vertreter beider Positionen vor, nämlich Placide Tempels und Paulin J. Hountondji, sowie Kwasi Wiredu als weiteren Vertreter des universalistischen Ansatzes.
- Der kulturgebundene Ansatz der Ethnophilosophie, vertreten durch Placide Tempels
- Die Kritik an der Ethnophilosophie durch den universalistischen Ansatz, vertreten durch Paulin J. Hountondji
- Der universalistische Ansatz von Kwasi Wiredu
- Der Vergleich der beiden Ansätze und deren Auswirkungen auf die afrikanische Philosophie
- Die Frage nach der Universalität des Philosophiebegriffs im Kontext Afrikas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Afrikanische Philosophie oder Philosophie in Afrika? Sie beleuchtet den Konflikt zwischen dem kulturgebundenen und dem universalistischen Ansatz im Kontext des Philosophiebegriffs.
Kapitel 2 widmet sich dem ethnophilosophischen Ansatz, der die Rekonstruktion einer traditionellen afrikanischen Philosophie aus Sprichwörtern, Grammatiken und sozialen Institutionen verfolgt. Als Basiswerk der Ethnophilosophie wird Placide Tempels "Bantu-Philosophie" untersucht, in der er die Lebenskraft als zentralen Wert der Bantu-Philosophie identifiziert und eine Ontologie der Bantu entwickelt.
Kapitel 3 analysiert den universalistischen Ansatz, der die Universalität des Philosophiebegriffs betont und die Existenz einer spezifisch afrikanischen Philosophie in Frage stellt. Paulin J. Hountondji kritisiert die Ethnophilosophie als nicht wissenschaftlich fundiert und plädiert für eine afrikanische Philosophie, die sich an den Standards der modernen Philosophie orientiert. Kwasi Wiredu setzt sich ebenfalls für einen universalistischen Ansatz ein und argumentiert für die Relevanz traditioneller afrikanischer Werte in einer modernen Philosophie.
Schlüsselwörter
Ethnophilosophie, Universalismus, Afrikanische Philosophie, Bantu-Philosophie, Lebenskraft, Ontologie, Placide Tempels, Paulin J. Hountondji, Kwasi Wiredu, Traditionelle Philosophie, Moderne Philosophie, Kulturgebundenheit, Universalität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kernunterschied zwischen „Afrikanischer Philosophie“ und „Philosophie in Afrika“?
Die Debatte dreht sich darum, ob Philosophie zwingend kulturgebunden ist oder ob sie als universale Wissenschaft unabhängig von geografischen Grenzen existiert.
Was versteht man unter „Ethnophilosophie“?
Unter Ethnophilosophie versteht man den Ansatz, eine traditionelle Philosophie aus kulturellen Elementen wie Sprichwörtern, Mythen und sozialen Institutionen zu rekonstruieren.
Wer war Placide Tempels und was war sein Beitrag?
Tempels war ein belgischer Missionar, der mit seinem Werk „Bantu-Philosophie“ (1946) den Grundstein für die Ethnophilosophie legte und die „Lebenskraft“ als zentralen Wert identifizierte.
Warum kritisiert Paulin J. Hountondji die Ethnophilosophie?
Hountondji sieht in ihr einen Mythos; er fordert eine wissenschaftliche Philosophie in Afrika, die sich an universalen Standards orientiert und von afrikanischen Philosophen selbst verfasst wird.
Welchen Standpunkt vertritt Kwasi Wiredu?
Wiredu vertritt ebenfalls einen universalistischen Ansatz und untersucht das Verhältnis zwischen traditioneller und moderner Philosophie in der afrikanischen Kultur.
- Citar trabajo
- Imke Meyer (Autor), 2009, Afrikanische Philosophie oder Philosophie in Afrika?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174903