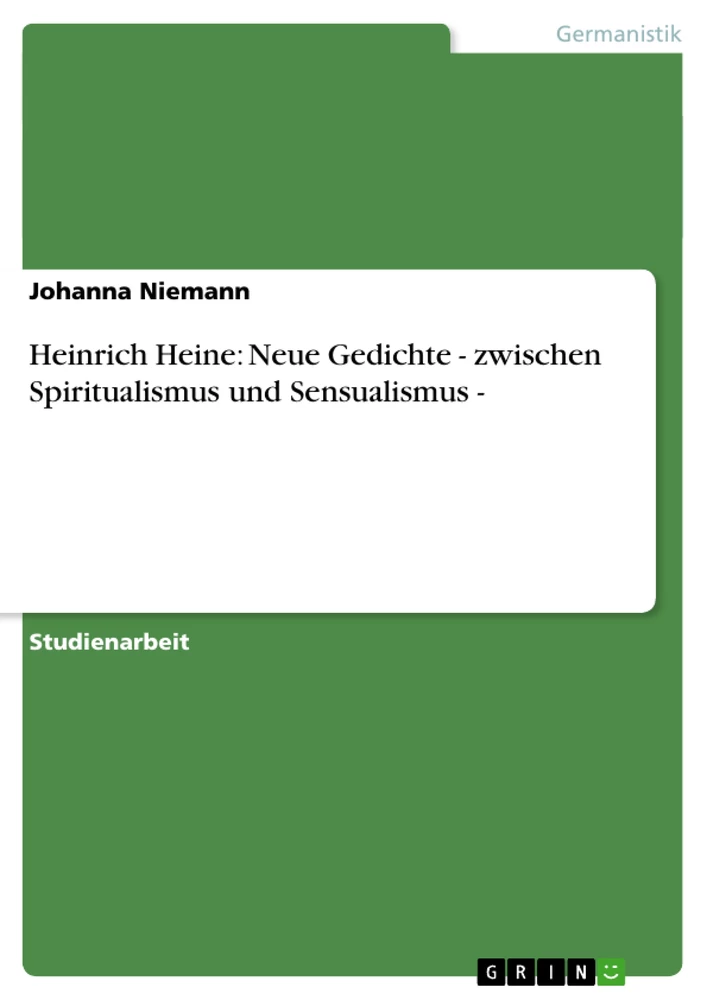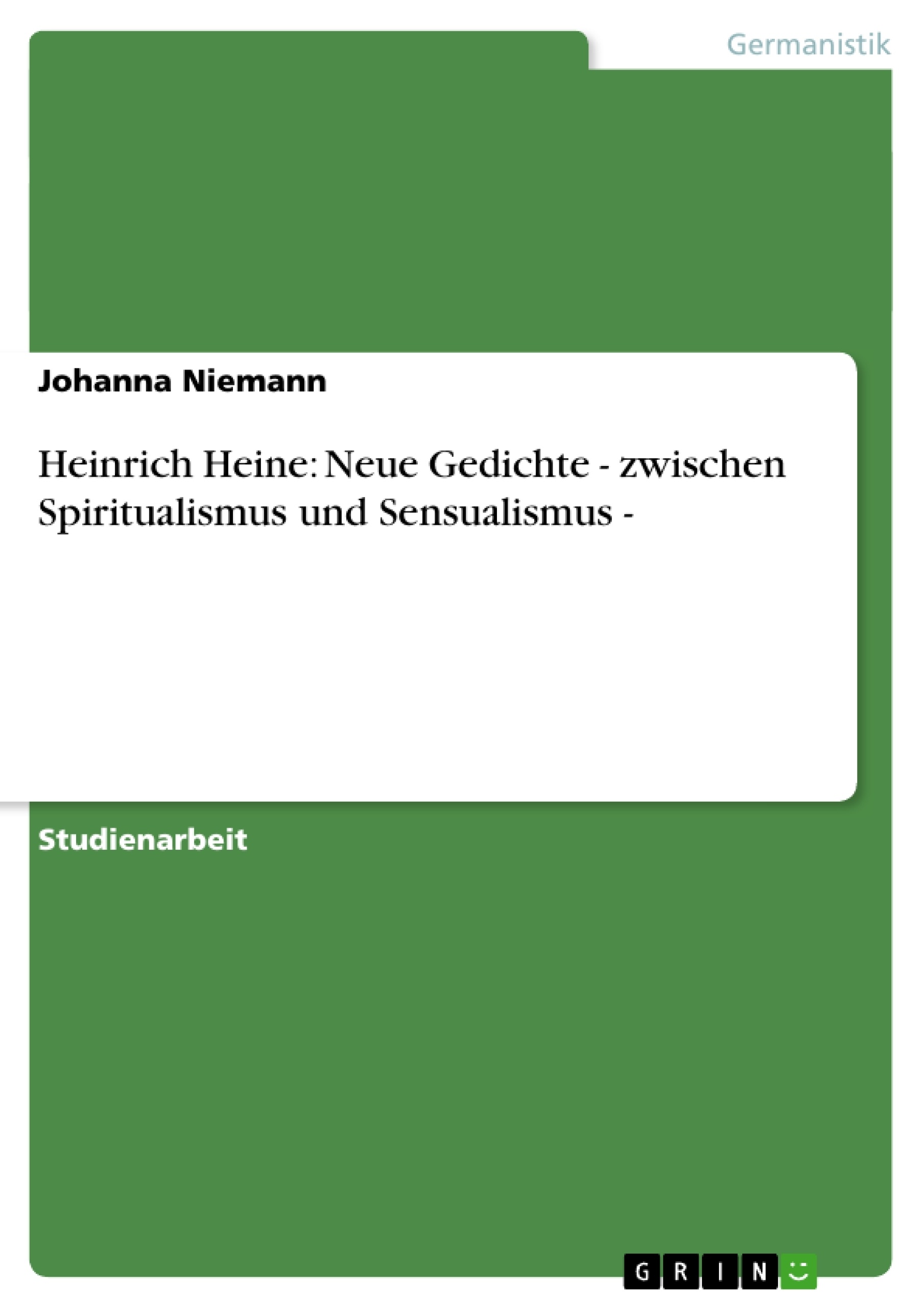Als Heinrich Heine um 1820 in die Gesellschaft eintrat, galt ein Liebeskonzept, in
dem die Erotik nur die Rolle der Initialzündung für die gegenseitige Sympathie spielen durfte,
ansonsten aber abgewertet wurde. Formen erotischer Kontaktaufnahme waren der
bürgerlichen Gesellschaft des 18. Und 19. Jahrhunderts in Deutschland nicht möglich. Das
bedeutete für Heine, wie für viele andere junge Männer auch, daß ihm ein Äußerstes an
Entsagungsbereitschaft abverlangt wurde.
Die schmachtende Frustration die der junge Heine empfand und die Darstellung der
verschiedenen weiblichen Typen und damit Heines Bild von Frauen in seiner frühen Lyrik,
spiegeln sich in seinem Buch der Lieder wieder. Den großen Anklang seines ersten
Lyrikbandes erreichte er einerseits dadurch, daß er sich keusch gab, wie die Gesellschaft es
erwartete. Jedoch viele junge Männer fanden sich in dem nach sinnlicher Erfüllung suchenden
Heine wieder.
In seiner späteren Lyrik, in Neue Gedichte, hat sich Heines Bezug zur Erotik stark
verändert. Heine lebt nun in Paris und wird sich der Diskrepanz zwischen dem spröden,
spiritualistischen Deutschland und dem erotischen, sensualistischen Paris bewußt.
Der Zyklus Verschiedene und im besonderen das Gedicht Der Tannhäuser zeigen Heines
Einstellung zu diesem Antagonismus.
Ein Vergleich von Heines Frauenbildern, auf dem Hintergrund seiner sich verändernden
Lebensumstände und Einstellungen, wird das Thema dieser Hausarbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Der hoffnungslose Eckensteher“
- „Freier Verkehr mit der unfreien Weiblichkeit“
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Heinrich Heines Darstellung der Erotik und des Frauenbildes in seinen "Neuen Gedichten", insbesondere im Kontext des Wandels seiner Lebensumstände und seines Wechsels von Deutschland nach Paris. Dabei wird der Gegensatz zwischen dem spröden, spiritualistischen Deutschland und dem erotischen, sensualistischen Paris beleuchtet.
- Heines Entwicklung als Lyriker im Kontext seiner Zeit
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Normen auf Heines frühe Lyrik
- Der Wandel des Frauenbildes in Heines Werk
- Heines Auseinandersetzung mit Spiritualismus und Sensualismus
- Der Einfluss des Pariser Lebens auf Heines Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen Kontext, in dem Heinrich Heine seine frühen Werke schuf, kennzeichnet die strengen moralischen Normen bezüglich Erotik und die damit verbundene Frustration des jungen Dichters. Sie skizziert Heines Entwicklung und die Veränderung seiner Haltung zur Erotik in seinen späteren Werken, die in Paris entstanden sind, und kündigt den Vergleich von Heines Frauenbildern als zentrales Thema der Arbeit an.
„Der hoffnungslose Eckensteher“: Dieses Kapitel analysiert Heines Situation als junger, unvermögender und jüdischer Mann in der deutschen Gesellschaft der 1820er Jahre, der trotz seines poetischen Talents Schwierigkeiten hatte, in die Kreise des Bürgertums einzudringen. Es untersucht die Motive der unerwiderten Liebe in Heines Gedichten der Zyklen "Die Heimkehr" und "Lyrisches Intermezzo", die durch die stilistische Verbindung von Volksliedtradition und moderner, zersplitterter Psyche gekennzeichnet sind. Die Verwendung von Ironie und Komik als Mittel des Selbstschutzes und der Distanzierung wird hervorgehoben. Die Nähe zum Petrarkismus und das Konzept der Liebesqual als Weg zum Liebesglück werden ebenfalls thematisiert, untermauert durch die Analyse des Gedichts LVI in "Die Heimkehr".
Schlüsselwörter
Heinrich Heine, Neue Gedichte, Spiritualismus, Sensualismus, Frauenbild, Erotik, Lyrik, Deutschland, Paris, Volkslied, Petrarkismus, Ironie, Liebeslyrik, gesellschaftliche Normen, Bürgertum, Judentum.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich Heines "Neuen Gedichten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung von Heinrich Heines Darstellung der Erotik und des Frauenbildes in seinen "Neuen Gedichten". Der Fokus liegt auf dem Wandel seiner Lebensumstände, insbesondere seinem Umzug von Deutschland nach Paris, und dem daraus resultierenden Gegensatz zwischen dem deutschen und dem Pariser Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Heines Entwicklung als Lyriker, den Einfluss gesellschaftlicher Normen auf seine frühe Lyrik, den Wandel seines Frauenbildes, seine Auseinandersetzung mit Spiritualismus und Sensualismus, sowie den Einfluss des Pariser Lebens auf seine Lyrik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu "Der hoffnungslose Eckensteher", ein Kapitel zu "Freier Verkehr mit der unfreien Weiblichkeit" und eine Zusammenfassung. Das Kapitel "Der hoffnungslose Eckensteher" analysiert Heines Situation als junger, jüdischer Mann in Deutschland und seine Lyrik der unerwiderten Liebe, während das Kapitel "Freier Verkehr mit der unfreien Weiblichkeit" (der genaue Inhalt dieses Kapitels ist in der Vorschau nicht detailliert beschrieben) vermutlich weitere Aspekte von Heines Frauenbild und Erotik behandelt.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Die Analyse betrachtet Heines Gedichte im Kontext seiner Biografie und der gesellschaftlichen Normen seiner Zeit. Es werden stilistische Mittel wie Ironie und Komik, die Nähe zum Petrarkismus und das Konzept der Liebesqual untersucht. Der Vergleich zwischen der deutschen und der Pariser Lebensweise und deren Einfluss auf Heines Lyrik bildet einen zentralen Aspekt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heinrich Heine, Neue Gedichte, Spiritualismus, Sensualismus, Frauenbild, Erotik, Lyrik, Deutschland, Paris, Volkslied, Petrarkismus, Ironie, Liebeslyrik, gesellschaftliche Normen, Bürgertum, Judentum.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Heines Entwicklung als Lyriker im Kontext seiner Lebensumstände und gesellschaftlichen Einflüsse nachzuvollziehen und seine Darstellung von Erotik und Frauenbild im Wandel seiner Zeit zu analysieren.
Welche Quellen werden verwendet? (implizit)
Die Arbeit basiert auf den "Neuen Gedichten" Heinrich Heines. Weitere Quellen werden nicht explizit in der Vorschau genannt, aber die Analyse impliziert die Nutzung von biographischen Informationen und literaturwissenschaftlicher Sekundärliteratur.
- Citation du texte
- Johanna Niemann (Auteur), 2000, Heinrich Heine: Neue Gedichte - zwischen Spiritualismus und Sensualismus -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17494