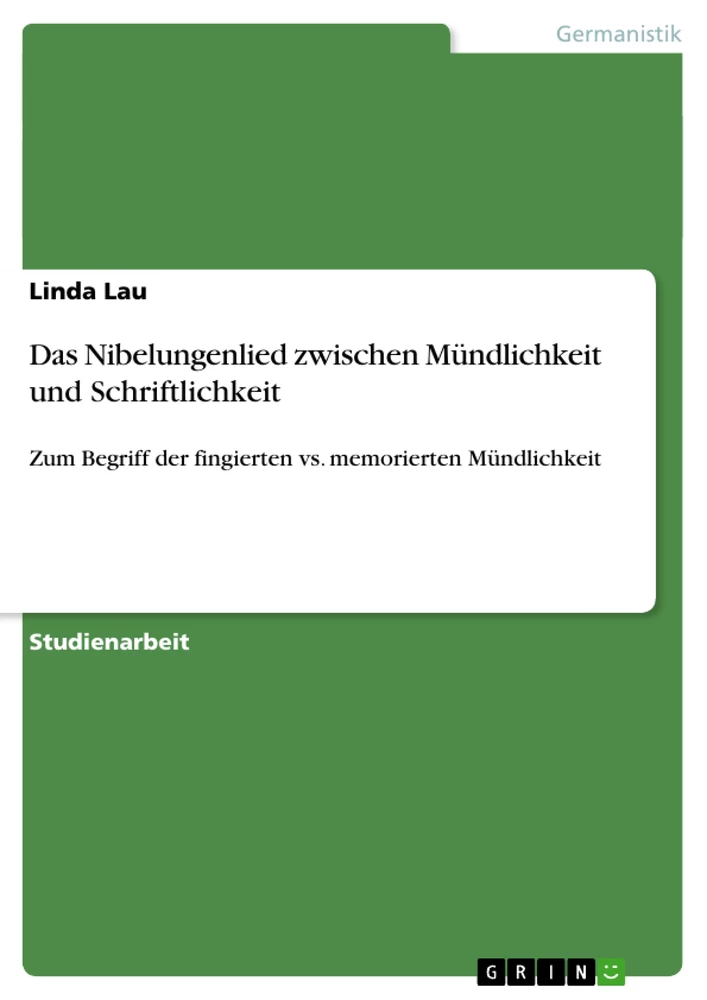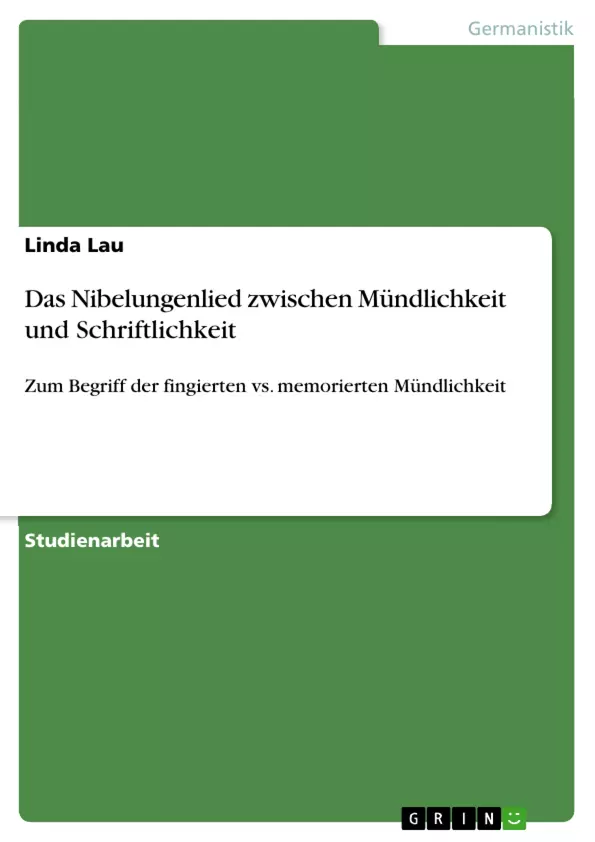Improvisierende, memorierende oder fingierte Mündlichkeit – welchem Erzählstil folgt das heldenepische ‚Nibelungenlied‘? Die verschiedenen Möglichkeiten haben u.a. zwischen Jan-Dirk Müller und Harald Haferland eine angeregte Kontroverse entfacht.
Unbestreitbar ist, dass dem Nibelungenlied sowohl eine mündliche als auch eine schriftliche Tradition zugrunde liegt. Mithilfe mündlicher Weitergabe der Sage und schriftliterarischen Zeugnissen sind letztendlich, neben weiteren fragmentarischen Handschriften, die drei Handschriften *A, *B und *C entstanden. Bezüglich der Handschrift *C stellt sich die Frage, welche Art von Vorlagen der letzte Nibelungenlied-Dichter benutzt hat. Liegt dem Text der Handschrift eine schriftliche Vorlage zugrunde und ist demnach die Einbindung von Mündlichkeit nur vorgetäuscht, sprich fingiert? Oder ist *C vielmehr das Ergebnis einer außerordentlichen Gedächtnisleistung eines Dichters, der den Text auswendig konnte, ihn üblicherweise vor Publikum aus dem Gedächtnis vorgetragen und schließlich einmal niedergeschrieben hat?
Jan-Dirk Müller und Harald Haferland vertreten je zwei unterschiedliche Theorien, die sich mit der eben genannten Fragestellung befassen. Im Folgenden soll nun schwerpunktmäßig der Begriff der „fingierten Mündlichkeit“ am Beispiel des Nibelungenliedes erläutert, abgegrenzt, und anschließend anhand der (Gegen-)Argumente für die „memorierte Mündlichkeit“ kritisch reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Argumentation Jan-Dirk Müllers
- Fingierte Mündlichkeit des Nibelungenliedes
- Zur "Oral-Formulaic Theory"
- Harald Haferlands Gegenthese
- Kritik an improvisierender Mündlichkeit
- Argumente für eine memorierende Mündlichkeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, welchem Erzählstil das Nibelungenlied folgt: Improvisierende, memorierende oder fingierte Mündlichkeit? Dabei stehen die gegensätzlichen Ansichten von Jan-Dirk Müller und Harald Haferland im Mittelpunkt. Die Arbeit erläutert den Begriff der "fingierten Mündlichkeit" am Beispiel des Nibelungenliedes und reflektiert die Argumente für eine "memorierende Mündlichkeit" kritisch.
- Die Rolle der Mündlichkeit im Nibelungenlied
- Der Begriff der "fingierten Mündlichkeit"
- Die "Oral-Formulaic Theory" und ihre Kritik
- Das Konzept der "memorierenden Mündlichkeit"
- Die Frage nach der schriftlichen Vorlage des Nibelungenliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische und literarische Bedeutung des Nibelungenliedes sowie die verschiedenen Theorien zu seiner Entstehung und seinem Erzählstil. Kapitel 2 präsentiert die Argumentation von Jan-Dirk Müller, der eine fingierte Mündlichkeit im Nibelungenlied sieht und die "Oral-Formulaic Theory" als Grundlage für seine These heranzieht. Kapitel 3 beleuchtet die Gegenthese von Harald Haferland, der die "memorierende Mündlichkeit" als zutreffenden Ansatz für die Entstehung des Nibelungenliedes betrachtet und die Kritik an der improvisierenden Mündlichkeit ausführlich darstellt.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, fingierte Mündlichkeit, memorierende Mündlichkeit, Oral-Formulaic Theory, Harald Haferland, Jan-Dirk Müller, Buch-Epos, Heldenepik, Gedächtnisleistung, Stereotypie, Formelhaftigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Nibelungenlied ein mündliches oder ein schriftliches Werk?
Das Nibelungenlied basiert auf beiden Traditionen. Während die Sage über Jahrhunderte mündlich überliefert wurde, sind die uns bekannten Fassungen (A, B, C) hochkomplexe schriftliterarische Zeugnisse.
Was bedeutet der Begriff "fingierte Mündlichkeit"?
Jan-Dirk Müller vertritt die These, dass das Nibelungenlied ein reines Buch-Epos ist, das den Stil mündlichen Erzählens nur simuliert oder "fingiert", um sich in die Tradition der Heldenepik zu stellen.
Was ist die Gegenthese der "memorierten Mündlichkeit"?
Harald Haferland argumentiert, dass der Text das Ergebnis einer außerordentlichen Gedächtnisleistung sein könnte. Ein Dichter könnte den Text auswendig gelernt, vorgetragen und erst später niedergeschrieben haben.
Was besagt die "Oral-Formulaic Theory" im Kontext des Nibelungenliedes?
Diese Theorie geht davon aus, dass mündliche Dichtung auf festen Formeln und Bausteinen beruht. Kritiker untersuchen, ob die formelhafte Sprache des Nibelungenliedes ein Beweis für echte mündliche Komposition oder nur ein Stilmittel ist.
Welche Rolle spielen die Handschriften A, B und C?
Diese drei Haupthandschriften zeigen unterschiedliche Bearbeitungsstufen des Stoffes. Insbesondere bei Handschrift C stellt sich die Frage nach der Art der Vorlagen und der Intention des Dichters.
- Arbeit zitieren
- Linda Lau (Autor:in), 2011, Das Nibelungenlied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174970