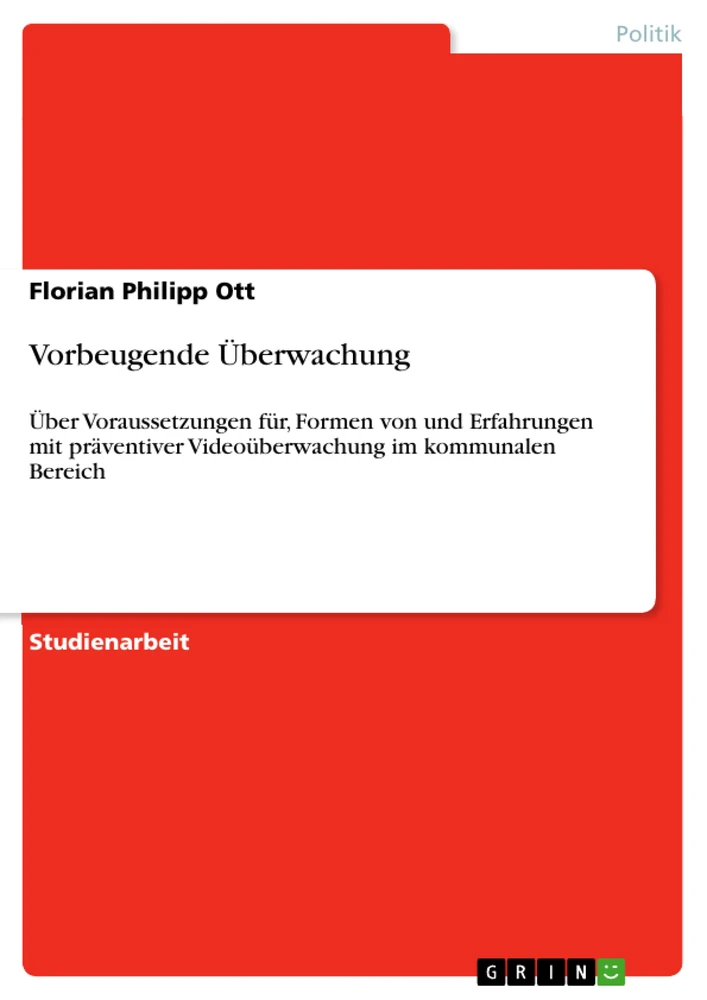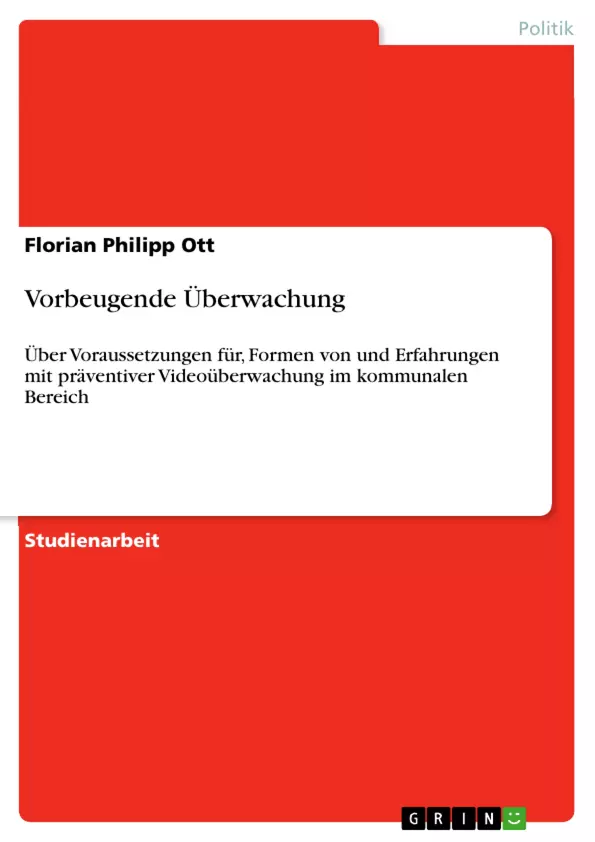Seit 1993 hat die polizeilich registrierte Kriminalität in Deutschland kontinuierlich abgenommen. Erfasste das Bundeskriminalamt damals noch 6,75 Millionen Delikte, so waren es im Jahr 2010 nur noch 5,93 Millionen. Die Aufklärungsquote stieg im gleichen Zeitraum von 43,8 auf nunmehr 56 Prozent. Besonders stark fiel dabei der Rückgang der Straßenkriminalität aus. Zwischen 1993 und 2010 sank die Anzahl der Vorfälle um mehr als 43 Prozent auf insgesamt 1,4 Millionen. Auch die Zahl einfacher und schwerer Diebstähle nahm in dieser Zeit erheblich ab. Schwerwiegend ist hingegen die Zunahme von Gewaltkriminalität, leichter vorsätzlicher sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Alle drei Zahlen steigen seit 1993 stetig an. Gleichzeitig mit der Gewalt stieg auch die Präsenz öffentlicher Videoüberwachung in Deutschland. Zwar gibt es keine genauen Angaben darüber, wie viele Anlagen bundesweit im Einsatz sind, doch schon kurz nach der Inbetriebnahme des ersten Überwachungssystems 1994 kopierten viele Städte den Flensburger Versuch. Oft kommt die Forderung nach stärkerer Überwachung dabei aus Reihen der Politik, die sich von öffentlichkeitswirksamen Überwachungssystemen Wählerstimmen und eine Reduktion von Kriminalität sowie Kriminalitätsfurcht erhofft. Dass dies durch Videoüberwachung tatsächlich erreicht wird, wird dabei meist unkritisch vorausgesetzt. Ob die Systeme jedoch tatsächlich zur Furcht- und Kriminalitätsreduktion beitragen, ob sie also kriminalpräventiv wirken, wird nach ihrer Einführung fast nie systematisch überprüft. Auch auf die Frage, wie die Bevölkerung insgesamt zur immer stärkeren Überwachung steht, gibt es bis heute kaum aussagekräftige Antworten. Hier etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, soll Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein. Sie gliedert sich in einen kriminologisch-rechtlichen und einen empirischen Teil. Ersterer gibt Auskunft über die kriminalwissenschaftliche Einordnung der Videoüberwachung und stellt die Frage, welche juristischen Voraussetzungen für deren Einführung erfüllt sein müssen. Letzterer trägt empirische Ergebnisse bisheriger Publikationen zusammen, die sich mit den Erfolgen, Misserfolgen und Problemen von Videoüberwachung beschäftigen. Dabei stehen insbesondere die Auswirkungen auf Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und öffentliche Meinung im Mittelpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kriminologische und rechtliche Einordnung
- Videoüberwachung aus Sicht kriminologischer Theorie
- Staatliche Videoüberwachung
- Private Videoüberwachung
- Typen von Videoüberwachung
- Empirische Erfahrungen mit Videoüberwachung
- Auswirkungen auf die Kriminalität
- Rauschgiftdelikte
- Eigentumsdelikte
- Gewaltdelikte
- Auswirkungen auf die Kriminalitätsfurcht
- Öffentliche Akzeptanz von Überwachungsmaßnahmen
- Auswirkungen auf die Kriminalität
- Fazit: Ambivalente Bilanz der Überwachung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die präventive Videoüberwachung im kommunalen Bereich. Sie beleuchtet die kriminologischen und rechtlichen Grundlagen sowie die empirischen Erfahrungen mit solchen Überwachungssystemen. Ziel ist es, die Auswirkungen auf Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und die öffentliche Akzeptanz zu analysieren.
- Kriminologische Einordnung der Videoüberwachung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Videoüberwachung
- Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate verschiedener Deliktsarten
- Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung
- Öffentliche Akzeptanz und Meinungsbildung zur Videoüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den Rückgang der Kriminalität in Deutschland seit 1993, insbesondere bei Straßenkriminalität und Diebstählen, aber auch den gleichzeitig steigenden Trend bei Gewaltkriminalität beschreibt. Sie hebt die zunehmende Präsenz öffentlicher Videoüberwachung hervor und hinterfragt deren tatsächliche Effektivität bezüglich Kriminalitäts- und Kriminalitätsfurcht-Reduktion. Die Arbeit selbst wird als kriminologisch-rechtliche und empirische Untersuchung vorgestellt, die die juristischen Voraussetzungen und empirische Ergebnisse bisheriger Publikationen zusammenträgt.
Kriminologische und rechtliche Einordnung: Dieses Kapitel analysiert Videoüberwachung aus kriminologischer Perspektive und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es diskutiert die Doppelfunktion der Videoüberwachung – Prävention und Repression – und ordnet sie in den Kontext der ökonomischen Kriminalitätstheorie ein, welche die Kosten-Nutzen-Kalkulation potentieller Täter betont. Der Unterschied zu älteren Root-Causes-Theorien wird herausgestellt. Das Kapitel beschreibt Videoüberwachung als Interventionsprogramm der spezifischen Kriminalitätsprävention, welches auf sozialer Kontrolle basiert und nicht die tieferen Ursachen von Kriminalität adressiert.
Empirische Erfahrungen mit Videoüberwachung: Dieser Abschnitt fasst empirische Befunde zu den Auswirkungen von Videoüberwachung zusammen. Er untersucht die Effekte auf verschiedene Kriminalitätsarten (Rauschgiftdelikte, Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte), die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung und die öffentliche Akzeptanz von Überwachungsmaßnahmen. Die Zusammenfassung analysiert die Ergebnisse verschiedener Studien und stellt die unterschiedlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen dar, ohne jedoch konkrete Zahlen oder detaillierte Ergebnisse zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Präventive Videoüberwachung, Kriminalität, Kriminalitätsfurcht, öffentliche Akzeptanz, Kriminologie, Recht, empirische Forschung, Kriminalprävention, soziale Kontrolle, ökonomische Kriminalitätstheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Präventive Videoüberwachung im kommunalen Bereich
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die präventive Videoüberwachung im kommunalen Bereich. Sie analysiert die kriminologischen und rechtlichen Grundlagen sowie die empirischen Erfahrungen mit solchen Überwachungssystemen. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen auf Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und die öffentliche Akzeptanz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: kriminologische Einordnung der Videoüberwachung, rechtliche Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate verschiedener Deliktsarten (Rauschgiftdelikte, Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte), Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht, öffentliche Akzeptanz und Meinungsbildung zur Videoüberwachung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen kriminologisch-rechtlichen und empirischen Ansatz. Sie kombiniert die juristischen Voraussetzungen mit den empirischen Ergebnissen bisheriger Publikationen. Konkrete Zahlen oder detaillierte Ergebnisse einzelner Studien werden jedoch nicht präsentiert.
Welche Ergebnisse werden vorgestellt?
Die Arbeit fasst empirische Befunde zu den Auswirkungen von Videoüberwachung zusammen. Sie analysiert die Effekte auf verschiedene Kriminalitätsarten, die Kriminalitätsfurcht und die öffentliche Akzeptanz. Die Zusammenfassung stellt die unterschiedlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen verschiedener Studien dar, ohne jedoch konkrete Zahlen zu liefern.
Wie wird Videoüberwachung kriminologisch und rechtlich eingeordnet?
Die Arbeit analysiert Videoüberwachung aus kriminologischer Sicht und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie diskutiert die Doppelfunktion (Prävention und Repression) und ordnet sie in den Kontext der ökonomischen Kriminalitätstheorie ein. Der Unterschied zu älteren Root-Causes-Theorien wird herausgestellt. Videoüberwachung wird als Interventionsprogramm der spezifischen Kriminalitätsprävention beschrieben, das auf sozialer Kontrolle basiert und nicht die tieferen Ursachen von Kriminalität adressiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht eine ambivalente Bilanz der Videoüberwachung. Die Einleitung hebt den Rückgang der Kriminalität in Deutschland seit 1993, aber auch den steigenden Trend bei Gewaltkriminalität hervor. Die zunehmende Präsenz öffentlicher Videoüberwachung wird im Kontext ihrer tatsächlichen Effektivität bezüglich Kriminalitäts- und Kriminalitätsfurcht-Reduktion hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Präventive Videoüberwachung, Kriminalität, Kriminalitätsfurcht, öffentliche Akzeptanz, Kriminologie, Recht, empirische Forschung, Kriminalprävention, soziale Kontrolle, ökonomische Kriminalitätstheorie.
- Quote paper
- Florian Philipp Ott (Author), 2011, Vorbeugende Überwachung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175045