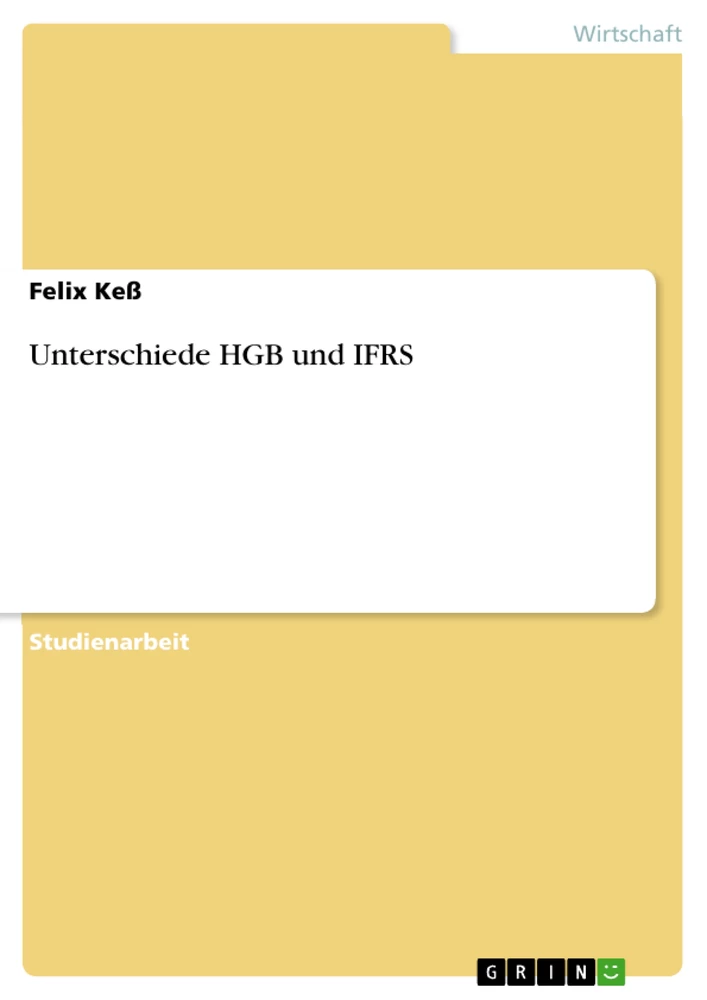Diese Arbeit befasst sich mit den Unterschieden von HGB und IAS/IFRS.
Dabei wird insbesondere auf Anasatz- und Bilanzierungsunterschiede in der Praxis eingegangen, was mit verständlichen Beispielen unterstrichen wird.
Des Weiteren ist ein weiterer Punkt die formalen Unterschiede und der Einsatzbereich dieser unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme.
Table of Contents
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Entstehung und Aufbau
- Wichtige gesetzliche Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- Bilanzpolitik
- Bestandteile des Jahresabschlusses
- Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz
- Reformierung des HGB
- International Accounting Standard/ International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS)
- Herkunft
- IAS/IFRS im Einzel- und Konzernabschluss
- Einzelabschluss
- Konzernabschluss
- Rechnungslegungsziele und Rechnungslegungsgrundsätze
- Bilanzpolitik und Wahlrechte
- Bestandteile des Jahresabschlusses
- Vergleich von HGB und IAS/IFRS
- Immaterielle Vermögensgegenstände (intangible assets)
- Geschäfts- und Firmenwert (Goodwill)
- Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen (property, plant and equipment)
- Finanzanlagen (financial assets)
- Vorräte und Fertigungsaufträge
- Vorräte (inventories)
- Fertigungsaufträge
- Rückstellungen (provisions)
- Latente Steuern (deffered taxes)
- Fremdwährungsumrechnung
- Konzern (group)
- Definition von Konzern
- Konzernabschluss nach HGB
- Konzernabschluss nach IAS/IFRS
- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung, income statement)
- Definition
- GuV nach HGB
- GuV nach IAS/IFRS
- Umstellung vom HGB auf IAS/IFRS anhand eines Beispiels
Objectives and Key Themes
Die Studienarbeit befasst sich mit den Unterschieden zwischen den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). Die Arbeit analysiert die relevanten Vorschriften beider Standards und beleuchtet wichtige Unterschiede in der Bilanzierung und Bewertung von Vermögenswerten, Schulden und Eigenkapital.
- Vergleich der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften von HGB und IAS/IFRS
- Analyse der Unterschiede in der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB und IAS/IFRS
- Untersuchung der Auswirkungen von IAS/IFRS auf die Konzernrechnung
- Darlegung der Herausforderungen bei der Umstellung von HGB auf IAS/IFRS
- Bewertung der Vor- und Nachteile beider Standards
Chapter Summaries
Das erste Kapitel behandelt das Handelsgesetzbuch (HGB) und beschreibt dessen Entstehung, Aufbau, wichtige gesetzliche Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Bestandteile des Jahresabschlusses. Das zweite Kapitel fokussiert auf die International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) und analysiert deren Herkunft, Anwendung im Einzel- und Konzernabschluss sowie die Rechnungslegungsziele und Grundsätze. Das dritte Kapitel vergleicht die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften von HGB und IAS/IFRS für verschiedene Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapitalpositionen. Das vierte Kapitel behandelt die Umstellung von HGB auf IAS/IFRS anhand eines konkreten Beispiels und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen dieses Prozesses.
Keywords
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen Handelsgesetzbuch (HGB), International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), Bilanzierung, Bewertung, Jahresabschluss, Konzernrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung und Umstellung von HGB auf IAS/IFRS. Die Arbeit betrachtet die relevanten Vorschriften beider Standards und analysiert die Unterschiede in der Rechnungslegungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen HGB und IFRS?
Das HGB ist primär vom Gläubigerschutz und dem Vorsichtsprinzip geprägt, während IFRS auf die Information von Investoren (Fair Value, "true and fair view") abzielt.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte unterschiedlich behandelt?
Nach IFRS besteht für selbsterstellte immaterielle Werte oft eine Aktivierungspflicht (unter bestimmten Kriterien), während das HGB hier eher Wahlrechte oder Verbote vorsieht.
Was ändert sich bei der Bewertung von Vorräten?
Das HGB wendet streng das Niederstwertprinzip an. IFRS erlaubt unter bestimmten Umständen bei langfristigen Fertigungsaufträgen die Teilgewinnrealisierung (Percentage of Completion), was das HGB grundsätzlich ablehnt.
Welche Bedeutung haben latente Steuern in beiden Systemen?
In IFRS sind latente Steuern aufgrund der starken Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz wesentlich komplexer und häufiger als im HGB-Abschluss.
Wann muss ein Unternehmen von HGB auf IFRS umstellen?
Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind für ihren Konzernabschluss in der EU zur Anwendung von IFRS verpflichtet. Für den Einzelabschluss bleibt das HGB (insb. für die Gewinnausschüttung) maßgeblich.
- Arbeit zitieren
- Felix Keß (Autor:in), 2010, Unterschiede HGB und IFRS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175252