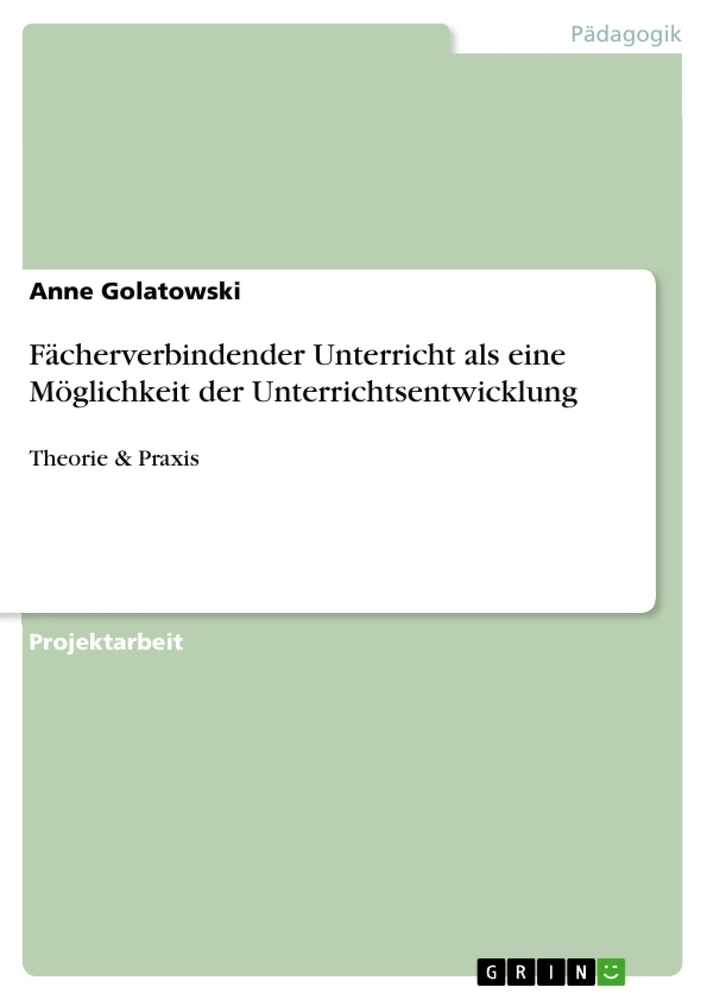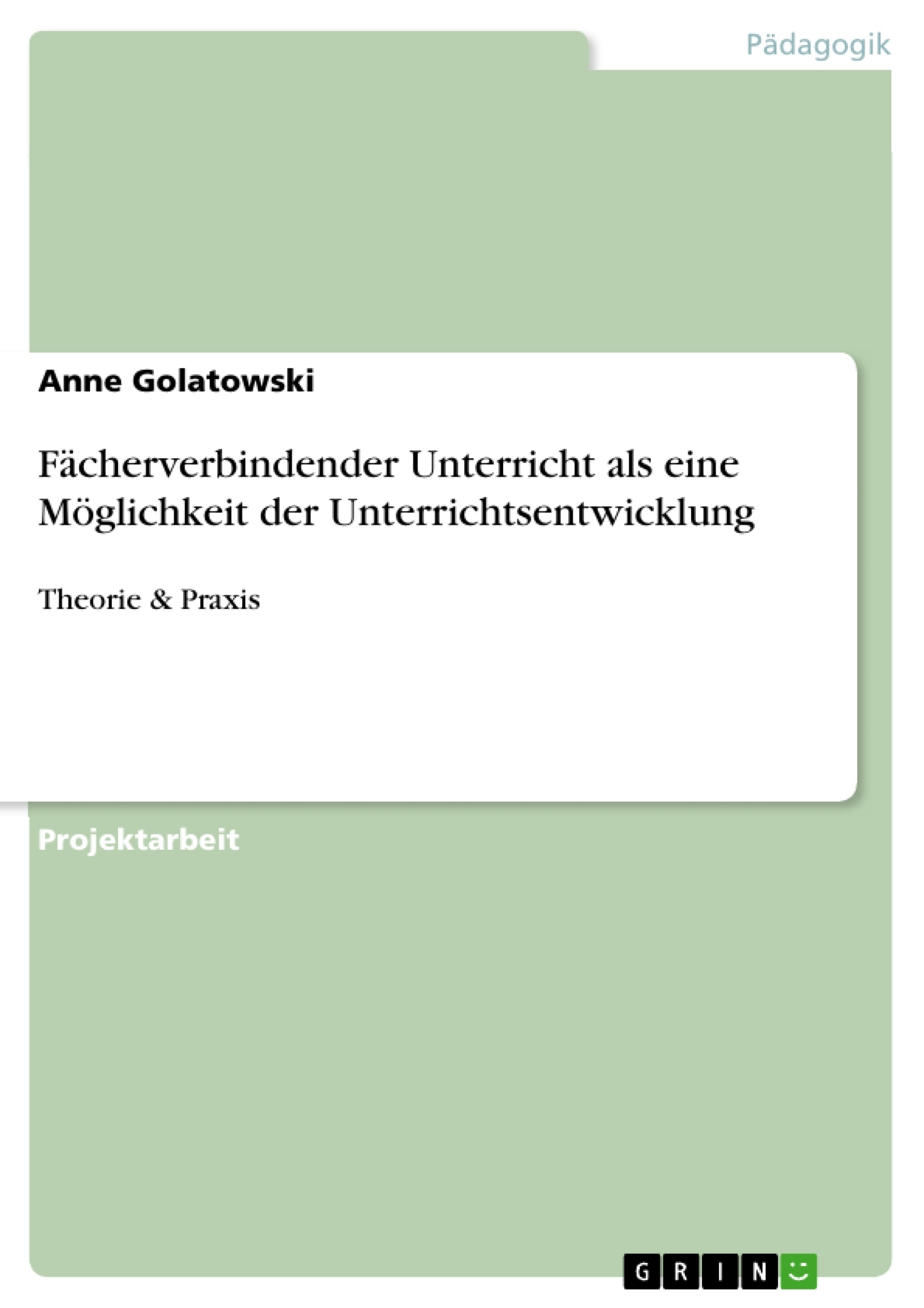Dass sich die Welt rasant entwickelt, ist augenscheinlich, und dass die Menschen versuchen im Berufsleben durch Weiter- und Fortbildungen der Dynamik dieser zu folgen ist absolut erforderlich. Doch verlangt die Wirtschaft auch von der Schule ihren Beitrag zu leisten. Schüler und SchülerInnen müssen schon mit der schulischen Ausbildung auf die Komplexität und Ganzheitlichkeit der Welt vorbereitet werden und nicht mehr nur innerhalb der einzelnen gefächerten Fachdisziplinen gebildet werden. Das stellt ein großes Problem für die Arbeitswelt und somit dem Schüler selbst dar, wenn ihm wichtige Kompetenzen im sozialen oder technologischen Bereich fehlen oder nur gering vorhanden sind. Zurzeit wird auf dem Gebiet der Unterrichts- und Schulentwicklung unermüdlich geforscht und die Notwendigkeit von ganzheitlichem Lernen vermehrt neu bekräftigt. Im Zuge dessen hat unter anderem das Bundesland Sachsen seine Lehrpläne 2004 reformiert, die nun in der Präambel fächerverbindenden Unterricht einfordern. Mit Querverweisen und Themenvorschlägen soll den Lehrkräften die Anwendung erleichtert werden. Die Idee des fächerverbindenden Unterrichts besteht schon seit Jahrzehnten. Doch scheiterte die Theorie immer an der Praxis. Mit dem Pilotprojekt der Seminargruppe sollte den Zweifeln der angehenden LehrerInnen schon im Studium entgegengewirkt werden. Durch die Initiative der Seminarleiterin zusammen mit einer Mittelschule in Leipzig wurde ein Projekt von StudentInnen zum fächerverbindenden Unterricht angegangen. Die TeilnehmerInnen fanden sich in themenspezifischen Gruppen zusammen und entwickelten Konzepte für die neue Unterrichtsform, welche dann auch von ihnen selbst in der Praxis verwirklicht werden konnte. Das Projekt der Gruppe mit dem Thema „Armut“ wird in dieser Arbeit reflektiert. Dabei werden positive Fakten beleuchtet, aber auch Fehler der Gruppe aufgezeigt. Es geht nicht um den einzelnen Fachunterricht und wie dieser verlaufen ist, sondern nur um die Reflexion bezüglich fächerverbindenden Unterrichts. Wie erfolgreich konnte die Theorie umgesetzt werden? Auch die Gründe für die aufgetretenen Probleme werden gesucht und analysiert. Über die Wirksamkeit von fächerverbindendem Unterricht kann, auf der Basis des Projekts, nur eine Vermutung geäußert werden. Die Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte. Der theoretische Teil zeigt, was der fächerverbindende Unterricht leisten kann und welche neuen Aufgaben und Anforderungen auf alle Beteiligten zukommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Fächerverbindender Unterricht als eine Möglichkeit der Unterrichtsentwicklung
- Begriffsklärung und Abgrenzung
- Notwendigkeit des fächerverbindenden Unterrichts
- Ziele des fächerverbindenden Unterrichts
- Eine Ganzheit schaffen: Fachunterricht & Fächerverbindenden Unterricht
- Die neue Rolle der Lehrkraft und damit verbundene Herausforderungen
- Realisierung und Probleme
- Das Konzept fächerverbindenden Unterrichts nach Wilhelm H. Peterßen
- Praxis
- Reflexion des Planungsmodells und seiner Umsetzung nach Peterßen
- Persönliche Abschlussreflexion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit reflektiert ein Projekt zum fächerverbindenden Unterricht mit dem Thema „Armut“. Ziel ist es, die Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts in der Praxis zu analysieren und sowohl positive Aspekte als auch auftretende Probleme zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit der Theorie in die Praxis und sucht nach Gründen für eventuelle Schwierigkeiten.
- Einordnung des fächerverbindenden Unterrichts in den Kontext der Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Analyse der Notwendigkeit und Ziele des fächerverbindenden Unterrichts
- Reflexion der Umsetzung des Konzepts von Peterßen im Projekt „Armut“
- Bewertung der Herausforderungen und Probleme bei der Realisierung fächerverbindenden Unterrichts
- Ausblick auf zukünftige Projekte im Bereich des fächerverbindenden Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den rasanten Wandel der Welt und die Notwendigkeit, Schüler auf die Komplexität der Realität vorzubereiten. Sie führt in das Projekt zum fächerverbindenden Unterricht mit dem Thema „Armut“ ein und benennt die Ziele der Arbeit: Reflexion der Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts und Analyse der dabei auftretenden Probleme. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil.
Schul- und Unterrichtsentwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Bildungssystems und die Bemühungen um Qualitätsverbesserung. Es beschreibt die Entwicklung des Verständnisses von Schul- und Unterrichtsentwicklung, beginnend mit der äußeren Schulentwicklung bis hin zur heutigen Fokussierung auf die Einzelschule als pädagogisches Handlungssystem. Der zunehmende Fokus auf Autonomie der Schulen und die Bedeutung der Evaluation werden hervorgehoben. Das „Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung“ von Holtappelts/Rolff wird erwähnt, welches Personal-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung als miteinander verbundene Komponenten betrachtet.
Fächerverbindender Unterricht als eine Möglichkeit der Unterrichtsentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem fächerverbindenden Unterricht. Es klärt den Begriff und grenzt ihn ab, verdeutlicht die Notwendigkeit dieser Unterrichtsform und definiert die damit verbundenen Ziele. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung, wie die Ziele nur im Zusammenspiel von Fachunterricht und fächerverbindendem Unterricht erreicht werden können. Das Konzept von Wilhelm H. Peterßen wird kurz vorgestellt, da es im Praxisteil für die Reflexion des Projekts herangezogen wird. Die Herausforderungen für die Lehrkraft sowie potentielle Probleme bei der Umsetzung werden diskutiert.
Reflexion des Planungsmodells und seiner Umsetzung nach Peterßen: Dieses Kapitel analysiert die praktische Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts im Projekt „Armut“ anhand des Konzepts von Peterßen. Es untersucht sowohl die positiven Aspekte als auch die auftretenden Schwierigkeiten der Umsetzung und deren Ursachen. Der Fokus liegt auf der Reflexion des fächerverbindenden Unterrichts selbst, nicht auf der detaillierten Beschreibung des einzelnen Fachunterrichts. Die Wirksamkeit des fächerverbindenden Unterrichts kann auf Basis des Projekts nur vermutet werden.
Schlüsselwörter
Fächerverbindender Unterricht, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Ganzheitliches Lernen, Kompetenzentwicklung, Projekt „Armut“, Wilhelm H. Peterßen, Praxisreflexion, Lehrkräfte, Herausforderungen, Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reflexion eines Projekts zum fächerverbindenden Unterricht mit dem Thema „Armut“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ein Projekt zum fächerverbindendem Unterricht mit dem Thema „Armut“. Sie reflektiert die praktische Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts, beleuchtet positive Aspekte und auftretende Probleme und untersucht die Übertragbarkeit der Theorie in die Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einordnung des fächerverbindenden Unterrichts in die Schul- und Unterrichtsentwicklung, die Notwendigkeit und Ziele des fächerverbindenden Unterrichts, die Umsetzung des Konzepts von Peterßen im Projekt „Armut“, die Herausforderungen und Probleme bei der Realisierung fächerverbindenden Unterrichts und gibt einen Ausblick auf zukünftige Projekte.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert. Der theoretische Teil behandelt die Schul- und Unterrichtsentwicklung und den fächerverbindenden Unterricht im Allgemeinen. Der praktische Teil reflektiert die Umsetzung des Projekts „Armut“ und das verwendete Planungsmodell nach Peterßen.
Welches Konzept des fächerverbindenden Unterrichts wird verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept des fächerverbindenden Unterrichts nach Wilhelm H. Peterßen, welches im Praxisteil zur Reflexion des Projekts herangezogen wird.
Welche Aspekte der Umsetzung werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die positiven Aspekte und die auftretenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts im Projekt „Armut“. Der Fokus liegt auf der Reflexion des fächerverbindenden Unterrichts selbst, nicht auf der detaillierten Beschreibung des einzelnen Fachunterrichts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Fächerverbindender Unterricht, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Ganzheitliches Lernen, Kompetenzentwicklung, Projekt „Armut“, Wilhelm H. Peterßen, Praxisreflexion, Lehrkräfte, Herausforderungen, Umsetzung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Umsetzung des fächerverbindenden Unterrichts in der Praxis zu analysieren und sowohl positive Aspekte als auch auftretende Probleme zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit der Theorie in die Praxis und sucht nach Gründen für eventuelle Schwierigkeiten.
Wie wird die Wirksamkeit des fächerverbindenden Unterrichts bewertet?
Die Wirksamkeit des fächerverbindenden Unterrichts kann auf Basis des Projekts nur vermutet werden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Reflexion des Prozesses und der Herausforderungen, nicht auf eine quantifizierbare Erfolgsmessung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, zum fächerverbindenden Unterricht als Möglichkeit der Unterrichtsentwicklung, eine Reflexion des Planungsmodells und seiner Umsetzung nach Peterßen, sowie ein Fazit und einen Ausblick.
- Quote paper
- Anne Golatowski (Author), 2011, Fächerverbindender Unterricht als eine Möglichkeit der Unterrichtsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175343