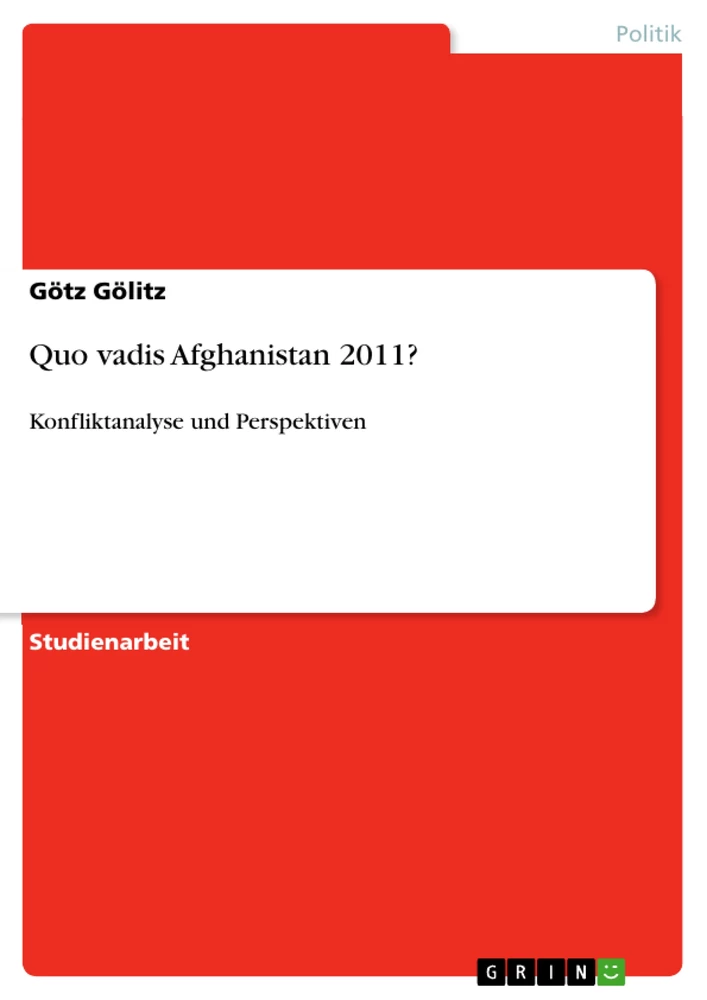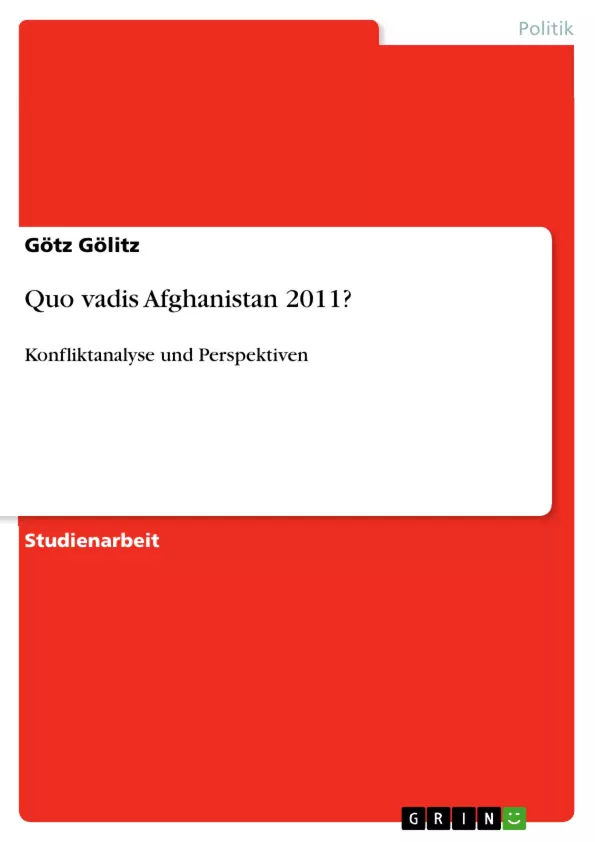Das angestrebte Ziel der Bundesregierung und der Mehrheit des Bundestags bleibt die Entwicklung eines souveränen und stabilen Afghanistans, „das die in seiner Verfassung verankerten Menschenrechte achtet, das sich wirtschaftlich und sozial entwickeln kann und von dessen Boden keine Gefahr für die Region und die Staatengemeinschaft ausgeht“ (Deutscher Bundestag 2011: 4). Mit dieser Zielsetzung hat die Politik die Perspektive für Afghanistan vorgegeben und Deutschland zur langfristigen Unterstützung mit verschiedenen Mitteln (Einsatz der Bundeswehr, zivile Aufbauhilfe etc.) verpflichtet. Doch wie wahrscheinlich ist das Eintreten des politischen Willens?
Mit Blick auf den „Failed State Index“ der letzten Jahre scheint eine gewisse Skepsis angebracht: darin wird das Land seit 2007 kontinuierlich schlechter benotet und liegt nun nach neun Jahren internationalem Engagements auf Platz 6 der Liste der gescheiterten Staaten - knapp hinter Somalia, Tschad, Sudan, Zimbabwe und dem Kongo (vgl. Foreign Policy 2011). Die Entwicklung der Sicherheitslage fördert den Zweifel zusätzlich. Seit 2006 wird eine stetige Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit in ganz Afghanistan (auch im deutschen Verantwortungsbereich) beobachtet, so dass 2010 das blutigste Jahr seit Beginn der Intervention darstellt (vgl. Bundesregierung 2010: 9, Steinberg & Wörmer 2010).
Aufbauend auf der Skepsis gegenüber der „politisch verordneten“ Perspektive möchte die Arbeit klären, welche Perspektiven sich aus einer wissenschaftlichen Konfliktanalyse für Afghanistan ergeben. Im Gegensatz zur politischen Vorgehensweise werden die Zukunftsaussichten nicht im Voraus festgelegt, sondern aus dem komplexen System der aktuellen Konfliktsituation abgeleitet. Dazu wird in Kapitel 2 mit dem Instrumentarium der Friedens- und Konfliktforschung eine fundierte Analyse der Konfliktlage in Afghanistan durchgeführt, wobei einzelne Aspekte des Konflikts systematisch mit Hilfe der einschlägigen Literatur untersucht werden. Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel 3 die Ableitung möglicher Perspektiven für Afghanistan und deren kritischer Reflexion hinsichtlich ihrer Prognosefähigkeit. Das abschließende Resümee bietet Platz für einen Blick in die „Kristallkugel“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konfliktanalyse Afghanistan
- Konfliktgeschichte
- Konfliktparteien
- Hauptakteure
- Nebenakteure
- Konfliktgegenstand
- Konfliktursachen
- Strukturelle Faktoren
- Sozioökonomische Faktoren
- Politische Faktoren
- Kulturelle Faktoren
- Perspektiven für Afghanistan
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Konfliktlage in Afghanistan auf wissenschaftlicher Basis und leitet daraus mögliche Zukunftsperspektiven ab. Im Gegensatz zu politischen Vorgaben werden die Aussichten nicht vorschnell festgelegt, sondern aus der komplexen Konfliktsituation abgeleitet. Der Fokus liegt auf einer systematischen Konfliktanalyse, die auf etablierten Methoden der Friedens- und Konfliktforschung basiert.
- Analyse der Konfliktgeschichte Afghanistans
- Identifizierung der zentralen Konfliktparteien und ihrer Interessen
- Untersuchung der strukturellen, sozioökonomischen, politischen und kulturellen Konfliktursachen
- Ableitung möglicher Zukunftsperspektiven für Afghanistan
- Kritischer Vergleich der wissenschaftlich abgeleiteten Perspektiven mit den politischen Zielsetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung verortet die Arbeit im Kontext der politischen Debatte um das Bundeswehrmandat in Afghanistan und die geplante Truppenreduzierung. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der politisch vorgegebenen Perspektive eines stabilen Afghanistans und der skeptischen Einschätzung der Sicherheitslage hervor, die durch den „Failed State Index“ untermauert wird. Die Arbeit verfolgt das Ziel, wissenschaftlich fundierte Perspektiven für Afghanistan zu entwickeln, losgelöst von politischen Vorgaben und Handlungsempfehlungen.
Konfliktanalyse Afghanistan: Dieses Kapitel bietet eine systematische Analyse des Afghanistankonflikts, basierend auf dem etablierten Analysemuster der Friedens- und Konfliktforschung. Es untersucht die Konfliktgeschichte, die Konfliktparteien (Hauptakteure und Nebenakteure), den Konfliktgegenstand und die Konfliktursachen (strukturelle, sozioökonomische, politische und kulturelle Faktoren). Die Konfliktregelung wird als Zukunftsaufgabe im Folgeabschnitt behandelt. Die Analyse betont die Bedeutung der geschichtlichen Hintergründe, insbesondere die künstliche Staatsgründung und die lange Tradition ausländischer Interventionen.
Perspektiven für Afghanistan: Dieses Kapitel (laut der Textvorschau) wird die aus der Konfliktanalyse abgeleiteten Perspektiven für Afghanistan darstellen und kritisch reflektieren, wobei die Prognosefähigkeit der verschiedenen Szenarien bewertet wird.
Schlüsselwörter
Afghanistan, Konfliktanalyse, Friedens- und Konfliktforschung, Konfliktgeschichte, Konfliktparteien, Konfliktursachen, Strukturelle Faktoren, Sozioökonomische Faktoren, Politische Faktoren, Kulturelle Faktoren, Zukunftsperspektiven, Stabilität, Staatsbildung, Ausländische Interventionen, Failed State.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konfliktanalyse Afghanistan
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den Konflikt in Afghanistan. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Konfliktanalyse, die Konfliktgeschichte, beteiligte Parteien, Konfliktursachen (strukturell, sozioökonomisch, politisch, kulturell), und leitet daraus mögliche Zukunftsperspektiven ab. Der Fokus liegt auf einer objektiven Betrachtung, losgelöst von politischen Vorgaben.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Konfliktgeschichte Afghanistans, Identifizierung der wichtigsten Konfliktparteien und ihrer Interessen, Untersuchung der Konfliktursachen (strukturell, sozioökonomisch, politisch und kulturell), Ableitung möglicher Zukunftsperspektiven und ein kritischer Vergleich dieser Perspektiven mit politischen Zielen. Die künstliche Staatsgründung und ausländische Interventionen werden als wichtige historische Faktoren hervorgehoben.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Konfliktanalyse basiert auf etablierten Methoden der Friedens- und Konfliktforschung. Die Arbeit verfolgt einen systematischen Ansatz, um eine wissenschaftlich fundierte und objektive Analyse zu gewährleisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Konfliktanalyse Afghanistans, ein Kapitel zu Zukunftsperspektiven für Afghanistan und ein Resümee. Die Konfliktanalyse untersucht die Konfliktgeschichte, die Konfliktparteien (Haupt- und Nebenakteure), den Konfliktgegenstand und die Konfliktursachen detailliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Afghanistan, Konfliktanalyse, Friedens- und Konfliktforschung, Konfliktgeschichte, Konfliktparteien, Konfliktursachen, Strukturelle Faktoren, Sozioökonomische Faktoren, Politische Faktoren, Kulturelle Faktoren, Zukunftsperspektiven, Stabilität, Staatsbildung, Ausländische Interventionen, Failed State.
Wie werden die Zukunftsperspektiven für Afghanistan behandelt?
Die Zukunftsperspektiven werden aus der Konfliktanalyse abgeleitet und kritisch bewertet. Die Arbeit untersucht die Prognosefähigkeit verschiedener Szenarien und vermeidet vorschnelle politische Festlegungen.
In welchem Kontext steht diese Arbeit?
Die Arbeit steht im Kontext der politischen Debatte um das Bundeswehrmandat in Afghanistan und die geplante Truppenreduzierung. Sie hebt die Diskrepanz zwischen politischen Vorgaben und der tatsächlichen Sicherheitslage hervor, die durch den „Failed State Index“ veranschaulicht wird.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und ist für die Analyse von Konflikten und die Entwicklung von Zukunftsperspektiven in wissenschaftlicher Weise konzipiert.
- Arbeit zitieren
- Götz Gölitz (Autor:in), 2011, Quo vadis Afghanistan 2011?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175352