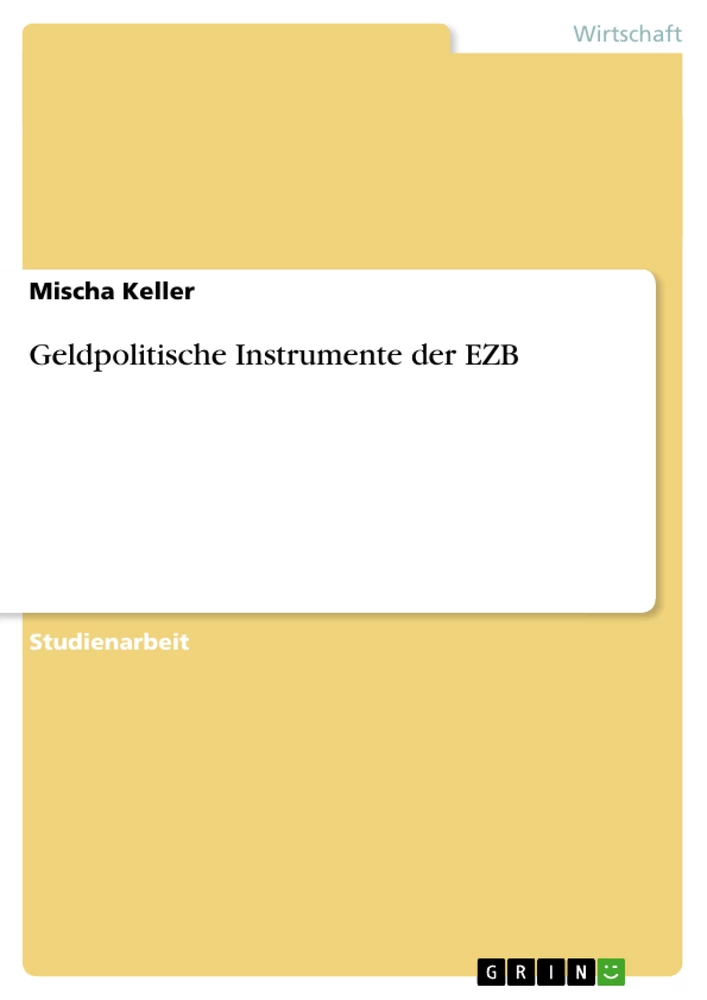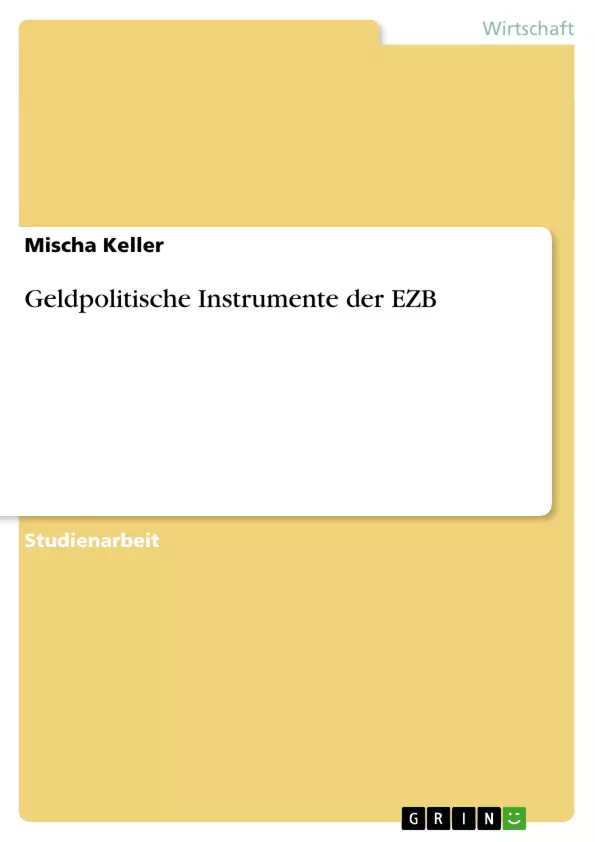Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Sitz in Frankfurt am
Main, wo sie am 1. Juni 1998 gegründet wurde. Sie übernahm am 1.
Januar 1999 im Rahmen der dritten Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) die Verantwortung für die einheitliche
Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet, dem zweitgrößten
Wirtschaftsraum der Welt nach den Vereinigten Staaten von
Amerika.1 Die Verantwortung der Währungs- und Geldpolitik ist somit
von den nationalen Zentralbanken der WWU-Teilnehmerstaaten auf
das Eurosystem übergegangen.2
Der Vertrag über die WWU wurde in deren ersten Stufe von den
führenden Staats- und Regierungschefs der EG-Mitgliedstaaten im
Dezember 1991 in Maastricht verabschiedet und wird deswegen oft
als „Maastricht-Vertrag“ bezeichnet.3
In der zweiten Stufe erfolgte die Gründung des Europäischen
Währungsinstitutes (Januar 1994) und die Entscheidung über die
Teilnehmer der Währungsunion (Frühjahr 1998).4
Die dritte der Stufe der WWU hatte als Kernziele die Fixierung der
Wechselkurse zwischen den alten unterschiedlichen Währungen der
teilnehmenden Staaten und der neuen Gemeinschaftswährung5
(Januar 1999), die Errichtung der EZB (Januar 1999) und die
Einführung der Gemeinschaftswährung Euro (Januar 2002).6
Die Gründung der supranationalen Institution EZB gilt als Höhepunkt
jahrelanger Bemühungen zur Schaffung einer dauerhaften
Währungsstabilität in Europa und als wichtiger Meilenstein der
wirtschaftlichen und politischen Integration zwischen europäischen
Ländern.7
Im Rahmen dieser Seminararbeit erfolgt zunächst ein kurzer
Überblick über das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)
und die Funktionen, Ziele und Strategien der EZB bzw. des
Eurosystems. Danach werden die Instrumente zur Durchführung der
Geldpolitik der EZB dargestellt, wobei hier der Schwerpunkt auf den
Offenmarktgeschäften, dem wichtigsten Instrumentarium des
Eurosystems, liegt. Abschließend wird die aktuelle Geldpolitik der
EZB aufgezeigt.
1 vgl. EZB (2001), S. 7 u. 9
2 vgl. Issing, O. (1999), S. 102
3 vgl. Schnelting, G. (1998), S. 26
4 vgl. Schnelting, G. (1998), S. 31
5 Anm.: z.B. Deutschland: 1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark
6 vgl. Schnelting, G. (1998), S. 31
7 vgl. EZB (2001), S. 9
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Aufbau und Organe des ESZB
- 2.1 Das Europäische System der Zentralbanken
- 2.2 Die Beschlussorgane der EZB
- 3 Ziele und Strategien der EZB
- 3.1 Geldpolitische Ziele der EZB
- 3.2 Die Zwei-Säulen-Strategie
- 4 Steuerungsinstrumente der EZB
- 4.1 Offenmarktgeschäfte
- 4.1.1 Grundlagen
- 4.1.2 Tenderverfahren
- 4.1.3 Arten von Offenmarktgeschäften
- 4.1.3.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte
- 4.1.3.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
- 4.1.3.3 Feinsteuerungsoperationen
- 4.1.3.4 Strukturelle Operationen
- 4.2 Ständige Fazilitäten
- 4.2.1 Grundlagen
- 4.2.2 Spitzenrefinanzierungsfazilität
- 4.2.3 Einlagefazilität
- 4.3 Mindestreserven
- 4.3.1 Funktionen der Mindestreserven
- 4.3.2 Festlegung und Haltung von Mindestreserven
- 4.1 Offenmarktgeschäfte
- 5 Die aktuelle Geldpolitik der EZB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den geldpolitischen Instrumenten der Europäischen Zentralbank (EZB). Ziel ist es, den Aufbau und die Funktionsweise des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) zu erläutern und die wichtigsten geldpolitischen Strategien und Instrumente der EZB zu beschreiben. Die Arbeit analysiert dabei die Ziele der EZB und deren Umsetzung durch verschiedene Maßnahmen.
- Aufbau und Organisation des ESZB
- Geldpolitische Ziele der EZB
- Die Zwei-Säulen-Strategie der EZB
- Offenmarktgeschäfte als zentrales Steuerungsinstrument
- Ständige Fazilitäten und Mindestreserven
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der geldpolitischen Instrumente der EZB. Es liefert einen kurzen Überblick über die Bedeutung der EZB für die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Aufbau und Organe des ESZB: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und die wichtigsten Beschlussorgane der EZB. Es beleuchtet die hierarchische Struktur und die Aufgabenverteilung zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken.
3 Ziele und Strategien der EZB: In diesem Kapitel werden die geldpolitischen Ziele der EZB, insbesondere die Preisstabilität, erläutert. Es wird die Zwei-Säulen-Strategie der EZB detailliert beschrieben, welche aus der geldmengenregulierenden und der ökonomischen Analyse besteht, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Die Bedeutung der Preisstabilität für die gesamte Wirtschaft wird hervorgehoben und mit konkreten Beispielen illustriert.
4 Steuerungsinstrumente der EZB: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und beschreibt die verschiedenen geldpolitischen Instrumente, mit denen die EZB ihre Ziele verfolgt. Es werden Offenmarktgeschäfte (Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen, strukturelle Operationen), ständige Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität) sowie Mindestreserven detailliert erklärt. Die Funktionsweise und die Auswirkungen der jeweiligen Instrumente auf die Geldmenge und die Zinsen werden analysiert und durch Beispiele veranschaulicht. Der Unterschied zwischen den einzelnen Arten von Offenmarktgeschäften wird besonders hervorgehoben, ebenso wie die Bedeutung der ständigen Fazilitäten zur Steuerung der Liquidität im Bankensystem.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Geldpolitik, Preisstabilität, Zwei-Säulen-Strategie, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Mindestreserven, Zinspolitik, Liquidität, Wirtschafts- und Währungsunion (WWU).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Geldpolitische Instrumente der EZB
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Funktionsweise des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) sowie der Erläuterung der wichtigsten geldpolitischen Strategien und Instrumente der EZB.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Hauptthemen: den Aufbau und die Organisation des ESZB, die geldpolitischen Ziele der EZB (insbesondere die Preisstabilität), die Zwei-Säulen-Strategie der EZB, Offenmarktgeschäfte als zentrales Steuerungsinstrument, ständige Fazilitäten und Mindestreserven. Die einzelnen Kapitel gehen detailliert auf diese Themen ein und erläutern die Funktionsweise der jeweiligen Instrumente.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung. Es folgt eine Beschreibung des Aufbaus und der Organe des ESZB. Ein weiterer Abschnitt behandelt die Ziele und Strategien der EZB, insbesondere die Zwei-Säulen-Strategie. Der Kern des Dokuments liegt im Kapitel über die Steuerungsinstrumente der EZB, welches Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserven detailliert beschreibt. Abschließend gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten geldpolitischen Instrumente der EZB, die im Dokument beschrieben werden?
Die wichtigsten geldpolitischen Instrumente der EZB, die im Dokument ausführlich erläutert werden, sind: Offenmarktgeschäfte (Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen), ständige Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität) sowie Mindestreserven. Das Dokument beschreibt die Funktionsweise und die Auswirkungen dieser Instrumente auf die Geldmenge und die Zinsen.
Was ist die Zwei-Säulen-Strategie der EZB?
Die Zwei-Säulen-Strategie der EZB ist ein geldpolitisches Konzept, das aus zwei Säulen besteht: der geldmengenregulierenden Analyse und der ökonomischen Analyse. Beide Säulen dienen dazu, die Preisstabilität zu gewährleisten, das wichtigste geldpolitische Ziel der EZB. Das Dokument beschreibt detailliert, wie diese beiden Säulen zusammenarbeiten, um die Preisstabilität zu erreichen.
Welche Rolle spielen Offenmarktgeschäfte in der Geldpolitik der EZB?
Offenmarktgeschäfte sind ein zentrales Steuerungsinstrument der EZB. Das Dokument beschreibt verschiedene Arten von Offenmarktgeschäften (Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen) und erklärt deren Funktionsweise und Auswirkungen auf die Geldmenge und die Zinsen im Detail.
Welche Bedeutung haben ständige Fazilitäten und Mindestreserven?
Ständige Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität) und Mindestreserven sind weitere wichtige Instrumente der EZB zur Steuerung der Liquidität im Bankensystem und zur Einflussnahme auf die Zinsen. Das Dokument erklärt deren Funktionen und wie sie die Geldpolitik der EZB unterstützen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist für alle relevant, die sich mit der Geldpolitik der EZB und dem Funktionieren des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) auseinandersetzen möchten. Es eignet sich insbesondere für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanzfachleute und alle, die ein tieferes Verständnis der geldpolitischen Instrumente und Strategien der EZB benötigen.
- Arbeit zitieren
- Mischa Keller (Autor:in), 2003, Geldpolitische Instrumente der EZB, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17546