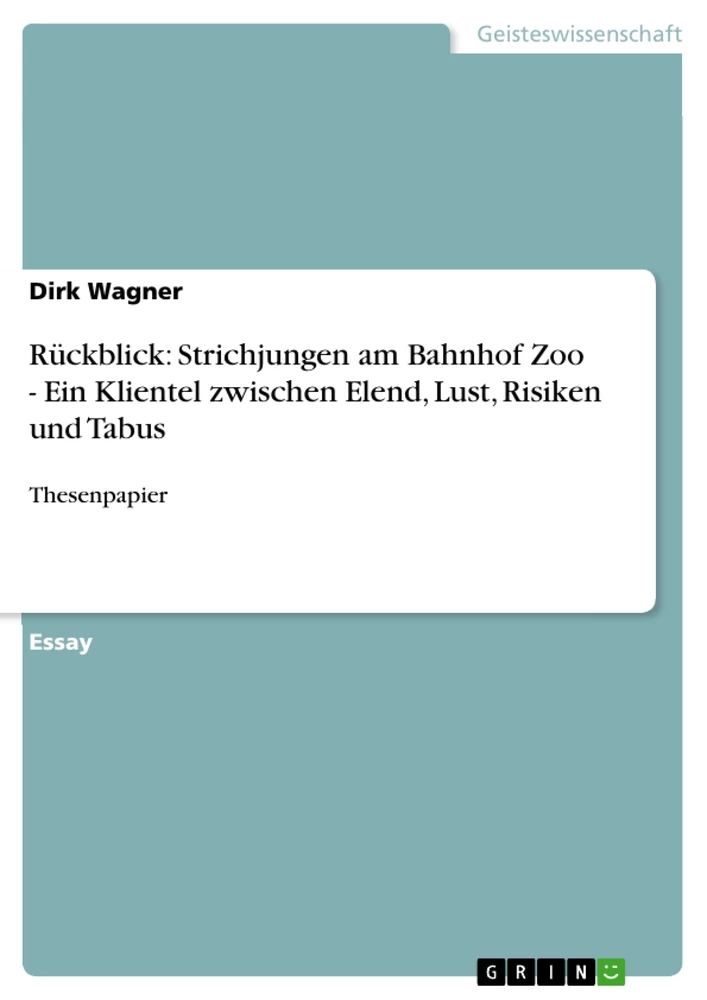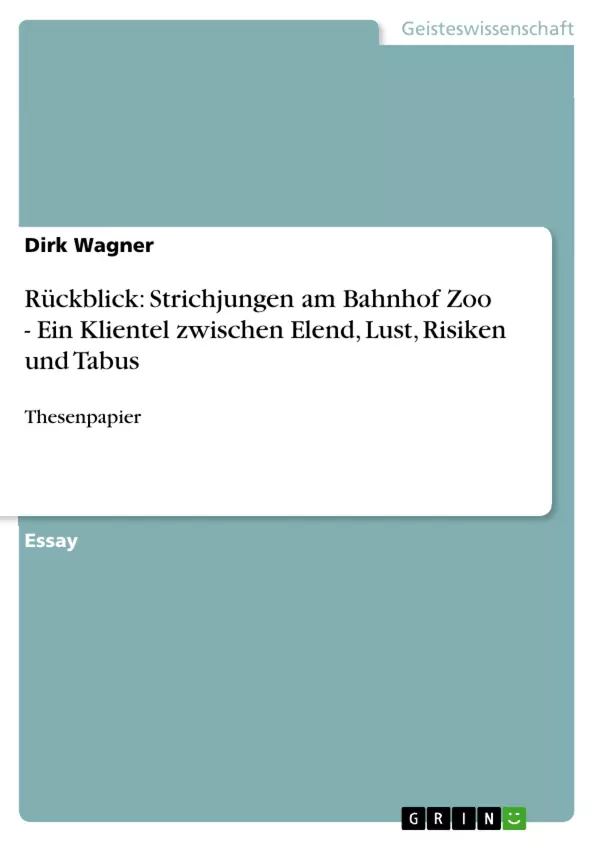In 2011 sind es 30 Jahre her, dass der Film "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in den Kinos anlief. Strichjungen am Bahnhof Zoo - ein seinerzeit sehr brisantes, oft diskutiertes und gleichzeitig mit Tabus behaftetes Thema. Das vorliegende und aktualisierte Diskussionspapier beschäftigt sich rückblickend mit der psycho-sozialen Situation und den inneren Motiven eines Stricherlebens und zeigt gleichzeitig Unterstützungsmöglichkeiten auf. Das Thesenpapier wurde um eine aktuelle Einleitung ergänzt, in der die Entwicklung der Stricherszene am Berliner Bahnhof Zoo von der Vergangenheit bis zur Gegenwart besprochen wird bzw. der Frage nachgegangen wird, aus welchen Gründen die Strichjungen heute dort weitestgehend verschwunden ist. Die vorliegende Ausarbeitung ist als kleine Spurensuche zu verstehen, um die Entwicklung der Stricherszene am Bahnhof Zoo besser verstehen und nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur überarbeiteten Fassung
- Aktuelle Einleitung: Zur Entwicklung der Stricherszene am Bahnhof Zoo
- Thesenübersicht
- These 1
- These 2
- These 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses überarbeitete Diskussionspapier von Dirk Wagner aus dem Jahr 2011 befasst sich rückblickend mit der Stricherszene am Bahnhof Zoo in Berlin in den 1970er und 80er Jahren. Es analysiert die sozioökonomischen und psychosozialen Faktoren, die zu dieser Situation führten, und beleuchtet die damaligen Strategien der Sozialarbeit im Umgang mit diesem Thema.
- Die sozioökonomischen Bedingungen der Jugendlichen am Bahnhof Zoo
- Die Rolle von Drogenabhängigkeit in der Prostitution
- Die gesellschaftlichen Reaktionen und Debatten um die Prostitution von Jugendlichen
- Die Arbeit der Sozialarbeit in diesem Kontext
- Der Wandel der Stricherszene am Bahnhof Zoo im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort zur überarbeiteten Fassung: Dieses Vorwort erläutert die Gründe für die Überarbeitung des 1994 verfassten Thesenpapiers. Es beschreibt den Kontext des ursprünglichen Textes, der aus einem sechsmonatigen Praktikum im „Drogen- und Stricherbus“ am Bahnhof Zoo resultierte. Die Überarbeitung beinhaltet redaktionelle Änderungen zur Verbesserung der Lesbarkeit, Ergänzungen zur Aktualisierung und Anpassung an die neue Rechtschreibung. Die Aktualisierung beinhaltet ein erweitertes Vorwort und eine aktuelle Einleitung, die den Wandel der Stricherszene thematisiert und die Bedeutung des Buches und Films "Christiane F." hervorhebt.
Aktuelle Einleitung: Zur Entwicklung der Stricherszene am Bahnhof Zoo: Die Einleitung untersucht die Entwicklung der Stricherszene am Bahnhof Zoo von den 1970er bis zu den 2010er Jahren. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen Debatten um Prostitution, insbesondere die Prostitution von Minderjährigen, und die verschiedenen Strategien, die von Repression bis zur Unterstützung der Jugendlichen reichten. Die Einleitung betont die kulturelle Bedeutung des Bahnhofs Zoo, insbesondere im Kontext des Buches und Films "Christiane F.", das die Geschichte der Drogenabhängigkeit und Prostitution von Jugendlichen in den 1970er Jahren dokumentiert und die Wahrnehmung des Bahnhofs Zoo nachhaltig beeinflusst hat. Die Einleitung unterstreicht auch den Einfluss von Faktoren wie der Drogenepidemie und den sozioökonomischen Bedingungen in West-Berlin auf die Stricherszene.
Schlüsselwörter
Bahnhof Zoo, Stricherszene, Jugendprostitution, Drogenabhängigkeit, Heroin, Sozialarbeit, Christiane F., West-Berlin, sozioökonomische Bedingungen, gesellschaftliche Debatten, Entkriminalisierung, Repression.
Häufig gestellte Fragen zu "Diskussionspapier zur Stricherszene am Bahnhof Zoo"
Was ist der Inhalt des Diskussionspapiers?
Das Diskussionspapier von Dirk Wagner (überarbeitete Fassung 2011) analysiert rückblickend die Stricherszene am Bahnhof Zoo in Berlin während der 1970er und 80er Jahre. Es untersucht die sozioökonomischen und psychosozialen Ursachen, beleuchtet die Strategien der Sozialarbeit und betrachtet den Wandel der Szene im Laufe der Zeit. Es beinhaltet ein Vorwort zur überarbeiteten Fassung, eine aktuelle Einleitung, die sich mit der Entwicklung der Stricherszene bis in die 2010er Jahre auseinandersetzt, eine Theseübersicht und Kapitelzusammenfassungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die sozioökonomischen Bedingungen der Jugendlichen, die Rolle der Drogenabhängigkeit in der Prostitution, die gesellschaftlichen Reaktionen und Debatten, die Arbeit der Sozialarbeit und der Wandel der Stricherszene. Besonderes Augenmerk liegt auf der kulturellen Bedeutung des Bahnhofs Zoo im Kontext von "Christiane F." und dem Einfluss von Faktoren wie der Drogenepidemie und den sozioökonomischen Bedingungen in West-Berlin.
Was wird in der Einleitung und im Vorwort erläutert?
Das Vorwort erklärt die Gründe für die Überarbeitung des 1994 verfassten Thesenpapiers, den Kontext des ursprünglichen Textes (sechsmonatiges Praktikum im „Drogen- und Stricherbus“) und die vorgenommenen Änderungen (redaktionelle Verbesserungen, Aktualisierungen, Anpassung an die neue Rechtschreibung). Die aktuelle Einleitung untersucht die Entwicklung der Stricherscene von den 1970er bis zu den 2010er Jahren, die gesellschaftlichen Debatten und Strategien im Umgang mit der Jugendprostitution, sowie den Einfluss von "Christiane F." auf die Wahrnehmung des Bahnhofs Zoo.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Diskussionspapier?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Bahnhof Zoo, Stricherszene, Jugendprostitution, Drogenabhängigkeit, Heroin, Sozialarbeit, Christiane F., West-Berlin, sozioökonomische Bedingungen, gesellschaftliche Debatten, Entkriminalisierung, Repression.
Gibt es eine Kapitelzusammenfassung?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung der Kapitel, einschließlich des Vorworts und der aktuellen Einleitung. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den jeweiligen Inhalt und die behandelten Aspekte.
Für wen ist dieses Diskussionspapier gedacht?
Das Diskussionspapier richtet sich an Personen, die sich akademisch mit der Thematik der Jugendprostitution, Drogenabhängigkeit und den sozioökonomischen Bedingungen in West-Berlin auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und alle Interessierten, die sich einen detaillierten Überblick über die Stricherszene am Bahnhof Zoo verschaffen wollen.
Welche These(n) werden im Diskussionspapier aufgestellt?
Das Dokument enthält eine Theseübersicht mit mehreren Thesen, die im Detail im Hauptteil des Diskussionspapiers erläutert werden. Der genaue Inhalt der Thesen wird in der Übersicht im Dokument selbst beschrieben.
- Quote paper
- Diplom II - Sozialpädagoge Dirk Wagner (Author), 2011, Rückblick: Strichjungen am Bahnhof Zoo - Ein Klientel zwischen Elend, Lust, Risiken und Tabus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175512