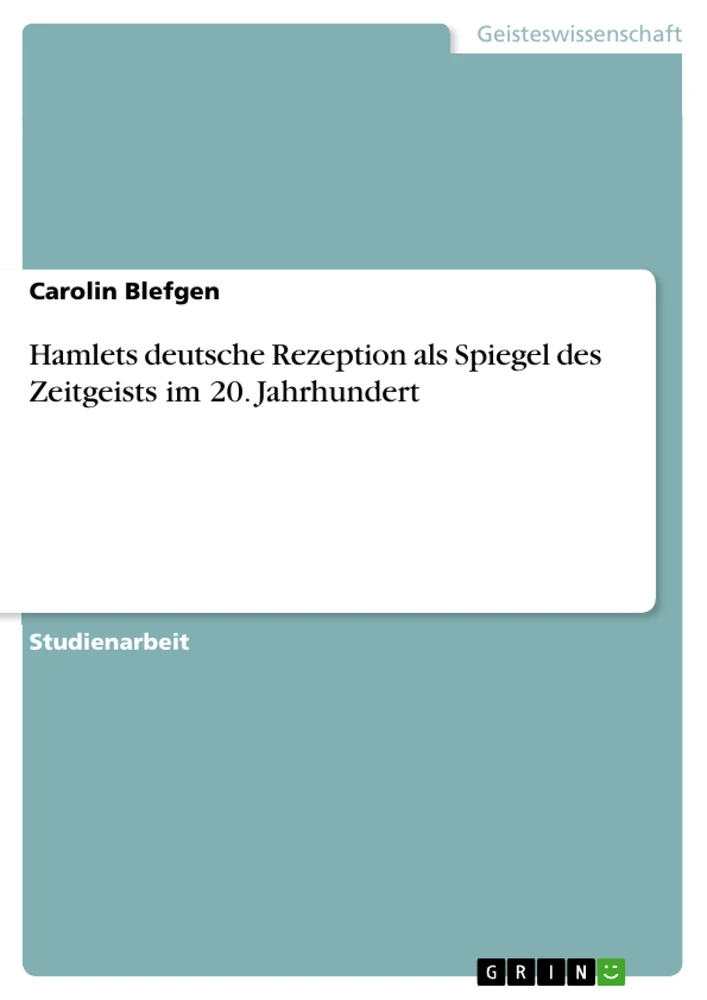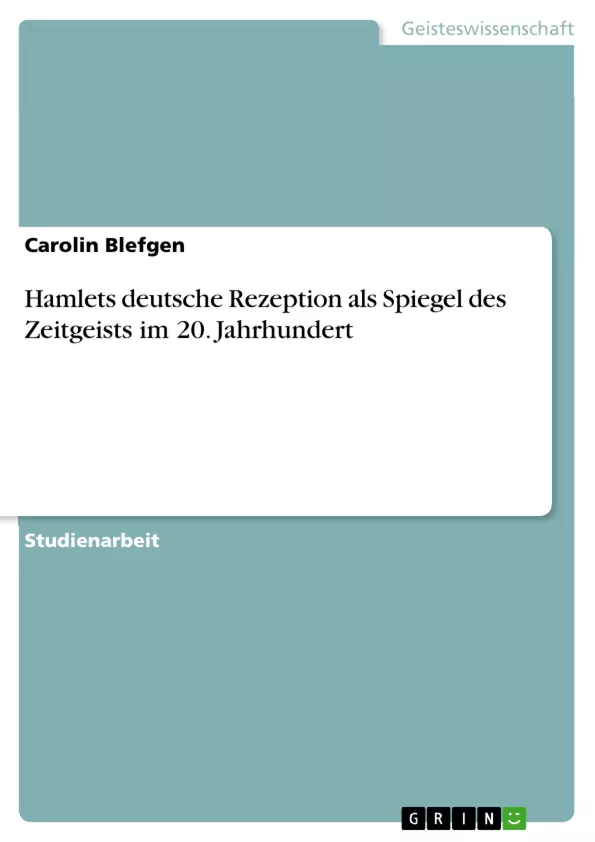Seit der ersten Inszenierung des Hamlet fasziniert Shakespeares Klassiker die verschiedensten Gemüter der nachfolgenden Epochen auf der ganzen Welt bis heute. Daher ergibt sich ein ungemein weites Feld der Shakespeare Rezeption, welches vollständig wohl kaum in das Ausmaß einer kurzen wissenschaftlichen Arbeit zu fassen sein kann – ja selbst mehrbändige lexikale Reihen fokussieren sich nur auf einige wenige Spezifika. So wird im Folgenden ein kleiner Teil der deutschen Rezeptionsgeschichte auf der Bühne betrachtet.
Hierbei ergeben sich bereits die ersten Schwierigkeiten, eine deutsche Rezeptionsgeschichte zu beschreiben, ändert sich die Definition von Deutschem und den dazugehörigen staatlichen Territorien seit scheinbar ewiger Zeit ständig. Die weiteren Untersuchungen beschäftigen sich mit dem Hamlet des 20. Jahrhunderts und beleuchten so verschiedene Inszenierungen der Weimarer Republik, des dritten Reiches, der Nachkriegszeit und zuletzt - als Ausblick - eines (wiedervereinten) Deutschlands im 21. Jahrhunderts.
Vorher sei aber ein kurzer Überblick der „deutschen“ Rezeptionsgeschichte Shakespeares und seines Hamlet bis in das letzte Jahrhundert zu geben. Im deutschen Sprachraum erlangt Shakespeares Werk nach gelegentlichen Erwähnungen im 17. Jahrhundert im darauffolgenden Centennium erstmals größere Beachtung. Auch wenn es noch keine deutschen Übersetzungen gibt, beschäftige sich eine breitere Leserschaft mit den Dramentexten. Lessing stellt als Teil einer Gegenbewegung zum französischen Klassizismus Shakespeares Genialität in den Vordergrund, ihm folgen die berühmten Lobpreisungen von Goethe: „Natur! Natur! nichts so Natur als Shakespeares Menschen!” Ebenfalls gegen die französischen Klassizisten wenden sich die Romantiker, die besonders das Wunderbare in Shakespeares Dramen schätzen. Mittlerweile liegen gleich mehrere berühmte Übertragungen in die deutsche Sprache vor, die bis heute meist gerühmte ist die von Friedrich Schlegel. Mit der Gründung der deutschen Shakespeare Gesellschaft im 19. Jahrhundert wird deutlich, dass der Brite sich zum deutschen Kulturgut entwickelt: Shakespeare wird als dritter deutscher Klassiker neben Goethe und Schiller bezeichnet.
Im 18. Jahrhundert wird besonders Hamlet weiten Gesellschaftskreisen als geistiger Besitz vertraut. Es gibt einerseits genaue Übertragungen auf die deutschen Bühnen, es werden aber auch viele neue Freiräume genutzt; es komme zu „anregende[n] als auch politisch kontroverse[n]“ Inszenierungen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Hamlet und der deutsche Zeitgeist – Eine Rezeptionsgeschichte
- 2. Hamlets Rezeption im Theater des 20. Jahrhunderts
- 2.1 Hamlet inszeniert durch Leopold Jessner - Politisierung des Hamlet in der Weimarer Republik
- 2.2 Hamlet mit Gustaf Gründgens – Hamlet als Propagandainstrument des Nationalsozialismus
- 2.3 Hamlet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Suche nach neuen Wegen
- 3. Ergänzung: Der Hamlet der Gegenwart als universales Medium
- 3.1 Hamlet inszeniert durch Thomas Ostermeier
- 4. Fazit – Ständige Aktualität eines Klassikers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Rezeption von Shakespeares Hamlet im 20. Jahrhundert. Sie analysiert, wie verschiedene Inszenierungen des Stücks den jeweiligen Zeitgeist widerspiegelten und die Rolle von Hamlet im deutschen Kulturkontext veränderten.
- Die Politisierung von Hamlet in verschiedenen historischen Kontexten.
- Die Adaption von Hamlet als Propagandainstrument.
- Die Suche nach neuen Interpretationen und Inszenierungskonzepten im Laufe des 20. Jahrhunderts.
- Die Bedeutung von Hamlet als Spiegel des Zeitgeists.
- Die Aktualität von Hamlet in der Gegenwart.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erörtert die Faszination von Shakespeares Hamlet und die Komplexität seiner Rezeption. Sie gibt einen kurzen Überblick über die deutsche Rezeptionsgeschichte des Stücks bis ins 20. Jahrhundert.
Kapitel 2 betrachtet die Rezeption von Hamlet im Theater des 20. Jahrhunderts. Es untersucht, wie verschiedene Inszenierungen, von der Weimarer Republik bis zur Nachkriegszeit, den Zeitgeist widerspiegelten. Besonderes Augenmerk wird auf die Inszenierung von Leopold Jessner in der Weimarer Republik gelegt, die eine skandalträchtige, politisierte Interpretation des Stücks präsentierte.
Kapitel 3 untersucht die Rezeption von Hamlet in der Gegenwart und analysiert die Inszenierung von Thomas Ostermeier als Beispiel für eine zeitgenössische Interpretation des Stücks.
Schlüsselwörter
Hamlet, Shakespeare, Rezeption, Zeitgeist, Theater, Inszenierung, Politisierung, Propaganda, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Gegenwart, Dramaturgie, Interpretation, Aktualität.
Häufig gestellte Fragen
Wie spiegelt Hamlet den Zeitgeist des 20. Jahrhunderts wider?
Verschiedene Inszenierungen nutzten Hamlet als politisches Instrument, um gesellschaftliche Krisen der Weimarer Republik oder des Nationalsozialismus zu thematisieren.
Welche Bedeutung hatte Leopold Jessners Hamlet-Inszenierung?
Jessner politisierte Hamlet in der Weimarer Republik und schuf eine skandalträchtige Interpretation, die den damaligen gesellschaftlichen Umbruch widerspiegelte.
Wurde Hamlet als Propagandainstrument im Dritten Reich genutzt?
Ja, die Arbeit analysiert unter anderem die Rolle von Gustaf Gründgens und wie Shakespeare in die Ideologie des Nationalsozialismus eingegliedert wurde.
Wann wurde Shakespeare zum „dritten deutschen Klassiker“?
Im 19. Jahrhundert wurde Shakespeare neben Goethe und Schiller als fester Bestandteil des deutschen Kulturguts etabliert.
Wie wird Hamlet in der Gegenwart inszeniert?
Die Arbeit gibt einen Ausblick auf moderne Deutungen, wie etwa die Inszenierung von Thomas Ostermeier, die Hamlet als universales Medium betrachtet.
- Quote paper
- Student Carolin Blefgen (Author), 2011, Hamlets deutsche Rezeption als Spiegel des Zeitgeists im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175559