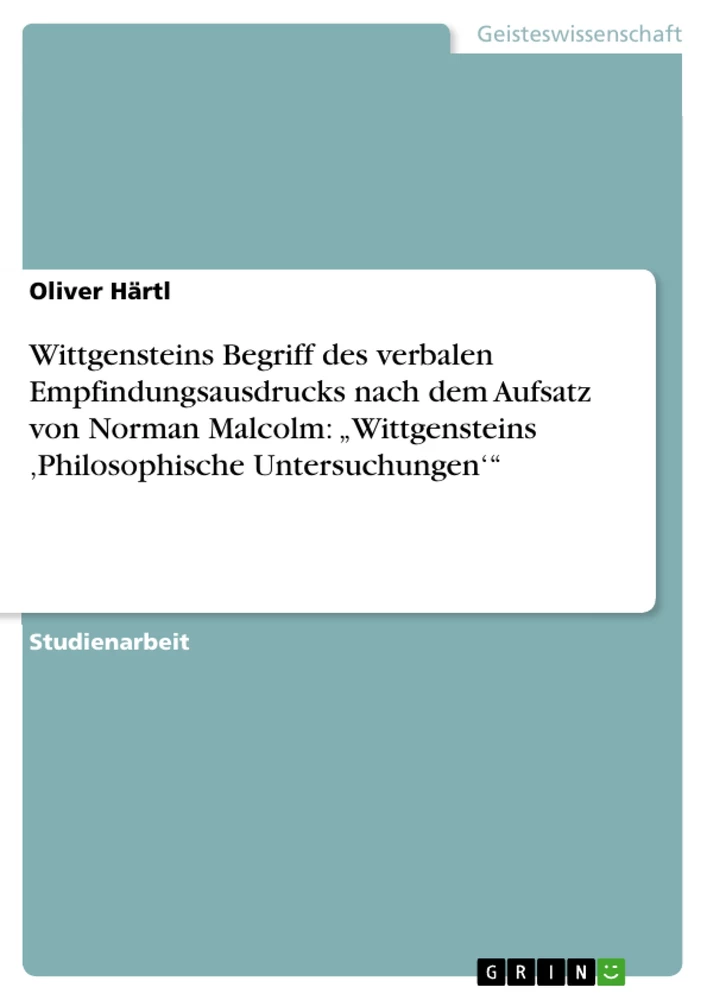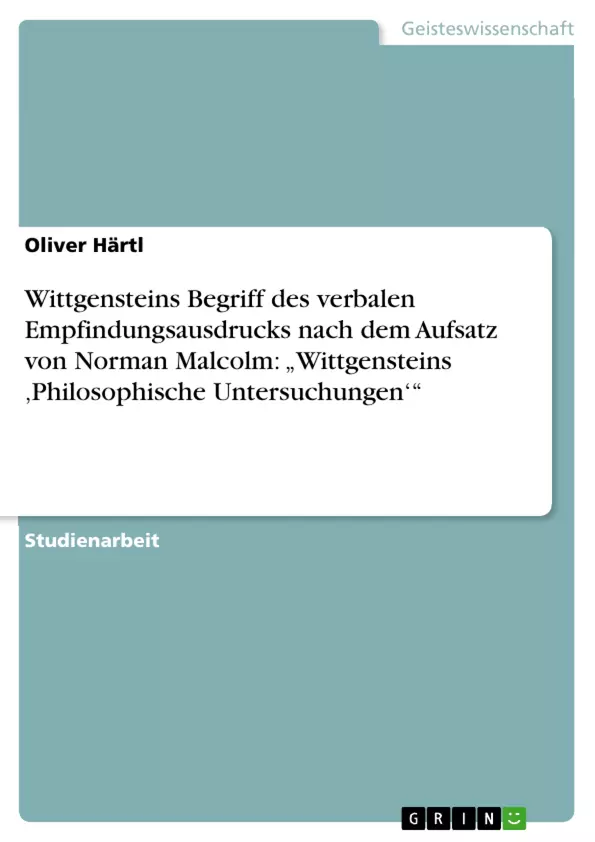Wittgensteins Begriff des verbalen Empfindungsausdrucks
1. Unmöglichkeit einer Privatsprache über Empfindungen
Was Wittgenstein unter einer Privatsprache versteht, stellt er in PU 243 vor. 1 Doch, so stellt sich die Frage, ist es überhaupt möglich, so etwas wie eine Privatsprache widerspruchsfrei zu denken? Dabei ist zunächst zu fragen, wie die neuen, den anderen Menschen in ihrem Inhalt unzugänglichen, Begriffe der Privatsprache zustande kommen sollen. Die gängige These, eine Person verbinde seine private Empfindung einfach mit einem Wort aus der Sprache der Sprachgemeinschaft, das nun für diese Person exklusiv als Name ihrer Empfindung arbeitet und einen Begriff ihrer Privatsprache bildet, scheidet aus. Denn der Ausdruck „ich habe Schmerzen“ bezeichnet dann zwar mein ganz privates Schmerzempfinden, aber eben in einem für die Sprechgemeinschaft dennoch verständlichen Ausdruck. Könnte es wirklich Privatsprache geben, so dürfte dies nach PU 243 nicht der Fall sein. D.h. zu einer Privatsprache gelangt man nicht, indem man von einer natürlichen Sprache ausgeht, sodann ihre Begriffe für Empfindungen inhaltlich entleert und diese schließlich als Namen für seine privaten Empfindungen einsetzt. Wenn man so vorgeht, bleibt immer noch ein Allgemein-verständliches über, ja sogar vorausgesetzt für eine Privatsprache. Es ist nämlich nicht mit dem bloßen im eigenen Geist vorgenommenen Assoziieren einer bestimmten Empfindung mit einem inhaltlich entleertem Wort getan, um dieses Wort durch konsequente Verbindung mit der bestimmten Empfindung zu deren Namen zu machen. Man setzt in einem solchen Akt Eines bereits voraus, nämlich einen Begriff davon, was es allgemein verständlich heißt, eine Empfindung zu haben. Man setzt einen vorausliegenden, inhaltlich bereits erfüllten Empfin-dungsbegriff voraus. Ich weiß demnach bereits, was es bedeutet, eine Empfindung zu haben. Konsequenterweise darf sich eine Privatsprache gar keiner gemeinverständlichen Sprach-
elemente bedienen. 2
Dennoch ist der Gedanke von der Existenz einer Privatsprache durchaus intuitiv. So liegt es vielen Menschen nahe, die Außenwelt als Konstruktion des erkennenden Individuums zu
_______________________________________
1 vgl. Wittgenstein: PU 243: „[...] Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten Empfindungen. Ein anderer kann diese Sprache also nicht verstehen.“
2 vgl. Malcolm: Über Ludwig Wittgenstein, 9 f.;
Inhaltsverzeichnis
- Wittgensteins Begriff des verbalen Empfindungsausdrucks
- Unmöglichkeit einer Privatsprache über Empfindungen
- Regel einer Privatsprache und Empfindungen anderer
- Empfindungswort als Ausdruck und Kriterium einer Empfindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Wittgensteins Begriff des verbalen Empfindungsausdrucks und analysiert die damit verbundenen Argumente gegen die Möglichkeit einer Privatsprache, wie sie in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ (PU) dargelegt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wittgensteins Kritik an der Annahme, dass Empfindungen individuell und privat zugänglich sind und somit eine Grundlage für eine private Sprache bilden könnten.
- Die Unmöglichkeit einer Privatsprache
- Die Rolle von Regeln und Sprache im Kontext von Empfindungen
- Die Bedeutung von Übereinstimmung und öffentlicher Verifikation für Sprache
- Der Zusammenhang zwischen Empfindungen und der öffentlichen Sprache
- Die Kritik an der Vorstellung einer privaten Definition von Begriffen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Unmöglichkeit einer Privatsprache über Empfindungen
Dieses Kapitel untersucht Wittgensteins Argumentation gegen die Möglichkeit einer Privatsprache. Der Autor stellt die Frage, wie neue Begriffe in einer Privatsprache entstehen könnten und analysiert, warum die gängige These, eine Person verbinde eine Empfindung einfach mit einem Wort, nicht zutreffend ist. Weiterhin wird erläutert, dass die Annahme einer Privatsprache voraussetzt, dass man bereits einen allgemeinen Empfindungsbegriff besitzt, und dass daher die Idee einer Privatsprache in sich widersprüchlich ist.
2. Regel einer Privatsprache und Empfindungen anderer
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Regel eine Privatsprache erfüllen müsste. Es wird gezeigt, dass die Annahme, eine Person könne durch ein eigenes inneres Verstehen einer Regel die richtige Anwendung dieser Regel gewährleisten, falsch ist. Die richtige Anwendung einer Regel wird durch den tatsächlichen Gebrauch in einer öffentlichen Sprachgemeinschaft bestimmt, und nicht durch ein individuelles Verständnis. Der Autor argumentiert, dass die Vorstellung einer Privatsprache, die unabhängig von einer öffentlichen Sprachgemeinschaft funktioniert, unrealistisch ist.
Schlüsselwörter
Privatsprache, Empfindungen, Sprache, Regeln, öffentlicher Gebrauch, Verifikation, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen,
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wittgenstein unter einer Privatsprache?
Eine Privatsprache wäre eine Sprache, deren Wörter sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann (seine privaten Empfindungen), und die kein anderer verstehen kann.
Warum hält Wittgenstein eine Privatsprache für unmöglich?
Sprache benötigt Regeln. Die Befolgung einer Regel muss öffentlich verifizierbar sein. In einer rein privaten Sprache gäbe es kein Kriterium für die richtige Anwendung eines Wortes.
Welche Rolle spielt die Sprachgemeinschaft?
Bedeutung entsteht durch den tatsächlichen Gebrauch in einer öffentlichen Gemeinschaft. Ohne diese Übereinstimmung verliert ein Begriff seinen Inhalt.
Können wir Schmerzen privat definieren?
Nein, denn um das Wort „Schmerz“ privat als Name für eine Empfindung einzusetzen, muss man bereits den allgemeinen, öffentlichen Begriff von „Empfindung“ voraussetzen.
Was ist das Ergebnis von Norman Malcolms Analyse?
Malcolm verdeutlicht Wittgensteins Argument, dass verbale Empfindungsausdrücke keine privaten Namen sind, sondern Teil eines öffentlichen Sprachspiels und Verhaltens.
- Arbeit zitieren
- M.A. Oliver Härtl (Autor:in), 2002, Wittgensteins Begriff des verbalen Empfindungsausdrucks nach dem Aufsatz von Norman Malcolm: „Wittgensteins ‚Philosophische Untersuchungen‘“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175612