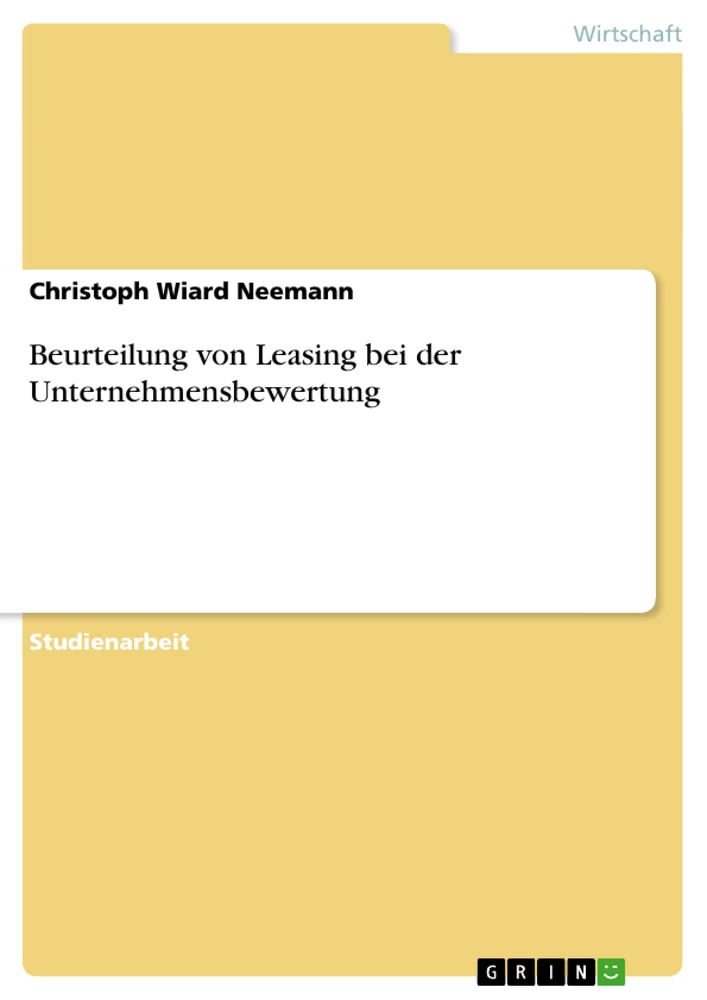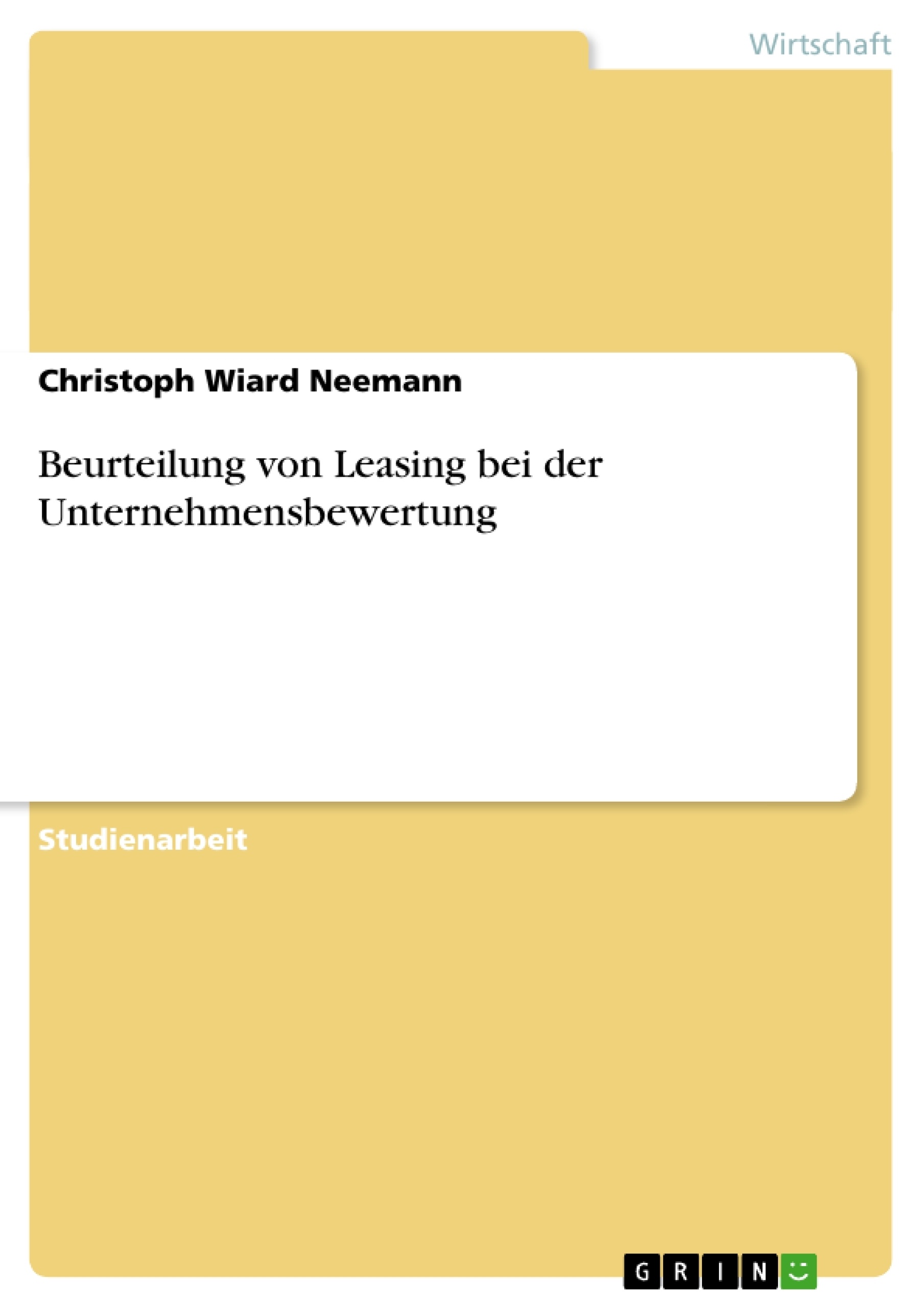Das Leasen als alternative Finanzierungsform gewinnt in deutschen Unternehmen eine immer größere Bedeutung. So ist z. B. von 1994 bis 2001 ein Anstieg des Anteils der Leasing- Finanzierung an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen von 10,4 % auf 16,6 % zu beobachten.
Glaubt man den Aussagen der Leasing-Gesellschaften, liegen die Gründe dafür auf der Hand: Leasing verbessert die Kapitalstruktur des Unternehmens in der Jahresabschlussanalyse, bietet höhere Flexibilität zur Investition und Desinvestition, verringert das Eigentumsrisiko, senkt die Steuerbelastung und schafft Spielräume für weitere Investitionen durch Freiwerden von Fremdkapital.
In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragestellungen: Welche Gründe sprechen aus Sicht des Leasingnehmers für ein Leasinggeschäft? Wie werden Leasing-Finanzierungen bei der Unternehmensbewertung berücksichtigt und welche Veränderungen sind dadurch zu erwarten?
Um diese Fragen zu beantworten, wird diese Arbeit folgende Aspekte betrachten:
* Differenzierung verschiedener Leasing-Arten,
* Vorteilhaftigkeit des Leasings für den Leasingnehmer,
* Auswirkung des Leasings auf die Unternehmensbewertung.
Abschließend werden die Ergebnisse in einem kurzen Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Grundlegendes zum Leasing
- 2.1 Operating Lease
- 2.2 Financial Lease
- 2.3 Steuerliche Behandlung und Bilanzierung des Leasings
- 3 Beurteilung des Leasings aus Sicht des Leasingnehmers
- 3.1 Leasing-Anreize durch externe Vorgaben
- 3.2 Leasing-Anreize durch Präferenzen des Leasingnehmers
- 4 Auswirkungen des Leasings auf die Unternehmensbewertung
- 4.1 Leasing-Bewertung mit dem Kapitalwertverfahren
- 4.1.1 Methodenwahl und Annahmen für die quantifizierte Bewertung
- 4.1.2 Anwendung des Bewertungsmodells
- 4.2 Auswirkungen auf bewertungsrelevante Unternehmenskennzahlen
- 4.2.1 Langfristiges Fremdkapital
- 4.2.2 Anlagevermögen
- 4.2.3 Auswirkungen auf die Kapitalkosten des Unternehmens
- 4.2.4 Auswirkungen auf Realoptionen des Unternehmens
- 5 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Beurteilung von Leasing bei der Unternehmensbewertung. Das Ziel ist es, die Auswirkungen des Leasings auf die relevanten Kennzahlen der Unternehmensbewertung zu analysieren.
- Untersuchung der verschiedenen Leasingformen (Operating Lease und Financial Lease)
- Analyse der steuerlichen Behandlung und Bilanzierung des Leasings
- Bewertung des Leasings aus der Sicht des Leasingnehmers
- Beurteilung der Auswirkungen des Leasings auf die Unternehmensbewertung mit dem Kapitalwertverfahren
- Untersuchung der Auswirkungen des Leasings auf wichtige Unternehmenskennzahlen, wie z.B. Kapitalkosten und Realoptionen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und skizziert den Rahmen der Arbeit. Kapitel 2 erläutert die verschiedenen Arten von Leasing, insbesondere Operating Lease und Financial Lease, sowie die steuerliche Behandlung und Bilanzierung von Leasingverträgen. Kapitel 3 analysiert die Anreize für Leasing aus der Sicht des Leasingnehmers, sowohl durch externe Vorgaben als auch durch interne Präferenzen. Kapitel 4 widmet sich den Auswirkungen des Leasings auf die Unternehmensbewertung, wobei der Fokus auf der Anwendung des Kapitalwertverfahrens und der Analyse der Auswirkungen auf wichtige Unternehmenskennzahlen liegt.
Schlüsselwörter
Leasing, Unternehmensbewertung, Kapitalwertverfahren, Operating Lease, Financial Lease, Steuerliche Behandlung, Bilanzierung, Leasing-Anreize, Kapitalkosten, Realoptionen.
- Quote paper
- Christoph Wiard Neemann (Author), 2003, Beurteilung von Leasing bei der Unternehmensbewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17564