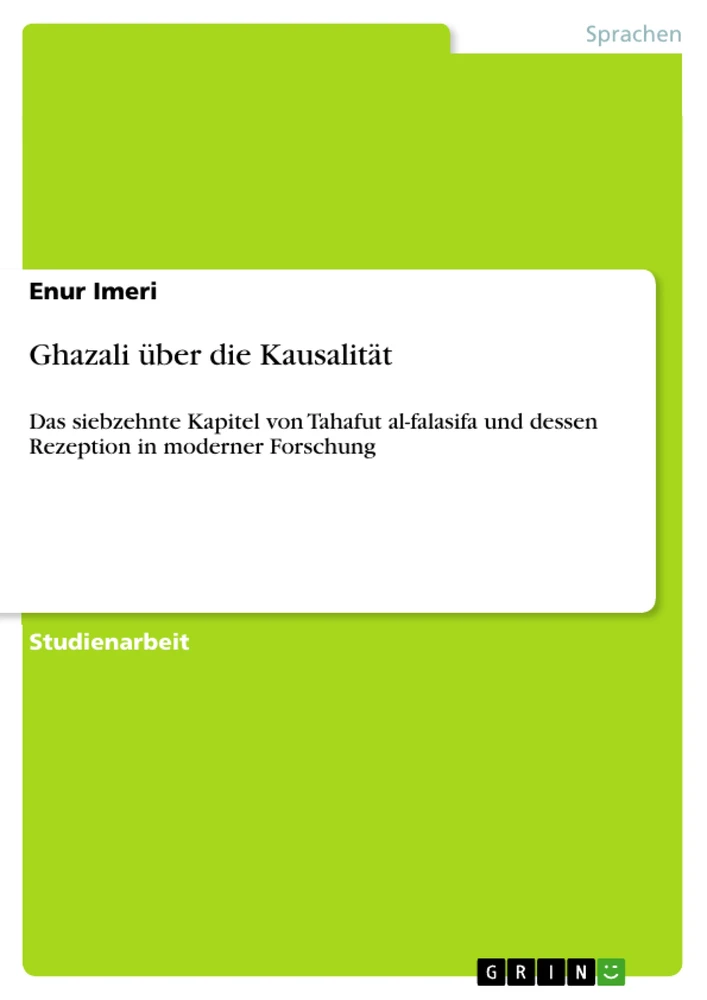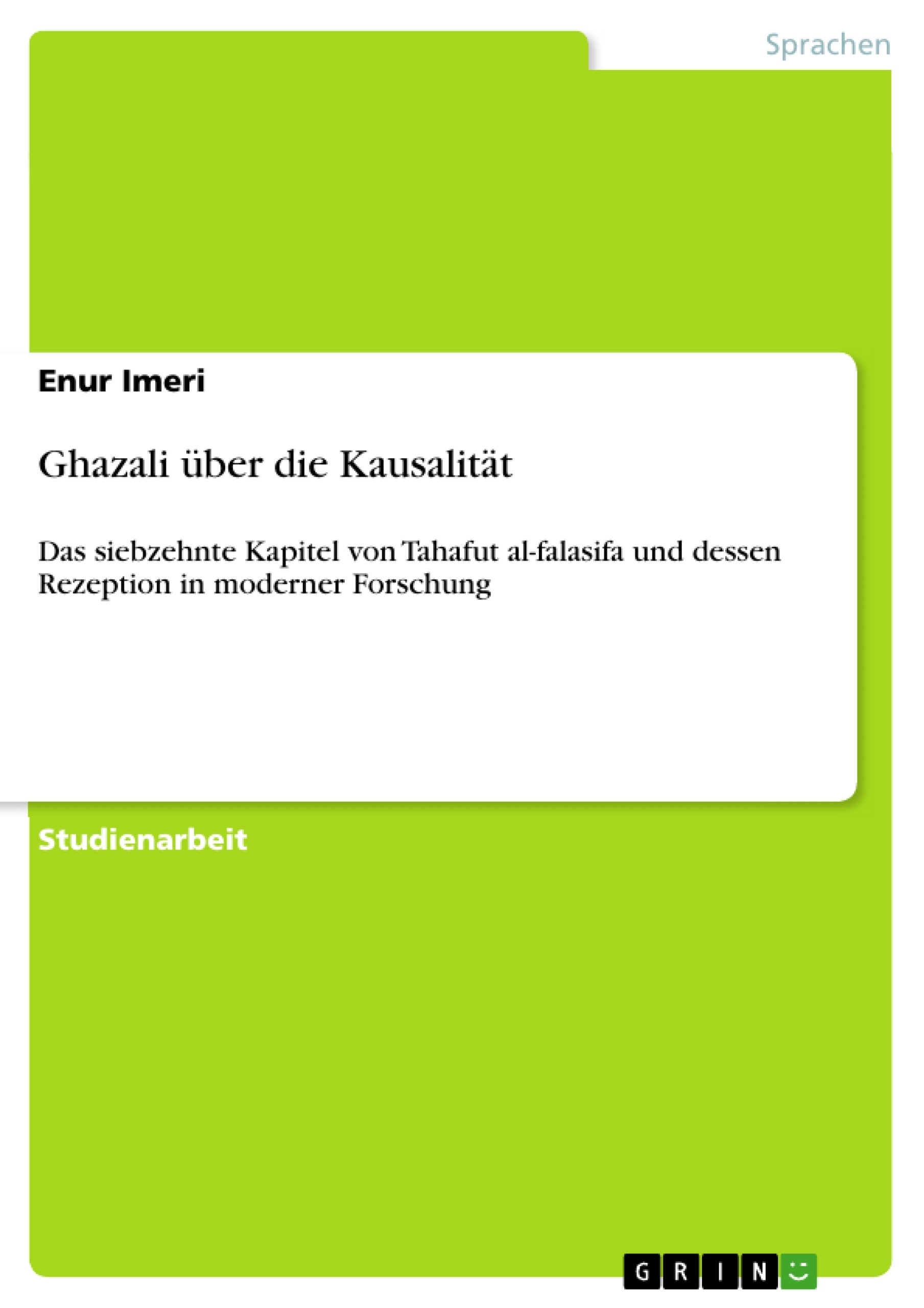Die Frage nach dem Ursprung und Charakter der kausalen Verknüpfungen ist
eine der zentralsten Fragen der klassischen islamischen Theologie. Sie ist deswegen so
zentral, weil sie ausschlaggebend für Vorstellungen von einem allmächtigen Gott und
von Reichweite und Grenzen seiner Allmacht ist. Die 'aš'aritischen Theologen haben in
Auseinandersetzung mit den Lehren der Muʿtazila ein Denksystem entwickelt, das als
islamischer Okkasionalismus bekannt geworden ist. Diesem Okkasionalismus zufolge
wird alles, was in der Zeit erschaffen worden ist, von Gott zu jedem Augenblick neu
erschaffen. Was als kausale Ursache von etwas anderem erscheint, ist in der Tat nur
eine Folge von der Gewohnheit Gottes in seiner Erschaffung.1
Die islamischen Philosophen, die sich der aristotelischen Philosophie
verschrieben hatten, sahen in der Welt eine gesetzmässige innere Ordnung, die nicht
mehr veränderbar ist. Die Dinge in der Welt besitzen eine eigene Natur, von der aus sie
mit Notwenigkeit auf andere Dinge einwirken und auf sie reagieren. Gott ist die erste
Ursache der Welt und die gesamte Existenz geht aus Seinem Wissen mit Notwendigkeit
hervor. Die kausalen Verknüpfungen sind die sekundären Ursachen; sie sind notwendig
und entziehen sich der Kontrolle Gottes. Die Verpflichtung zu dieser Philosophie hatte
zor Folge, dass sie die im Koran erwähnten Prophetenwunder, die nicht mit uns
bekannten Naturgesetzen erklärbar waren, entweder verleugneten oder sie allegorisch
interpretierten.
Das siebzehnte Kapitel von Ġazālī stellt eine Stellungnahme eines Gelehrten,
der neben seiner Hauptschulung in ʾašʿarītischer Richtung auch tiefgründige Kenntnisse
in anderen Disziplinen vorwies, zu der Frage nach den kausalen Verknüpfungen. Ġazālī
verleugnet hier den notwendigen Charakter der kausalen Verknüpfung in der Natur –
oder zumindest jene Version der islamischen Philososphen, die er im Visier hat - mit
der Begründung, dass eine solche Notwendigkeit in der Natur die göttliche Allmacht mit
Einschränkungen versieht. Dies geschieht v.a. dann, wenn die Wunder, die im Koran
erwähnt werden, durch Philosophen entweder dem gewöhnlichen Verlauf der
Naturgesetze entsprechend umgedeutet oder wenn dies nicht machbar ist, allegorisch
interpretiert werden.
==
1 vgl. Fakhry, Majid: „Islamich Occasionalism and its Critique by Averroes and Aquinas“. London, 1958. S.22-55.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Die 17. Diskussion von „tahāfut al-falāsifa“:
- Erste Position:
- Zweite Position:
- Erster Weg:
- Zweiter Weg:
- Weitere Überlegungen:
- Die 17. Diskussion in der neueren Forschung:
- Schlusswort:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die 17. Diskussion in Ġazālīs „tahāfut al-falāsifa“, die sich mit dem Thema der kausalen Verknüpfungen auseinandersetzt. Sie beleuchtet Ġazālīs Argumentation gegen die philosophische Vorstellung einer notwendigen Ordnung in der Welt und setzt diese in Bezug zu den okkasionalistischen Positionen der aš'arītischen Theologie. Ziel ist es, Ġazālīs Standpunkt in der 17. Diskussion zu rekonstruieren und die verschiedenen Interpretationen dieser Diskussion in der neueren Forschung zu beleuchten.
- Die Rolle der kausalen Verknüpfungen in der klassischen islamischen Theologie
- Die Kontroverse zwischen aš'arītischer Theologie und islamischer Philosophie
- Ġazālīs Kritik an der philosophischen Vorstellung von notwendigen kausalen Verknüpfungen
- Die Bedeutung der göttlichen Allmacht in Ġazālīs Argumentation
- Die verschiedenen Interpretationen von Ġazālīs Position in der neueren Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Hintergrund der Debatte um die kausalen Verknüpfungen in der klassischen islamischen Theologie, wobei die Positionen der aš'arītischen Theologen und der islamischen Philosophen kontrastiert werden. Im zweiten Kapitel wird Ġazālīs Argumentation im 17. Kapitel von „tahāfut al-falāsifa“ analysiert. Es wird seine Kritik an der philosophischen Vorstellung einer notwendigen Ordnung in der Natur dargelegt und die verschiedenen Aspekte seiner Position, darunter die Betonung der göttlichen Allmacht und die Möglichkeit von göttlichen Eingriffen in den natürlichen Verlauf, beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Rezeption der 17. Diskussion in der neueren Forschung, wobei verschiedene Interpretationen von Ġazālīs Standpunkt und deren kontroversen Aspekte vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Ġazālī, „tahāfut al-falāsifa“, kausale Verknüpfungen, Okkasionalismus, aš'arītische Theologie, islamische Philosophie, göttliche Allmacht, Wunder, Rezeption, Forschungsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Enur Imeri (Autor:in), 2011, Ghazali über die Kausalität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175719