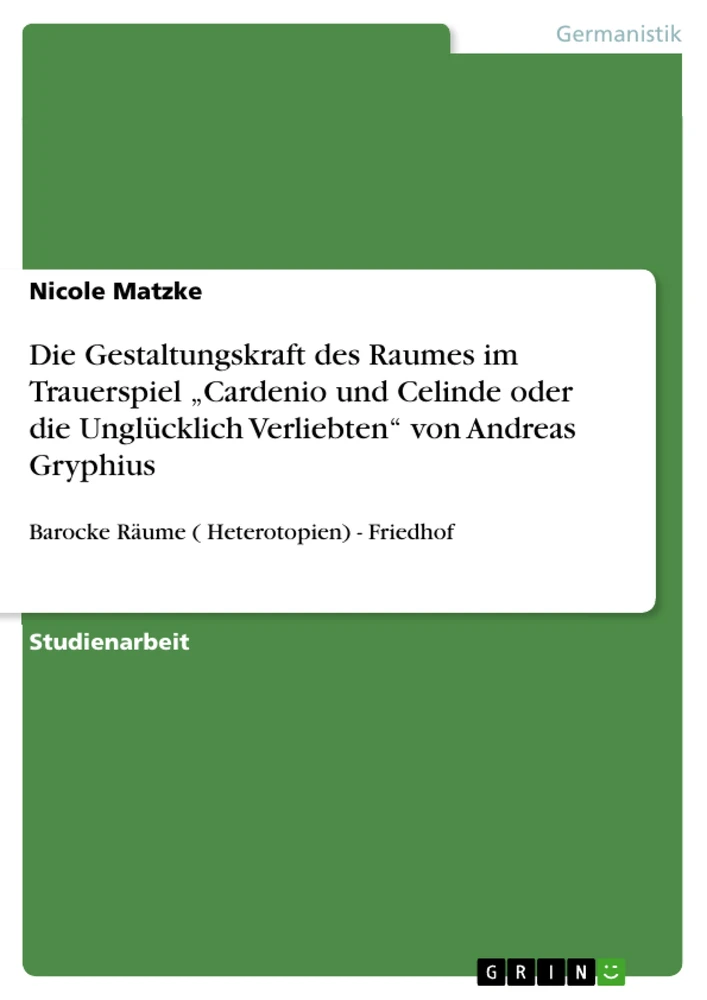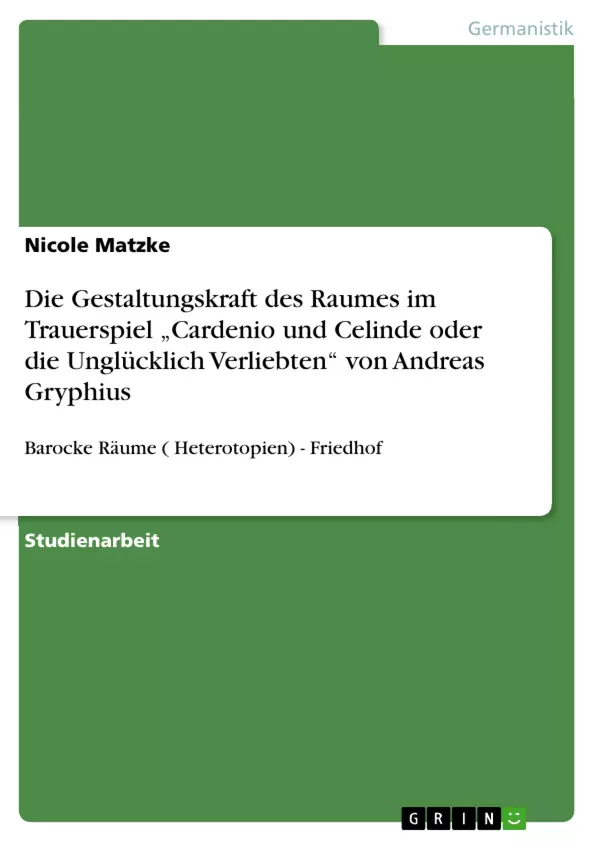Gegenstand dieser Seminararbeit wird sein mit Hilfe raumtheoretischer Erkenntnisse Michel Foucaults, das frühneuzeitliche Drama (oder Trauerspiel) „Cardenio und Celinde“ von Andreas Gryphius literaturtheoretisch zu untersuchen und so den literarischen Raum Friedhof im Text an ausgewählter Stelle als Heterotopie zu kennzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heterotopische Orte
- Heterotopien in der Gesellschaft der frühen Neuzeit
- Der Kirchhof
- Die Zeichen des Todes in der Gesellschaft des späten 16ten und frühen 17ten Jahrhunderts
- Als Heterotopien markierte Stellen im Trauerspiel „Cardenio und Celinde oder die Unglücklich Verliebten“ von Andreas Gryphius und ihre Funktion
- Der Lustgarten und seine Verwandlung
- Kirchhof und seine Entstehung
- Die Funktion der räumlichen Steigerung innerhalb des Textes
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das frühneuzeitliche Drama „Cardenio und Celinde“ von Andreas Gryphius anhand raumtheoretischer Erkenntnisse Michel Foucaults. Im Fokus steht die Analyse des literarischen Raumes Friedhof im Text als Heterotopie.
- Die Bedeutung von räumlichen Beschreibungen und ihrer Funktion in der Gestaltung von dramatischen Aspekten.
- Die Konstruktion von heterotopischen Orten im Kontext der frühen Neuzeit.
- Die Rolle des Friedhofs als Heterotopie im Trauerspiel und seine Funktion in der Darstellung von Macht, Memoria und konventionellen Verhaltensweisen.
- Die Unterscheidung von Heterotopien und Utopien im Hinblick auf ihre Lokalisierbarkeit.
- Die Analyse von räumlichen Praktiken und ihrer Bedeutung für die Entstehung von Spannungen im Text.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Raumtheorie ein und stellt die Relevanz des Raumes für die Analyse von Literatur dar. Sie erläutert die grundlegenden Konzepte von Raum und Heterotopie und definiert den Gegenstand der Arbeit: die Analyse des Friedhofs als Heterotopie in „Cardenio und Celinde“.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Konzept der Heterotopien und ihrer Unterscheidung von Utopien. Es beleuchtet den historischen Kontext von Heterotopien in der frühen Neuzeit und stellt den Kirchhof als spezifischen heterotopischen Ort vor.
Kapitel 2 analysiert den Raum Friedhof in „Cardenio und Celinde“ als Heterotopie und untersucht seine Funktion im Drama. Es betrachtet die räumlichen Veränderungen im Lustgarten und die Entstehung des Kirchhofs als Orte der Transformation und der Abgrenzung vom Alltagsleben.
Schlüsselwörter
Raumtheorie, Heterotopien, Utopien, frühneuzeitliches Drama, Andreas Gryphius, „Cardenio und Celinde“, Friedhof, Lustgarten, Macht, Memoria, konventionelle Verhaltensweisen.
- Citar trabajo
- Nicole Matzke (Autor), 2010, Die Gestaltungskraft des Raumes im Trauerspiel „Cardenio und Celinde oder die Unglücklich Verliebten“ von Andreas Gryphius, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175743