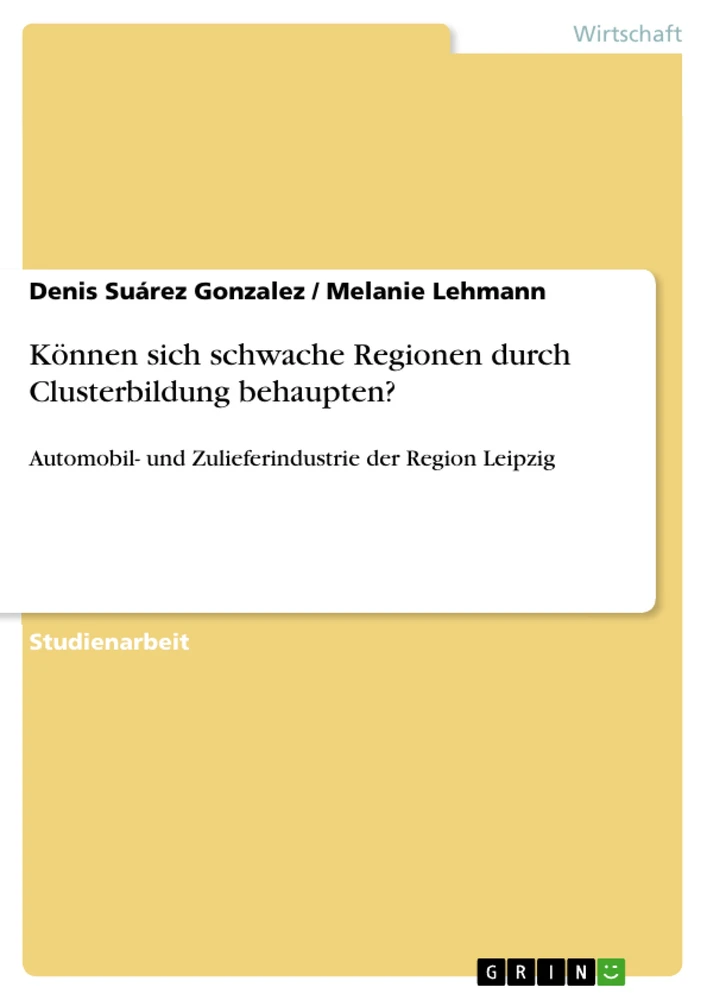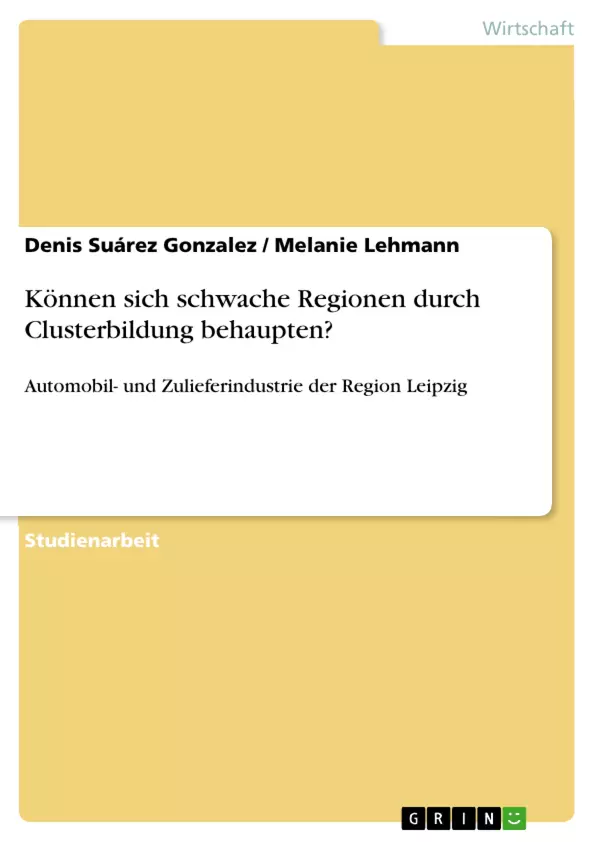Aufgrund der sich stetig verändernden Marktbedingungen sind Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und Struktur gezwungen Wettbewerbsvorteile für eine verbesserte Wertschöpfung wahrzunehmen und auszunutzen. So gewinnen Cluster zunehmend für Unternehmen an Bedeutung, da die Integration in Netzwerke förderlich für eine verbesserte Leistungsfähigkeit ist. Neben den Unternehmen, welche sich an die stark dynamischen Bedingungen anpassen müssen, zeigt auch die Politik Interesse an den neueren Formen von Kooperationen. Sie sieht im Clusterkonzept einen neuen Hoffnungsträger für Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung. In der Literatur werden die Vorteile und Potentiale, welche aus einem Cluster hervorgehen können im nationalen und internationalen Zusammenhang diskutiert. Bislang gibt es jedoch keine klaren und eindeutigen Aussagen darüber, ob und inwiefern sich speziell schwache Regionen durch Cluster behaupten können.
Mit der vorliegenden Arbeit soll verdeutlicht werden, dass jene schwachen Regionen bemerkenswerte Chancen entwickeln und Stärken entfalten können. Besonderes Augenmerk wird in diesem Rahmen auf die neuen Bundesländer, speziell die Region Leipzig gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Aufbau der Arbeit
- 1.2. Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. Netzwerk
- 2.2. Cluster
- 3. Systematisierung der Clusterforschung
- 3.1. Von historischen Agglomerationstheorien zu heutigen Clustern
- 3.1.1. Agglomerationskräfte in Tühnen´s isolierten Staat
- 3.1.2. Positive Agglomerationseffekte infolge technologischer Externalitäten
- 3.1.3. Industrial Districts
- 3.1.4. Überleitung zur neuen ökonomischen Geographie
- 3.2. Wettbewerbstheorien
- 3.2.1. Porter's Fünf-Kräfte-Modell
- 3.2.2. Porter's Wettbewerbsvorteils-Diamant
- 3.2.2.1. Voraussetzungen
- 3.2.2.2. Bestimmungsfaktoren
- 3.2.2.2.1. Faktorbedingungen
- 3.2.2.2.2. Nachfragebedingungen
- 3.2.2.2.3. Verwandte und unterstützende Branchen
- 3.2.2.2.4. Unternehmensstrategie, Struktur und Konkurrenz
- 3.2.2.2.5. Der Zufall im Rahmen des Gesamtsystems
- 3.2.2.2.6. Der Staat im Rahmen des Gesamtsystems
- 3.2.2.2.7. Der gefolgerte Nutzen für die Region
- 3.3. Durch Innovation einen Vorteil schaffen
- 3.3.1. Neue Technologien
- 3.3.2. Wandelnde Käuferbedürfnisse
- 3.3.3. Neue Branchen
- 3.3.4. Kostenvorteile erlangen
- 3.3.5. Staatliche Regulierungen
- 3.3.6. Erkenntnisse durch Innovation
- 4. Clusterentwicklung
- 4.1. Cluster-Life-Cycle
- 4.2. Clusterentwicklungsmodell
- 4.3. Aufgaben des Clustermanagements
- 4.3.1. Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit
- 4.3.2. Personal und deren Qualifizierung
- 4.3.3. Kosten und Prozesse
- 4.3.4. Kompetenzfeld Maintenance
- 4.3.5. Forschung und Entwicklung
- 4.3.6. Qualität
- 4.3.7. Einrichtung eines Clusterzentrums
- 5. Region Leipzig
- 5.1 Die Region Leipzig in Zahlen und Fakten
- 5.2 Das Cluster der Automobil- und Zulieferindustrie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob sich schwache Regionen durch Clusterbildung behaupten können, am Beispiel der Automobil- und Zulieferindustrie der Region Leipzig. Ziel ist es, aufzuzeigen, welche Chancen und Stärken sich für schwache Regionen durch Clusterbildung entwickeln lassen. Dabei wird ein Fokus auf die neuen Bundesländer, speziell die Region Leipzig gelegt. Die Arbeit analysiert die Relevanz von Clusterbildung für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen.
- Die Rolle von Clustern für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen
- Die Bedeutung von Netzwerken und Kooperationen für die Entwicklung von Clustern
- Die Herausforderungen und Chancen für die Clusterbildung in schwachen Regionen
- Die Anwendung von Clusterkonzepten in der Automobil- und Zulieferindustrie der Region Leipzig
- Die Bedeutung von staatlicher Förderung und Unterstützung für die Clusterentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und stellt die Relevanz des Themas heraus. Kapitel 2 definiert die Schlüsselbegriffe Netzwerk und Cluster und erläutert den Zusammenhang zwischen den Begriffen. Kapitel 3 bietet eine systematische Analyse der Clusterforschung, beginnend mit historischen Agglomerationstheorien. Es werden verschiedene Modelle der Clusterbildung und Wettbewerbstheorien vorgestellt, darunter Porter's Fünf-Kräfte-Modell und Porter's Wettbewerbsvorteils-Diamant. Kapitel 4 befasst sich mit der Clusterentwicklung, untersucht den Cluster-Life-Cycle und stellt ein Clusterentwicklungsmodell vor. Es werden außerdem die Aufgaben des Clustermanagements in den einzelnen Phasen der Clusterentwicklung erläutert. Kapitel 5 analysiert die Region Leipzig, ihre wirtschaftliche Entwicklung und das Cluster der Automobil- und Zulieferindustrie. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wesentlichen Aussagen zusammenfasst und auf die Fragestellung zurückblickt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Clusterbildung, Wettbewerbsvorteil, Regionalentwicklung, Automobilindustrie, Zulieferindustrie, Netzwerk, Agglomeration, Innovation, Clustermanagement, und Region Leipzig.
Häufig gestellte Fragen
Können schwache Regionen durch Clusterbildung wirtschaftlich profitieren?
Ja, die Arbeit zeigt am Beispiel der Region Leipzig, dass Clusterbildung schwachen Regionen helfen kann, Wettbewerbsvorteile zu nutzen und die regionale Wertschöpfung durch Netzwerke zu steigern.
Was ist Porters Wettbewerbsvorteils-Diamant?
Dies ist ein Modell von Michael Porter, das Faktoren wie Faktorbedingungen, Nachfragebedingungen und verwandte Branchen analysiert, um den Wettbewerbsvorteil einer Region zu bestimmen.
Welche Rolle spielt die Automobilindustrie in Leipzig?
Das Cluster der Automobil- und Zulieferindustrie in Leipzig dient als Fallbeispiel dafür, wie gezielte Ansiedlungen und Kooperationen eine ehemals strukturschwache Region stärken können.
Was sind die Aufgaben eines Clustermanagements?
Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeitsarbeit, Personalqualifizierung, Prozessoptimierung sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung innerhalb des Netzwerks.
Was ist ein „Cluster-Life-Cycle“?
Der Cluster-Life-Cycle beschreibt die verschiedenen Phasen der Entwicklung eines Clusters, von der Entstehung über das Wachstum bis hin zur Reife oder Transformation.
- Quote paper
- Denis Suárez Gonzalez (Author), Melanie Lehmann (Author), 2010, Können sich schwache Regionen durch Clusterbildung behaupten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175765