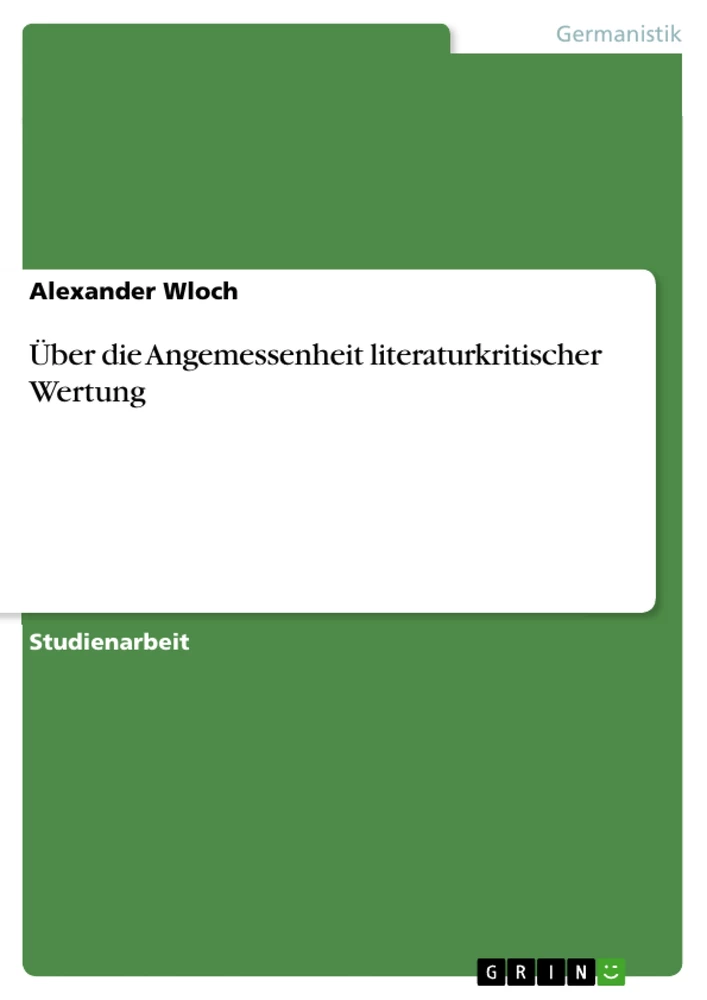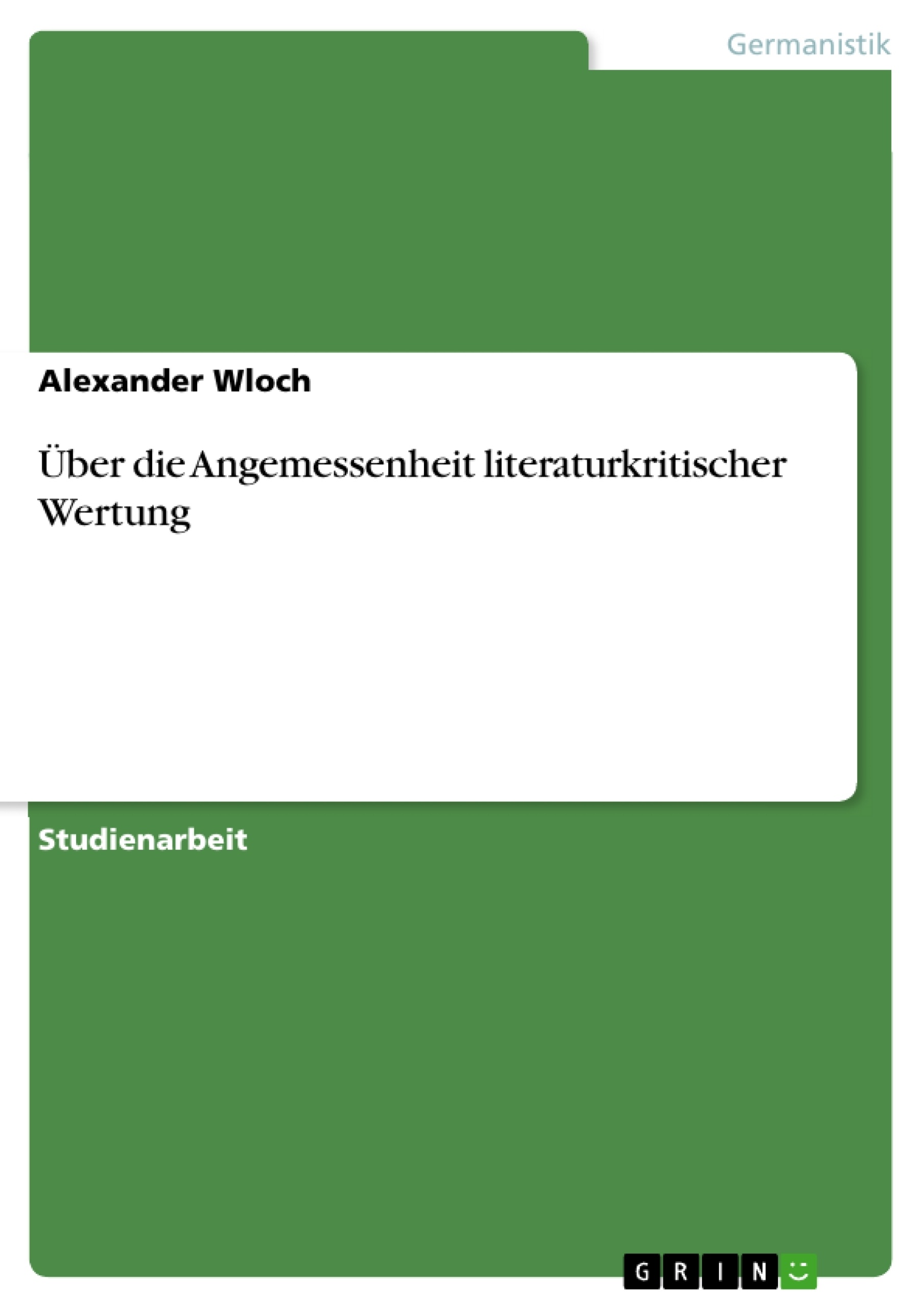Der Streit um Literatur in Form der Kritik setzte im deutschsprachigen Raum vor nunmehr über 200 Jahren ein. Es ist nicht zu erwarten, nicht einmal auf lange Sicht, dass jene, die
ihn austragen, sein Ende erleben werden. Wenn sich die Streitenden auf ihr Handwerk verstehen, werden sie daran aus vitalen Gründen gar kein Interesse haben. Grund zur Beunruhigung besteht, wie gesagt, nicht. Selbst die zunächst schockierende Erkenntnis, dass drastische Uneinigkeit über den Streitwert herrscht, hat der Kritik – gemessen daran, dass sie noch existiert - nicht wirklich schaden können.
Was Literatur ist, lässt sich nicht absolut und für alle Zeit bestimmen, stattdessen ist das, was unter Literatur verstanden wird, eine Projektion der historischen und gesellschaftlichen Fakten. „Die Theorie des Abfalls: über die Schaffung und Vernichtung
von Werten“ (1979, Übersetzung 1981) von Michael Thompson legt diesen Schluss nahe. Sie, die Theorie des Abfalls, thematisiert die Mechanismen, die für den radikalen Wertewandel von Gegenständen verantwortlich sind. Darüber hinaus ermöglicht es die Theorie, jeder noch so ausgeklügelten Kritiker-Regel den Boden unter den Füßen wegzuziehen und den Reglementierenden als jemanden zu outen, der lediglich glaubt, er wisse, was zu tun sei.
Jedes Verhältnis zur Literatur ist das Resultat sozialer Bearbeitung, wobei die Art und Weise der Bearbeitung von der jeweiligen Blindheit des Kritikers abhängig ist. Mit der tatkräftigen Unterstützung des Soziologen, Mathematikers und Philosophen Michael Thompson versucht die vorliegende Arbeit also zu beschreiben, warum eine wertende Kritik in jedem Fall problematisch ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Thompsons Kategoriensystem
- 3. Wie Texte rezipiert werden
- 4. Probleme literarischer Wertung
- 5. Die Abfall-Kategorie
- 6. Der Kontrollmechanismus
- 7. Die Transaktionstheorie
- 8. Alles ist im Fluss
- 9. Die Realisierbarkeit von Weltanschauungen
- 10. Ästhetischer und ökonomischer Wert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Problematik der literaturkritischen Wertung anhand der „Theorie des Abfalls“ von Michael Thompson. Sie untersucht die Mechanismen, die die Bewertung von Literatur prägen und die Rolle des Kritikers* in diesem Prozess. Ziel ist es, zu beleuchten, warum eine wertende Kritik in jedem Fall problematisch ist.
- Thompsons Kategoriensystem zur Unterscheidung von Dauerhaftem und Vergänglichem
- Die Rezeption von Literatur und die subjektiven Faktoren, die die Wertung beeinflussen
- Die Auswirkungen der literaturkritischen Arbeit und die potentiellen Ungerechtigkeiten
- Die Rolle des Kritikers* und die Frage, ob Objektivität in der Bewertung von Literatur möglich ist
- Die Ambivalenz von literarischen Werten und die Frage, ob diese überhaupt objektiv gemessen werden können
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Debatte um Literaturkritik im deutschsprachigen Raum. Sie führt die „Theorie des Abfalls“ von Michael Thompson ein, die den Rahmen für die Untersuchung der literaturkritischen Wertung bildet.
Kapitel 2: Thompsons Kategoriensystem
Dieses Kapitel stellt Thompsons Kategoriensystem vor, das zwischen Dauerhaftem und Vergänglichem unterscheidet. Es wird gezeigt, wie dieses System auf die Literatur angewendet werden kann, um die unterschiedlichen Wertungen von Texten zu erklären.
Kapitel 3: Wie Texte rezipiert werden
Das Kapitel beleuchtet, wie Texte von Leser*innen rezipiert werden und welche Faktoren die Interpretation und Wertung beeinflussen. Die Bedeutung der individuellen Erfahrungen und der sozialen Kontexte für die Rezeption wird hervorgehoben.
Kapitel 4: Probleme literarischer Wertung
Dieses Kapitel behandelt die Problematik der literaturkritischen Wertung und diskutiert die Schwierigkeiten, objektive Maßstäbe für die Bewertung von Literatur zu finden. Es zeigt, wie die subjektiven Präferenzen des Kritikers* die Wertung beeinflussen können.
Kapitel 5: Die Abfall-Kategorie
Hier wird Thompsons Konzept der Abfall-Kategorie auf die Literatur übertragen und die Frage aufgeworfen, welche Texte als Abfall angesehen werden können. Es wird diskutiert, ob bestimmte literarische Genres oder Texte aufgrund ihrer vermeintlichen Vergänglichkeit weniger wertvoll sind.
Kapitel 6: Der Kontrollmechanismus
Dieses Kapitel untersucht den Kontrollmechanismus, der die literaturkritische Wertung prägt. Es wird gezeigt, wie die Machtverhältnisse in der Literaturwelt die Bewertung von Texten beeinflussen und bestimmte Texte als wertvoller angesehen werden als andere.
Kapitel 7: Die Transaktionstheorie
Das Kapitel stellt Thompsons Transaktionstheorie vor und erklärt, wie diese die Austauschprozesse zwischen den Akteuren in der Literaturwelt beschreibt. Es wird die Rolle des Marktes und der Ökonomie für die Wertung von Literatur beleuchtet.
Kapitel 8: Alles ist im Fluss
Dieses Kapitel diskutiert die Dynamik der literaturkritischen Wertung und die Frage, ob es eine feste Wertskala gibt. Es wird gezeigt, wie sich Wertungen im Laufe der Zeit verändern und wie neue literarische Strömungen die bestehenden Kategorien in Frage stellen.
Kapitel 9: Die Realisierbarkeit von Weltanschauungen
Hier wird die Frage aufgeworfen, ob Literatur in der Lage ist, bestimmte Weltanschauungen zu realisieren. Es wird diskutiert, welche Auswirkungen die literaturkritische Wertung auf die politische und soziale Landschaft hat.
Kapitel 10: Ästhetischer und ökonomischer Wert
Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Dimensionen der literarischen Wertung und untersucht die Beziehung zwischen ästhetischem und ökonomischem Wert. Es wird diskutiert, ob diese beiden Aspekte in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.
Schlüsselwörter
Literaturkritik, Wertung, Theorie des Abfalls, Michael Thompson, Rezeption, Kategorien, Dauerhaftes, Vergängliches, Kontrollmechanismus, Transaktionstheorie, Ästhetik, Ökonomie, Weltanschauung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Michael Thompsons „Theorie des Abfalls“?
Die Theorie thematisiert Mechanismen des radikalen Wertewandels und unterscheidet zwischen dauerhaften, vergänglichen Objekten und der Kategorie „Abfall“.
Warum ist eine wertende Literaturkritik laut der Arbeit problematisch?
Weil literarische Werte keine absoluten Fakten sind, sondern Projektionen historischer und gesellschaftlicher Umstände sowie der subjektiven „Blindheit“ des Kritikers.
Können literarische Werte objektiv gemessen werden?
Nein, die Arbeit legt nahe, dass jede Wertung das Resultat sozialer Bearbeitung ist und durch Machtverhältnisse in der Literaturwelt beeinflusst wird.
Was ist der Unterschied zwischen ästhetischem und ökonomischem Wert?
Während Ästhetik die künstlerische Qualität betrifft, wird der ökonomische Wert durch Transaktionsprozesse und den Markt bestimmt, wobei beide Dimensionen oft in einem Spannungsverhältnis stehen.
Wie verändern sich literarische Wertungen im Laufe der Zeit?
Wertungen sind „im Fluss“; neue Strömungen und gesellschaftliche Veränderungen können ehemals geschätzte Werke in die Kategorie „Abfall“ verschieben oder umgekehrt.
- Arbeit zitieren
- Alexander Wloch (Autor:in), 2010, Über die Angemessenheit literaturkritischer Wertung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175788