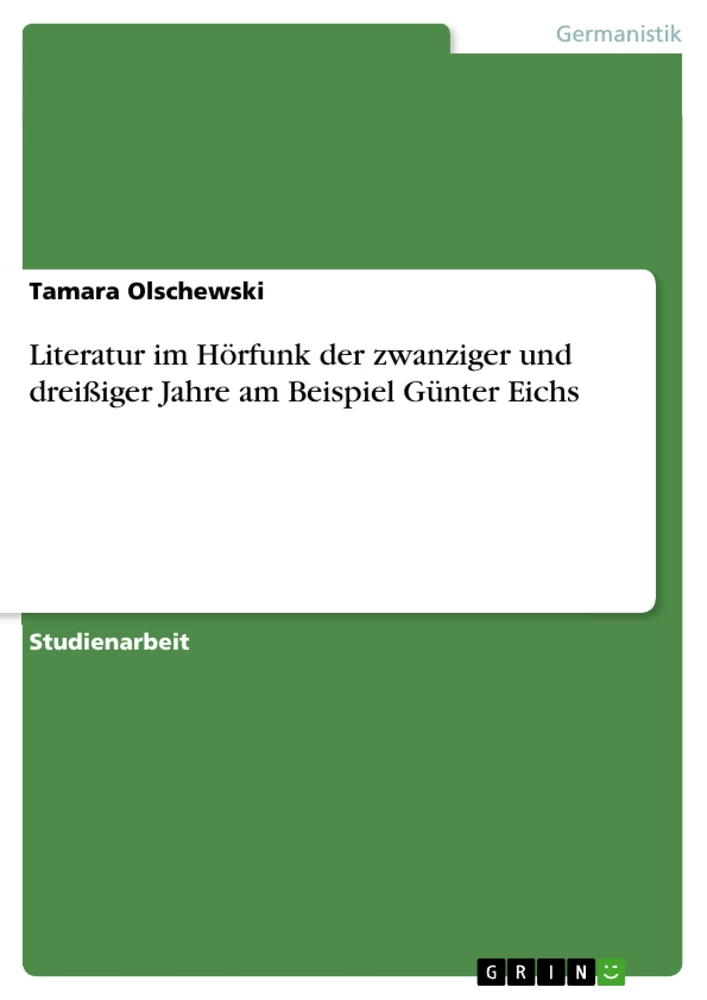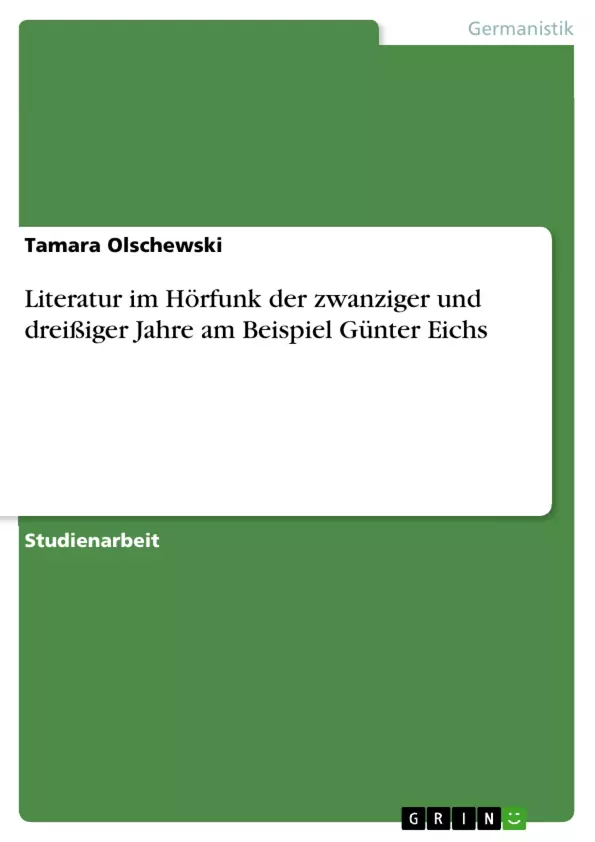Am 14.März 2000 war die meist besuchte Internetseite, die des amerikanischen Autors Stephen King. Als erster Schriftsteller hatte er das neue Medium Internet für sich entdeckt und seinen Roman ,,Riding the Bullet" als Online-Ausgabe ins Netz gestellt. Der Kultautor von Bestsellern wie ,,Shining" und ,,Es" machte zunächst keine guten Erfahrungen mit dem neuen Medium. Drei Wochen nach Erscheinen der Online Ausgabe geisterte das - eigentlich kopiergesicherte - ´Grusel-E-Book` als geknackte Raubkopie im Internet herum. Dabei hätte der Download von der Verlagshomepage planmäßig nur gegen Bezahlung erfolgen dürfen.
Obwohl das Misstrauen in die elektronische Distribution von Literatur angestiegen war, konnte bereits einige Wochen später der deutsche Fantasy- und Science-Fiction Autor Wolfgang Hohlbein für die Veröffentlichung seines neuesten Werkes in ausschließlich elektronischer Form gewonnen werden. Vom Augsburger Online-Buchhändler ,,Booxtra" konnte Hohlbeins Roman "Das zweite Gesicht" für fünf Mark direkt aus dem Netz geladen und am heimischen PC ausgedruckt werden. Booxtra hoffte durch die Kooperation mit Hohlbein noch mehr Autoren und Leser für die literarische Arbeit bzw. die literarischen Angebote im Internet zu begeistern.
Hohlbein zählt mit der rein elektronischen Veröffentlichung von "Das zweite Gesicht" zu den Pionieren aus dem deutschsprachigen Raum, die das neue Medium Internet für die Verbreitung ihrer literarischen Arbeit nutzen.
Die Firma ´T-Online` hat gemeinsam mit dem Deutschen Taschenbuchverlag (dtv) einen Wettbewerb ausgeschrieben, um die ,,literarische Kunstformen des digitalen Zeitalters zu fördern"(unter: www.t-online.de/literaturpreis).
Anlass für die Ausschreibung von ´Literatur.digital2001` ist das vierzigjährige Jubiläum von dtv. Während der Ausschreibung können alle Beiträge online abgerufen werden. ,,Literatur.digital2001" untergliedert sich in einen Publikumspreis und einen Jurypreis.
Eine Vorjury der Veranstalter wählt in einem ersten Schritt bis zu 20 Arbeiten aus. Anschließend stimmen die Internet-Nutzer per Online-Voting über den Publikumspreis ab. Eine fünfköpfige Jury bestimmt den Gewinner des Jurypreises. In beiden Kategorien erhalten die erstplatzierten Gewinner je 5.000 Mark. Alle Einsendungen, die den Anforderungen entsprechen, werden im Internet publiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung von Radio und Hörspiel
- Die Hörspielrevolution, oder: Wie alles begann
- Erste Überlegungen zum Zeck und zur Wirkung des Hörspiel
- Erste Entwürfe zur Hörspieltheorie
- Die Rundfunkrevolution, oder: Wie alles endete
- Der Dichter und sein Werk
- Günter Eich - Zur Person
- Günter Eich - Zum Werk
- „Ein Traum am Edsin-gol“
- Die Weiterentwicklung des Hörspiels
- Das traditionelle Hörspiel
- Das neue Hörspiel
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarischen Möglichkeiten des Hörspiels im Kontext der Entwicklung des Radios, mit besonderem Fokus auf den Schriftsteller Günter Eich. Die Untersuchung zeigt, wie Eich die neue Technologie des Radios für seine literarischen Werke nutzte und dabei die Möglichkeiten und Grenzen des Mediums auslotete.
- Die Entwicklung des Hörspiels von seinen Anfängen bis zur Gegenwart
- Die Bedeutung des Radios als neues Medium für die Literatur
- Günter Eichs Werk im Kontext der Hörspielgeschichte
- Eichs Experimente mit der auditiven Dimension des Hörspiels
- Die literarische Bedeutung des Hörspiels im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Radios als Medium für die Literatur. Sie führt die Leser in die Thematik der Untersuchung ein und beleuchtet den Einfluss der neuen Technologie auf die Literatur.
- Die Entwicklung von Radio und Hörspiel: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte des Radios und der Entwicklung des Hörspiels. Es beschreibt die ersten Schritte des Radios als Medium und analysiert die frühen Versuche, literarische Inhalte in das neue Medium zu integrieren.
- Der Dichter und sein Werk: Dieses Kapitel stellt Günter Eich als bedeutenden Vertreter der Hörspielkunst vor. Es beleuchtet seine Biografie und sein Werk, mit besonderem Fokus auf seine Beiträge zum Hörspiel.
- „Ein Traum am Edsin-gol“: Dieses Kapitel untersucht ein konkretes Beispiel für Eichs Hörspielwerk. Es analysiert die spezifischen Mittel und Techniken, die Eich in diesem Hörspiel einsetzt, und zeigt, wie Eich die Möglichkeiten des Mediums für seine literarischen Ideen nutzt.
- Die Weiterentwicklung des Hörspiels: Dieses Kapitel betrachtet die Weiterentwicklung des Hörspiels nach Eich. Es zeichnet die Entwicklungen nach, die das Medium in den Jahrzehnten nach Eichs Tod prägten, und stellt die verschiedenen Arten von Hörspielen vor, die heute produziert werden.
Schlüsselwörter
Hörspiel, Radio, Günter Eich, Literatur, Medienentwicklung, auditive Kunst, Sprechtheater, Dramaturgie, Klang, Sprache, Klanggestaltung, Radiophonik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Günter Eich in der Geschichte des Hörspiels?
Günter Eich gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Hörspielkunst im 20. Jahrhundert. Er nutzte die auditive Dimension des Radios, um die Grenzen des Mediums auszuloten und literarische Experimente mit Klang und Sprache durchzuführen.
Was wird im Kapitel „Ein Traum am Edsin-gol“ analysiert?
Dieses Kapitel untersucht ein konkretes Beispiel für Eichs Hörspielwerk. Es analysiert die spezifischen Mittel und Techniken, mit denen Eich die Möglichkeiten des Radios für seine literarischen Ideen nutzte.
Wie entwickelte sich das Hörspiel nach Günter Eich weiter?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem traditionellen und dem neuen Hörspiel. Sie zeichnet die Entwicklungen nach seinem Tod nach und stellt verschiedene Formen der heutigen Hörspielproduktion vor.
Welchen Einfluss hatte das Internet auf die Literaturverbreitung um das Jahr 2000?
Autoren wie Stephen King und Wolfgang Hohlbein waren Pioniere, die das Internet für Online-Ausgaben nutzten. Trotz Problemen wie Raubkopien förderte das Medium neue literarische Kunstformen und Wettbewerbe wie „Literatur.digital“.
Was war das Ziel des Wettbewerbs „Literatur.digital2001“?
Der von T-Online und dtv ausgeschriebene Wettbewerb sollte literarische Kunstformen des digitalen Zeitalters fördern und bot sowohl Publikums- als auch Jurypreise für innovative Online-Beiträge.
- Quote paper
- M.A. Tamara Olschewski (Author), 2001, Literatur im Hörfunk der zwanziger und dreißiger Jahre am Beispiel Günter Eichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1758