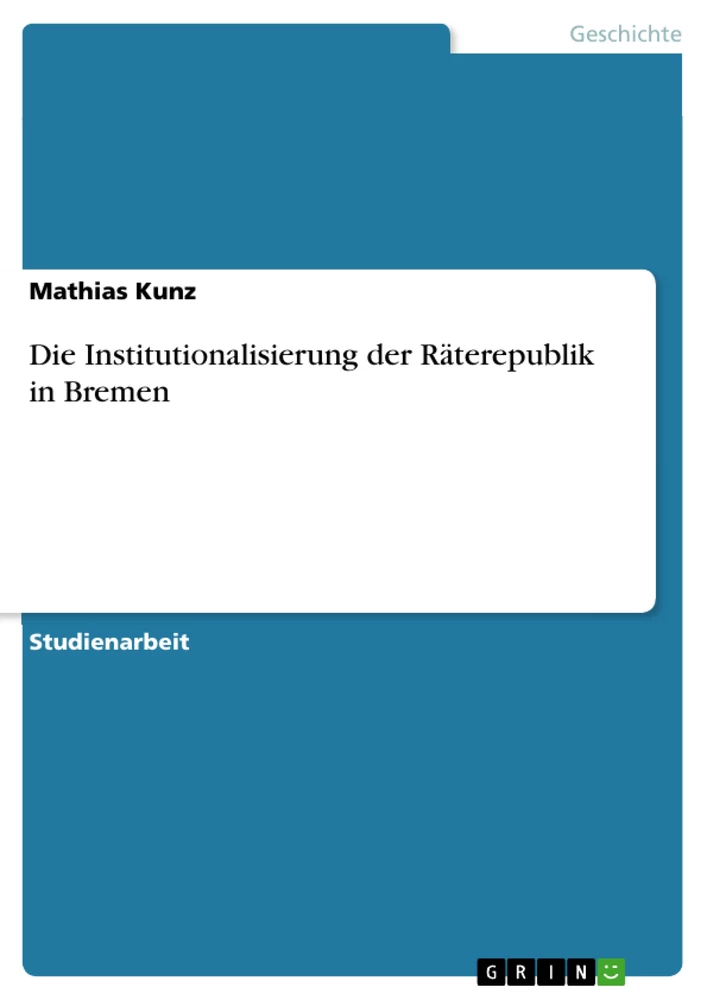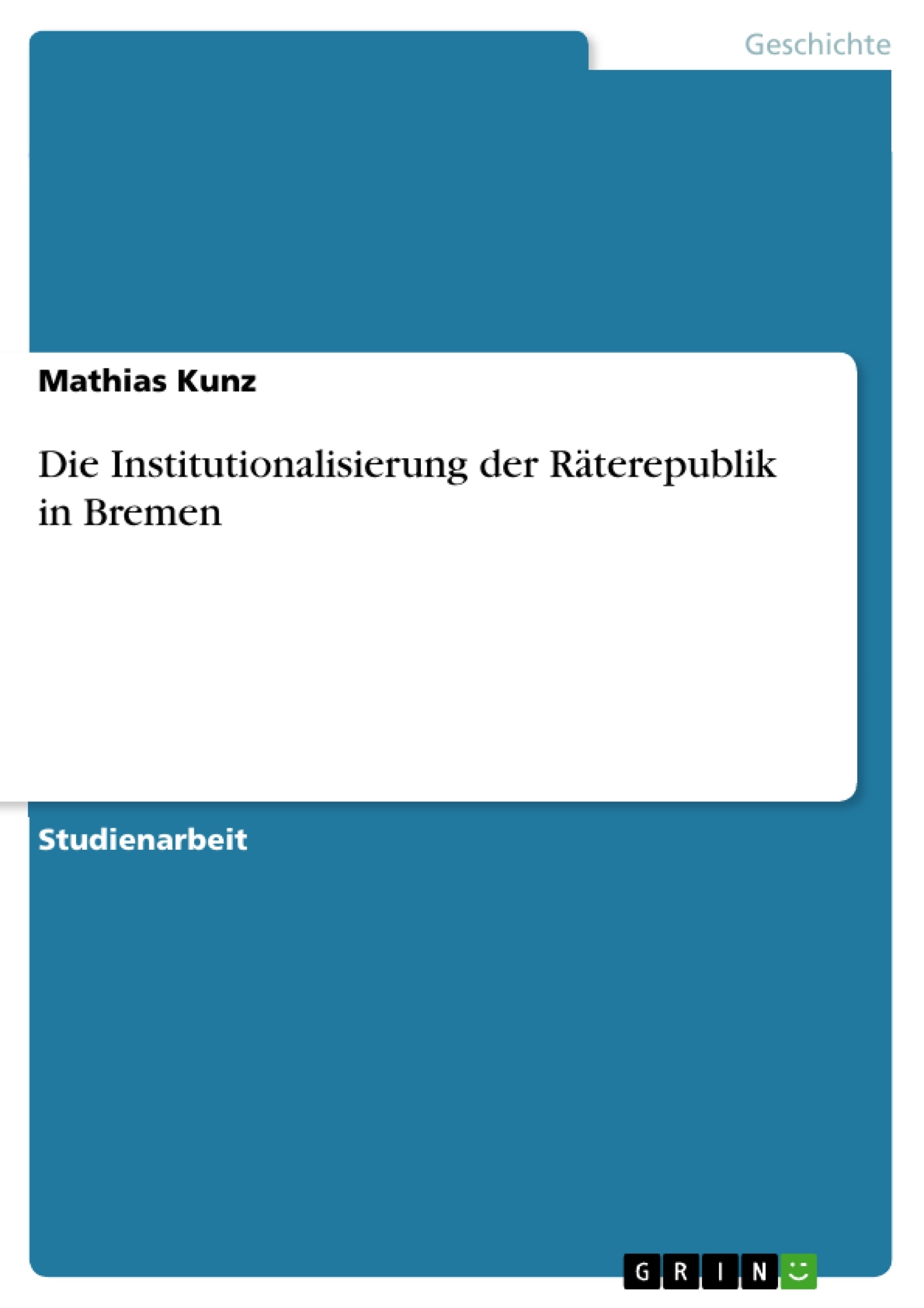Das Rätesystem stellt einen besonderen Staatstyp des 20. Jahrhunderts dar. Hierbei handelt es sich um eine Staatsform, die von sozialistischen Strömungen entwickelt und erstmalig in Russland 1905 institutionalisiert wurde. Der Grundgedanke dieses Systems besteht darin, dass die Gesellschaft aus Teilgruppen besteht, welche sich durch innere Homogenität und eine einheitliche Meinungsbildung auszeichnen. Der Gesamtwille des Gesellschaftsteils wird schließlich in einem Rat zum Ausdruck gebracht. Hierbei sind die einzelnen Vertreter jedoch durch ein imperatives Mandat an den Willen der Basis gebunden. Im Gegensatz zur konstitutionellen Monarchie und zur parlamentarischen Demokratie blieb das Rätesystem jedoch nur eine Randerscheinung, welche sich nicht dauerhaft in Europa etablieren konnte. Dennoch gab es auch im Deutschen Reich Versuche, diese Regierungsform zu institutionalisieren. Diese Versuche erfolgten in den Jahren 1918 und 1919, als die Niederlage im Ersten Weltkrieg tiefe Verzweiflung und Enttäuschung in der deutschen Bevölkerung auslöste und somit kommunistischen Strömungen mehr Auftrieb sowie Rückhalt verschaffte.
In dieser Arbeit geht es explizit um die Fragestellungen, wie die Bremer Räterepublik in der Praxis aussah und wie sie institutionalisiert sowie etabliert werden konnte. Bevor jedoch genauer auf die Institutionalisierung und den Aufbau der Bremer Räterepublik eingegangen wird, soll im hieran anschließenden Kapitel Zwei kurz die Bremer Senatsverfassung vor dem Ausbruch der Revolution erläutert werden. Im Anschluss daran wird chronologisch die Institutionalisierung der Räte untersucht. Dabei rückt zunächst im dritten Kapitel die so genannte Doppelherrschaft in den Fokus der Untersuchung. Daran anschließend beschäftigt sich das vierte Kapitel mit der Ausschaltung des Bremer Senats sowie der Übernahme der alleinigen Regierungsgeschäfte durch die Räte. Das abschließende Kapitel Fünf wird die Ergebnisse dieser Arbeit zusammenfassen und die eingangs gestellten Fragestellungen beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Bremer Senatsverwaltung vor der Revolution
- 3. Von der Militärrevolte vom 6. November bis zum Ende der Doppelherrschaft am 14. November 1918
- 4. Von der Bildung des Zwölferausschusses bis zur Proklamierung der Räterepublik
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Institutionalisierung der Räterepublik in Bremen im Kontext der deutschen Revolution von 1918/1919. Sie untersucht, wie die Räterepublik in der Praxis funktionierte und wie sie sich etablierte. Die Arbeit stützt sich dabei auf die umfassende Forschungsarbeit von Peter Kuckuk und analysiert die Ereignisse in Bremen anhand von Protokollen, Zeitungsartikeln und Dokumenten.
- Die Bremer Senatsverwaltung vor der Revolution
- Die Militärrevolte vom 6. November 1918 und die Etablierung der Doppelherrschaft
- Die Bildung des Zwölferausschusses und die Proklamierung der Räterepublik
- Die Funktionsweise und Struktur der Bremer Räterepublik
- Die Rolle von Arbeiter- und Soldatenräten bei der Etablierung der Räterepublik
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in das Thema der Räterepublik ein und erläutert die Bremer Senatsverwaltung vor dem Ausbruch der Revolution.
- Das zweite Kapitel beschreibt die Militärrevolte vom 6. November 1918, die den Beginn der Revolution in Bremen markierte, sowie die Etablierung der Doppelherrschaft zwischen dem alten Senat und den neu entstandenen Arbeiter- und Soldatenräten.
- Das dritte Kapitel behandelt die Bildung des Zwölferausschusses, der aus Vertretern von Arbeiterräten und dem alten Senat bestand, und die Proklamation der Räterepublik in Bremen.
Schlüsselwörter
Räterepublik, Bremen, Revolution 1918/1919, Arbeiter- und Soldatenräte, Doppelherrschaft, Institutionalisierung, Senatsverwaltung, Peter Kuckuk.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Grundprinzip eines Rätesystems?
Ein Rätesystem basiert auf homogenen Teilgruppen der Gesellschaft, deren Wille durch Vertreter mit imperativem Mandat in einem Rat ausgedrückt wird.
Wann wurde die Bremer Räterepublik ausgerufen?
Die Räterepublik entstand im Zuge der deutschen Revolution 1918/1919, beginnend mit der Militärrevolte am 6. November 1918.
Was versteht man unter der „Doppelherrschaft“ in Bremen?
Unter Doppelherrschaft versteht man die Phase, in der der alte Bremer Senat und die neuen Arbeiter- und Soldatenräte nebeneinander Macht ausübten.
Welche Rolle spielte der Zwölferausschuss?
Der Zwölferausschuss bestand aus Vertretern der Räte und des Senats und war ein entscheidendes Organ im Übergang zur alleinigen Regierungsübernahme durch die Räte.
Warum konnte sich das Rätesystem in Europa nicht dauerhaft etablieren?
Obwohl es Versuche zur Institutionalisierung gab, blieb das System eine Randerscheinung und konnte sich gegenüber der parlamentarischen Demokratie nicht durchsetzen.
- Arbeit zitieren
- Mathias Kunz (Autor:in), 2011, Die Institutionalisierung der Räterepublik in Bremen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175824