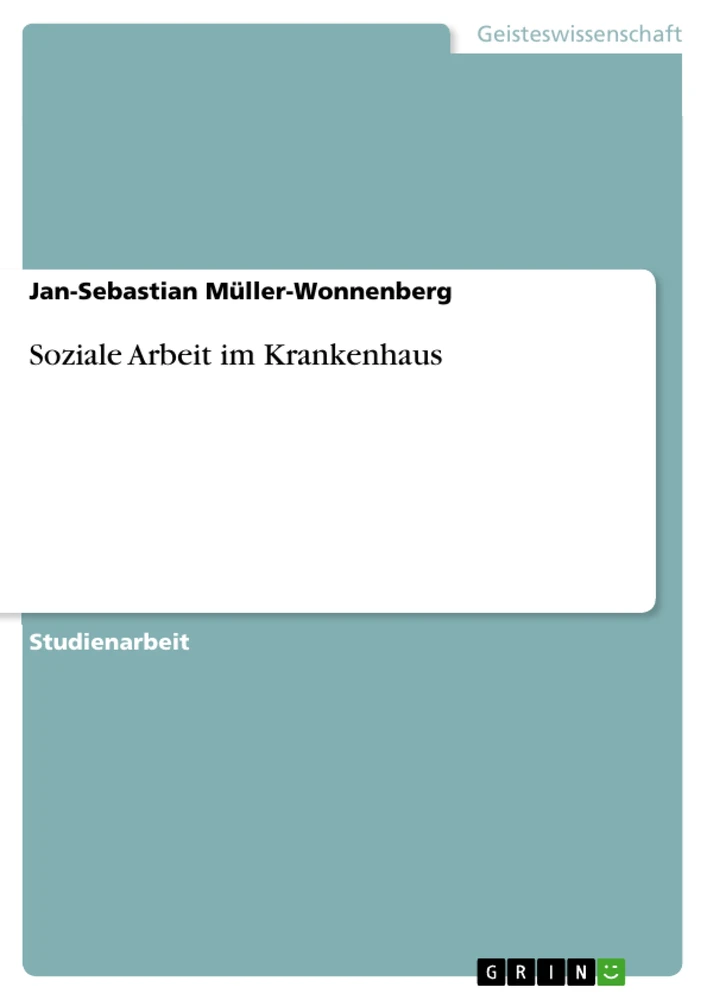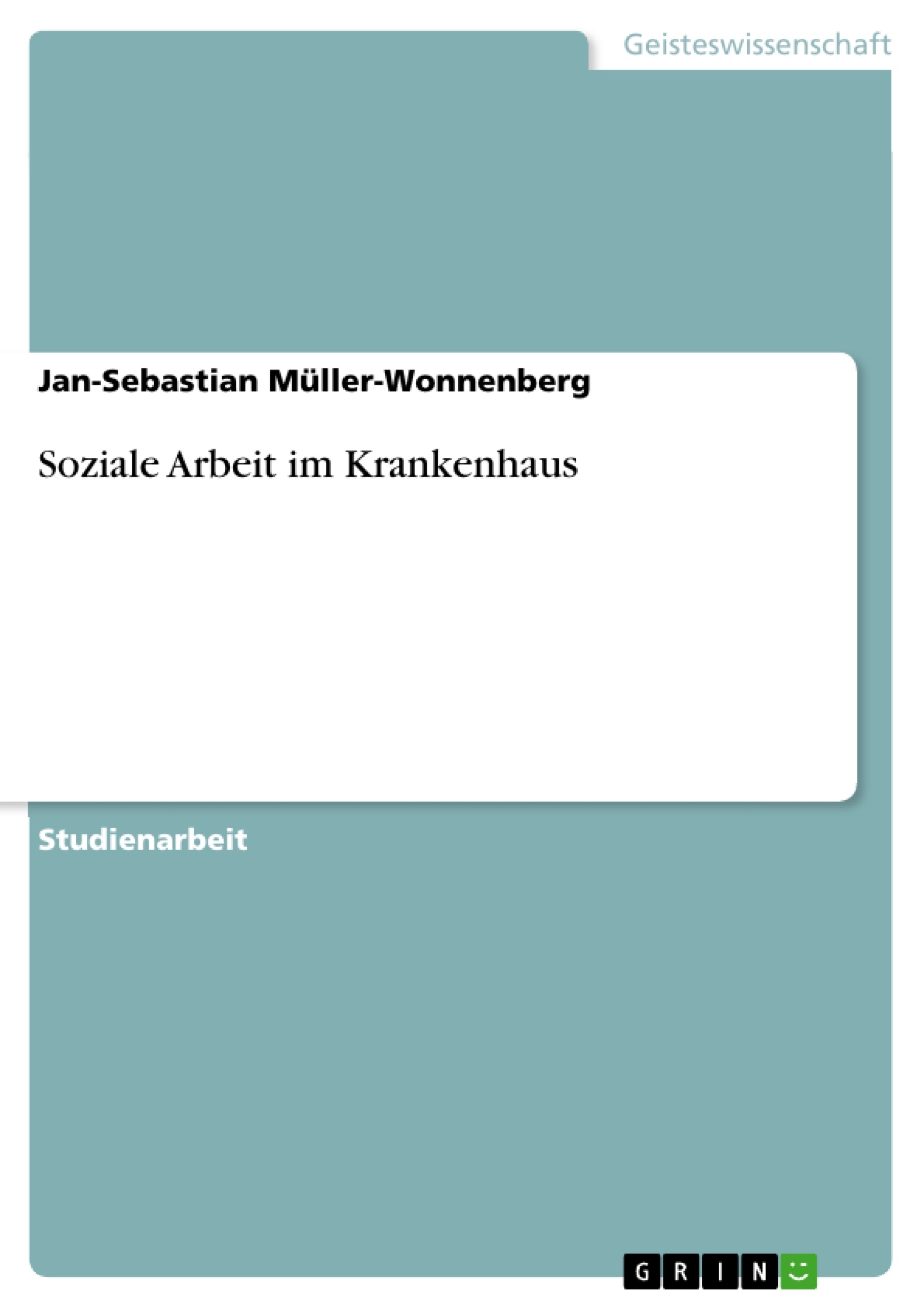Die Soziale Arbeit hat viele Bereiche der Tätigkeit und ist auch im Krankenhaus fester Bestandteil der Dienstleistung am Patienten. Ein Aufenthalt im Krankenhaus kann „nur“ der Heilung mehr oder minder ausgeprägter Krankheiten dienen oder aber krisenhafte Krankheitszustände die der akuten Behandlung bedürfen. Das Krankenhaus ist jedoch auch ein Ort, an dem Diagnosen chronischer Krankheiten gestellt werden. Tritt ein solcher Fall ein ist dies nicht nur eine Frage der Konfrontation mit medizinischen Fakten verbunden, sondern mit Behinderung, existentiellen Ängsten und Ratlosigkeit. In diesen Situationen ist eine beratende und vermittelnde Begleitung besonders wichtig, um über das Procedere weiterer kurativer Maßnahmen zu informieren, auf gesetzliche Rechte und Pflichten hinzuweisen, um auf Ängste einzugehen und vermittelnd weitere Hilfen anzubieten.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit diesen Punkten der Sozialen Arbeit im Krankenhaus und geht zu Beginn auf eine genauere Darstellung der Besonderheiten – die für die soziale Arbeit im Krankenhaus relevant sind – ein. Die Historie der Sozialen Arbeit im Krankenhaus soll ebenfalls beleuchtet werden, um vom geschichtlichen Kontext, eine Brücke zum gegenwärtigen Handeln zu schlagen. Im föderalen Rechtsstaat ist eine Betrachtung der gesetzlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten unablässig, da es einerseits wichtig ist die Rechte der Betroffenen zu kennen, als auch ihre Pflichten. Dies bezieht sich freilich auf die weiterführenden Maßnahmen die durch die Soziale Arbeit vermittelt werden oder die für den Patienten im Krankenhaus von Bedeutung sind.
Am Ende dieser Arbeit werden die Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit betrachtet und ihre hauptsächlich angewendeten Handlungsformen genauer betrachtet. Es werden also die Haupt-Tätigkeitsformen der Sozialen Arbeit im Krankenhaus aufgegliedert und ihr Umgang mit dem Patienten und seines jeweiligen Grundes für seinen Krankenhausaufenthalt unter die Lupe genommen. Der Schluss soll ein kurzes Resümee über die genannten Punkte darbieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Arbeit im Krankenhaus
- 2.1 Definition der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 2.2 Besonderheiten der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 2.2.1 Krankheit
- 2.2.2 Krankheitsbewältigung
- 2.2.3 Kooperationsabläufe der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 3. Geschichte derSozialen Arbeit im Krankenhaus
- 3.1 Anfänge der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 3.2 Soziale Arbeit im Krankenhaus während des Nationalsozialismus
- 3.3 Soziale Arbeit im Krankenhaus nach 1945
- 4. Gesetzliche Grundlagen derSozialen Arbeit im Krankenhaus
- 4.1 Landeskrankenhausgesetze
- 4.2 Gesetze des Bundes
- 5. Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 5.1 Psychosoziale Probleme im Krankenhaus
- 5.2 Beratung
- 5.3 Case-Management
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialen Arbeit im Krankenhaus und betrachtet die Besonderheiten und den historischen Kontext dieses Arbeitsfeldes. Des Weiteren werden die gesetzlichen Grundlagen und die Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, einschließlich der wichtigsten Handlungsformen, beleuchtet.
- Definition und Besonderheiten der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- Historische Entwicklung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Soziale Arbeit im Krankenhaus
- Haupt-Tätigkeitsformen und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- Bedeutung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus im Hinblick auf chronische Erkrankungen und Krankheitsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und erläutert die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, insbesondere im Kontext von chronischen Erkrankungen und deren Bewältigung. Im zweiten Kapitel wird die Soziale Arbeit im Krankenhaus definiert und ihre Besonderheiten im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit herausgestellt. Das dritte Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, angefangen von den Anfängen bis hin zur heutigen Situation. Das vierte Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Das fünfte Kapitel schließlich präsentiert die Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit im Krankenhaus und beleuchtet die wichtigsten Handlungsformen, wie z.B. die Beratung und das Case-Management. Der Schluss soll ein Resümee über die dargestellten Punkte bieten.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Krankenhaus, chronische Erkrankung, Krankheitsbewältigung, Beratung, Case-Management, Kooperation, Gesetze, Landeskrankenhausgesetze, Bundesgesetze, psychosoziale Probleme, Gesundheitswesen, Finanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit im Krankenhaus?
Zu den Hauptaufgaben gehören die psychosoziale Beratung, das Case-Management, die Vermittlung von weiterführenden Hilfen und die Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung.
Wie unterstützt der Sozialdienst Patienten mit chronischen Diagnosen?
Er bietet beratende Begleitung bei existenziellen Ängsten, informiert über gesetzliche Rechte und Pflichten und organisiert die post-stationäre Versorgung.
Welche gesetzlichen Grundlagen sind für die Krankenhaussozialarbeit relevant?
Relevant sind vor allem die Landeskrankenhausgesetze der einzelnen Bundesländer sowie verschiedene Bundesgesetze zur Sozialversicherung.
Was versteht man unter Case-Management im klinischen Bereich?
Case-Management ist die koordinierte Planung und Steuerung aller notwendigen medizinischen und sozialen Hilfen, um einen reibungslosen Übergang nach der Entlassung zu gewährleisten.
Wie hat sich die Soziale Arbeit im Krankenhaus historisch entwickelt?
Die Arbeit beleuchtet die Anfänge des Krankenhaussozialdienstes, die schwierige Phase während des Nationalsozialismus und die Etablierung als fester Bestandteil nach 1945.
- Citar trabajo
- Jan-Sebastian Müller-Wonnenberg (Autor), 2011, Soziale Arbeit im Krankenhaus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175829