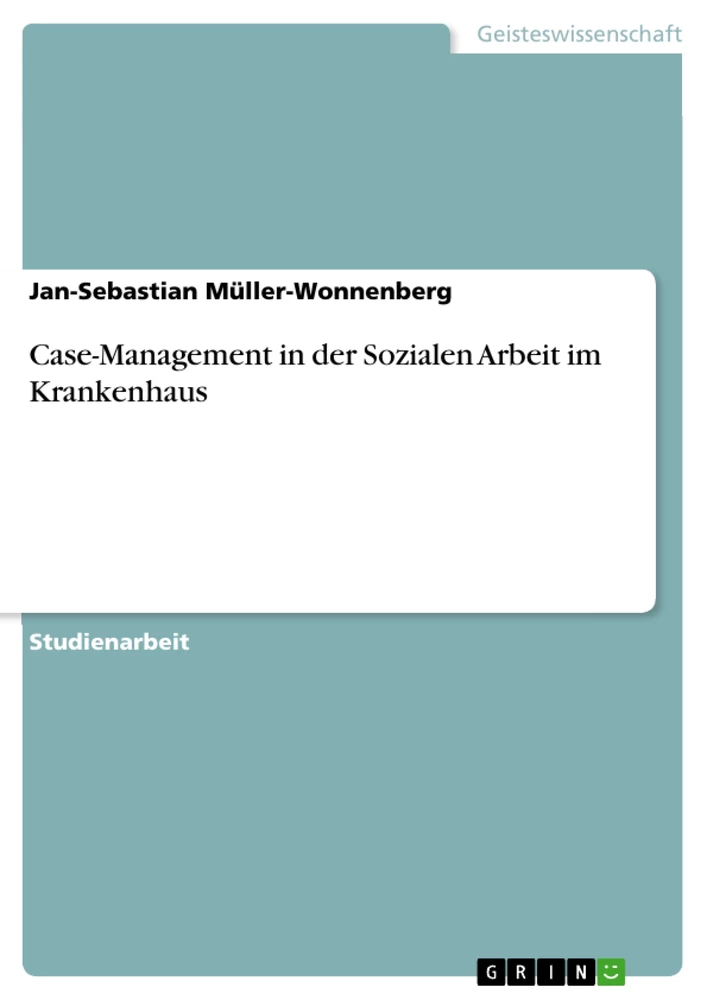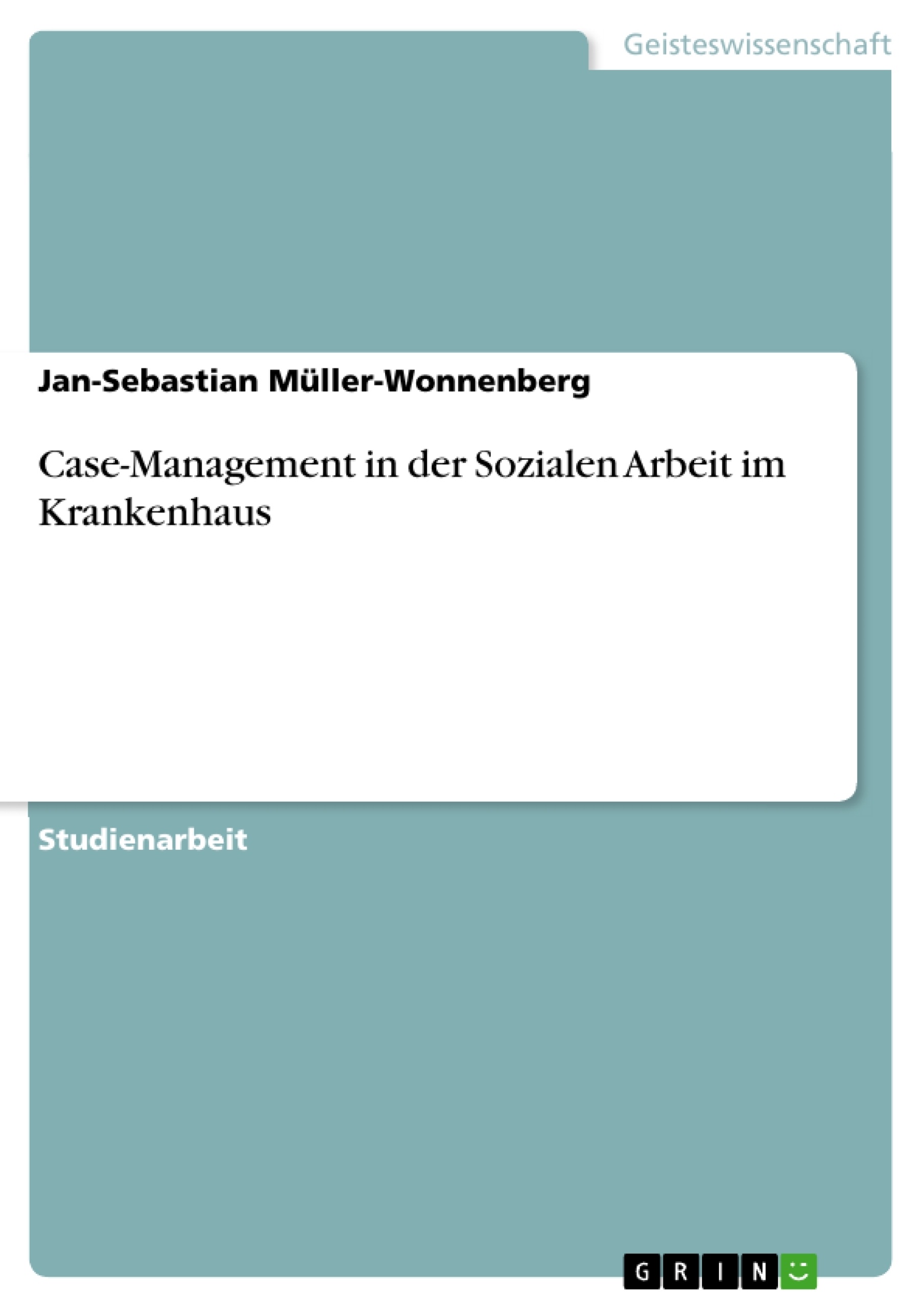Case-Management ist ein wichtiges Instrument in der Sozialen Arbeit. Auch wenn mehrere wichtige Instrumente existieren, die für die professionelles Handeln in diesem Bereich der Tätigkeit wichtig sind, ist das Case-Management für die Betreuung von Einzelfällen unabdingbar; sie erleichtert zudem die Kooperation mit anderen Berufsgruppen, mit denen man im Krankenhaus in jedem Fall zusammenarbeiten wird und ist keine Einzelfallbetreuung an sich. Diese Abhandlung beschäftigt sich mit der genaueren Betrachtung von Case-Management und seiner sprachlichen sowie der damit verbundenen geologischen Herkunft. Auch werden die historische Entwicklung und das Entstehen dieser Handlungsweise betrachtet. Da Management heutzutage ein strapazierter Begriff ist, wird in dieser Arbeit auch eine Abgrenzung des Case-Managements in der Sozialen Arbeit im Krankenhaus vorgenommen – denn Management ist nicht gleich Management. In der Sozialen Arbeit als Wissenschaft wird sämtliches Handeln sehr genau betrachtet und – für jedwelche Wissenschaft usus – das Handeln begründet und hinterfragt. Dazu wird dies im Fortlauf dieser Arbeit in die Grundlagen, die Arbeitsschritte und in generelle Standards unterteilt und unter die Lupe genommen, ohne dabei den Bezug zur Sozialen Arbeit im Krankenhaus zu verlieren. Es folgt dann die Anwendung im Bereich des Akutkrankenhauses, auf die sich der Autor festgelegt hat. Die ausführliche Betrachtung von Fallgruppen soll die Praxisanwendung besser veranschaulichen und das Verständnis fördern. In Zusammenhang dazu ist es interessant, das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit zu beleuchten und zu betrachten. Den Abschluss wird eine kurze Zusammenfassung bilden, die das Wichtigste dem Leser an die Hand geben will, um die Intention des Case-Managements der Sozialen Arbeit im Krankenhaus nochmals zu verdeutlichen und den Leser nicht führungslos mit dieser Thematik zu entlassen. Schließlich ist das Case-Management eine ausgezeichnete Methode, die auch außerhalb der Institution Krankenhaus, aber besonders hier, breite Anwendung findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Case-Management und Begrifflichkeit
- 2.1 Geschichtliche Herkunft
- 2.2 Abgrenzung zu anderen Managementformen
- 3. Ablauf und Vorgehen im Case-Management
- 3.1 Grundlagen des Case-Managements im Krankenhaus
- 3.2 Arbeitsschritte des Case-Managements
- 3.3 Standards des Case-Managements in der Sozialen Arbeit
- 4. Funktionen von Case-Management in der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- 4.1 Praktisches Beispiel der Anwendung
- 4.2 Fallgruppen in der Sozialen Arbeit
- 4.3 Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit analysiert das Case-Management als Instrument der Sozialen Arbeit im Krankenhaus. Sie beleuchtet die Definition und historischen Wurzeln des Case-Managements, die Abgrenzung zu anderen Managementformen sowie die praktischen Arbeitsschritte und Standards. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Case-Managements im Akutkrankenhaus und der Betrachtung von Fallgruppen in der Sozialen Arbeit. Schließlich wird das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen im Kontext des Case-Managements reflektiert.
- Definition und Begrifflichkeit des Case-Managements
- Geschichtliche Entwicklung und Abgrenzung zu anderen Managementformen
- Praxis des Case-Managements im Krankenhaus: Arbeitsschritte und Standards
- Anwendung des Case-Managements in Fallgruppen der Sozialen Arbeit
- Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema Case-Management und die Relevanz für die Soziale Arbeit im Krankenhaus. Kapitel 2 definiert den Begriff "Case-Management" und betrachtet seine historische Entwicklung, wobei die Abgrenzung zu anderen Managementformen thematisiert wird. Kapitel 3 untersucht den Ablauf und die Arbeitsschritte im Case-Management im Krankenhaus, inklusive der relevanten Standards. Kapitel 4 präsentiert die praktische Anwendung des Case-Managements im Krankenhaus, beleuchtet Fallgruppen der Sozialen Arbeit und reflektiert das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen.
Schlüsselwörter
Case-Management, Soziale Arbeit, Krankenhaus, Akutkrankenhaus, Fallgruppen, Standards, Selbstverständnis, Zusammenarbeit, Steuerung, Ressourcenmanagement, Klientenbetreuung, Gesundheitswesen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Case-Management in der Sozialen Arbeit?
Case-Management ist ein Instrument zur Betreuung von Einzelfällen, das die Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen erleichtert und eine strukturierte Steuerung von Ressourcen und Hilfsprozessen ermöglicht.
Warum ist Case-Management im Krankenhaus so wichtig?
Im Krankenhausumfeld ist es für die professionelle Betreuung von Patienten unabdingbar, da es die Zusammenarbeit zwischen medizinischen, pflegerischen und sozialen Diensten koordiniert, insbesondere im Akutbereich.
Welche Arbeitsschritte umfasst das Case-Management?
Der Prozess unterteilt sich in Grundlagen, spezifische Arbeitsschritte und die Einhaltung genereller Standards der Sozialen Arbeit, um eine strukturierte Klientenbetreuung zu gewährleisten.
Wie grenzt sich Case-Management von anderen Managementformen ab?
In der Sozialen Arbeit wird Management nicht rein ökonomisch verstanden; das Handeln wird wissenschaftlich begründet und hinterfragt, wobei der Fokus auf dem individuellen Fall und der sozialen Unterstützung liegt.
Was versteht man unter dem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen?
Es beschreibt die Rolle und die ethische Haltung von Sozialarbeitern bei der Steuerung von Ressourcen und der Unterstützung von Patienten innerhalb des Gesundheitssystems.
- Arbeit zitieren
- Jan-Sebastian Müller-Wonnenberg (Autor:in), 2011, Case-Management in der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175848