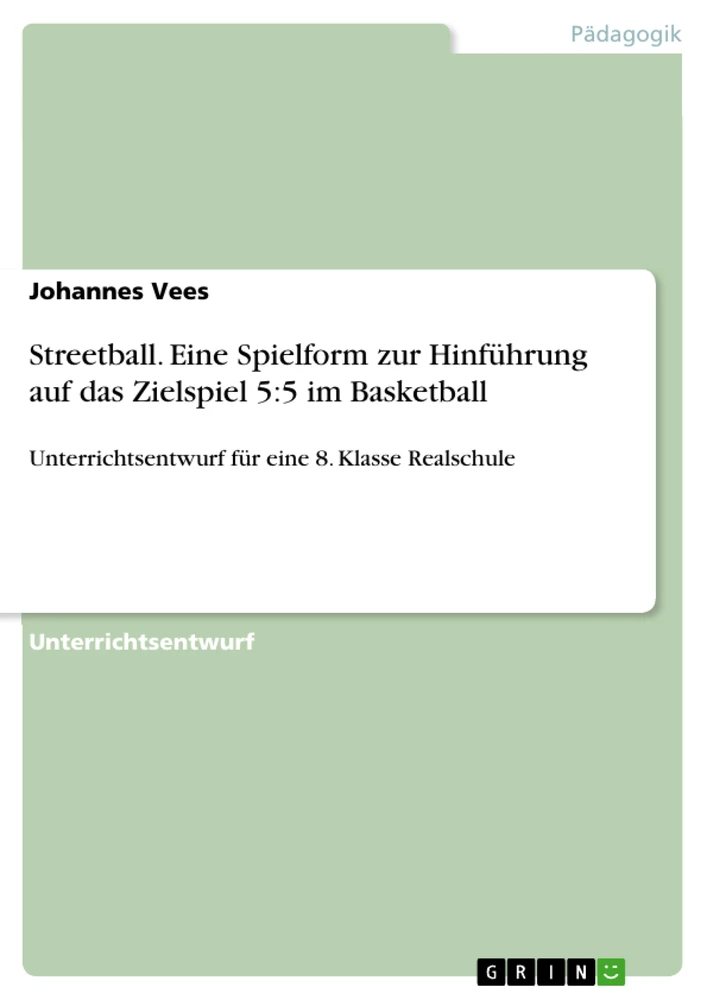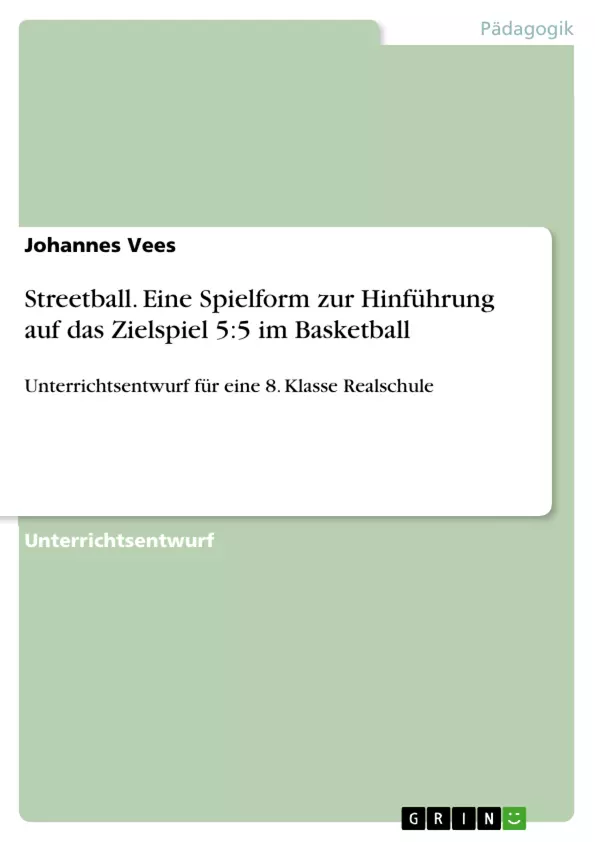Ausführlicher Unterrichtsentwurf im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs des Lehrbeauftragten vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung. Die Stunde wurde in der 8. Klasse einer Realschule gehalten. Sie wurde sehr positiv bewertet.
Basketball zählt neben Fußball, Handball und Volleyball zu den vier Großen Mannschaftsspielen. Die Popularität des Basketballs im Schulsport dürfte auch in den letzten Jahren keine wesentlichen Einbußen erfahren haben. Obwohl es kaum Jugendliche gibt, die schon in der Sekundarstufe I Mitglied in einem Basketballverein sind, steht das Spiel als Trendsport bei vielen Schülern hoch im Kurs. Dies liegt mitunter daran, dass man diese Sportart häufig auch ohne Vereinsmitgliedschaft in der Freizeit ausüben kann, da relativ viele frei zugängliche Basketballkörbe vorzufinden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Institutionelle Voraussetzungen
- Anthropogene Voraussetzungen
- Situation des Anwärters in der Klasse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Bezug zum Bildungsplan
- Bedeutung für die Schüler
- Das Stundenthema innerhalb der Unterrichtseinheit
- Lernziele
- Übergeordnetes Stundenziel
- Fachliche Ziele
- Methodische Ziele
- Soziale, personale, affektive Ziele
- Verlauf der Stunde
- Medien
- Literaturverzeichnis und weitere Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf dient als detaillierte Planung für eine Sportstunde zum Thema Streetball. Er richtet sich an eine 8. Klasse der Realschule und zielt darauf ab, die Schüler spielerisch an das Thema Basketball im 5:5-Spiel heranzuführen. Der Entwurf integriert verschiedene Aspekte der Bedingungsanalyse, Sachanalyse und didaktischen Analyse, um ein effektives und motivierendes Lernumfeld zu schaffen.
- Einleitung in das Thema Streetball
- Entwicklung von spielerischen Fähigkeiten und taktischem Verständnis
- Förderung von sozialem Verhalten und Teamgeist
- Anpassung des Unterrichts an die individuellen Voraussetzungen der Schüler
- Praktische Umsetzung der Lernziele durch Spielformen
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Die Bedingungsanalyse untersucht die institutionellen und anthropogenen Rahmenbedingungen der Sportstunde. Sie beleuchtet die Situation der X-Realschule, ihrer Schüler sowie die Besonderheiten der Sportgruppe, die aus zwei verschiedenen Klassen besteht. Die Analyse berücksichtigt die Heterogenität der Schüler in Bezug auf ihre motorischen Fähigkeiten, ihre sprachlichen Kompetenzen und ihr Sozialverhalten. Zudem wird die Situation des Anwärters als Lehrer in der Klasse beschrieben.
Sachanalyse
Die Sachanalyse bietet eine detaillierte Darstellung des Themas Streetball, seinen Regeln und seiner Bedeutung im Kontext von Basketball. Dieser Abschnitt wird im Text nicht weiter ausgeführt, ist jedoch für die Planung der Stunde und das Verständnis der Spielformen essenziell.
Didaktische Analyse
Die didaktische Analyse untersucht den Bezug des Stundenthemas zum Bildungsplan, die Bedeutung des Themas für die Schüler und die Einordnung des Stundenthemas in die Gesamt-Unterrichtseinheit. Sie legt den Fokus auf die didaktischen Prinzipien und Methoden, die bei der Planung der Sportstunde angewandt werden.
Lernziele
Dieser Abschnitt definiert die übergeordneten Stundenziele, die fachlichen, methodischen und sozialen Ziele, die während der Stunde erreicht werden sollen. Die Lernziele dienen als Leitfaden für die Planung der Stunde und die Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden.
Verlauf der Stunde
Der Verlauf der Stunde beschreibt die einzelnen Phasen der Unterrichtsstunde, inklusive ihrer Inhalte, Methoden und Materialien. Er bietet einen konkreten Plan für die Durchführung der Stunde und dient als Orientierung für den Lehrer.
Medien
Der Abschnitt „Medien“ listet die Materialien auf, die für die Durchführung der Stunde benötigt werden. Dies kann Sportgeräte, Spielmaterialien, Hilfsmittel für die Visualisierung oder andere relevante Materialien umfassen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter im Kontext des Unterrichtsentwurfs sind: Streetball, Basketball, Spielformen, Sportunterricht, heterogene Lerngruppe, Klassenmanagement, Bildungsplan, Lernziele, Didaktik, Methoden, Medien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Streetball und wie unterscheidet es sich von Basketball?
Streetball ist eine informelle Spielform des Basketballs, die oft auf nur einen Korb gespielt wird. Es legt mehr Wert auf individuelles Geschick und Kreativität und ist als Trendsport bei Jugendlichen sehr beliebt.
Warum eignet sich Streetball zur Hinführung zum 5:5 Spiel?
Durch kleinere Teams und vereinfachte Regeln haben Schüler mehr Ballkontakte, was die Spielfähigkeit, das taktische Verständnis und die Motivation für das klassische Basketballspiel fördert.
Welche Lernziele verfolgt dieser Unterrichtsentwurf?
Die Ziele umfassen fachliche Fähigkeiten (Dribbling, Wurf), methodische Kompetenzen (Spielorganisation) sowie soziale Ziele wie Teamgeist und Fairplay in einer heterogenen Gruppe.
Wie geht man mit heterogenen Sportgruppen in der 8. Klasse um?
Der Entwurf berücksichtigt unterschiedliche motorische Voraussetzungen und nutzt Spielformen, die eine individuelle Förderung ermöglichen, ohne den Spielfluss für die gesamte Gruppe zu unterbrechen.
Welche Rolle spielt Basketball im heutigen Schulsport?
Basketball gehört zu den vier großen Mannschaftsspielen und genießt hohe Popularität, da es durch viele frei zugängliche Körbe auch im Freizeitbereich der Schüler präsent ist.
- Quote paper
- Johannes Vees (Author), 2010, Streetball. Eine Spielform zur Hinführung auf das Zielspiel 5:5 im Basketball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175877