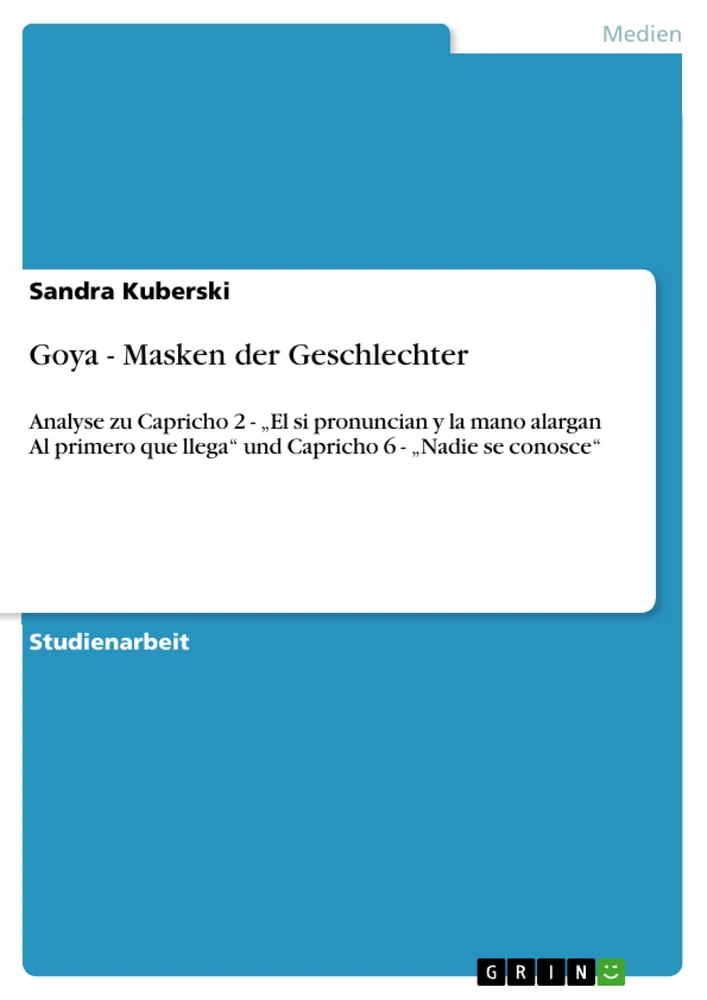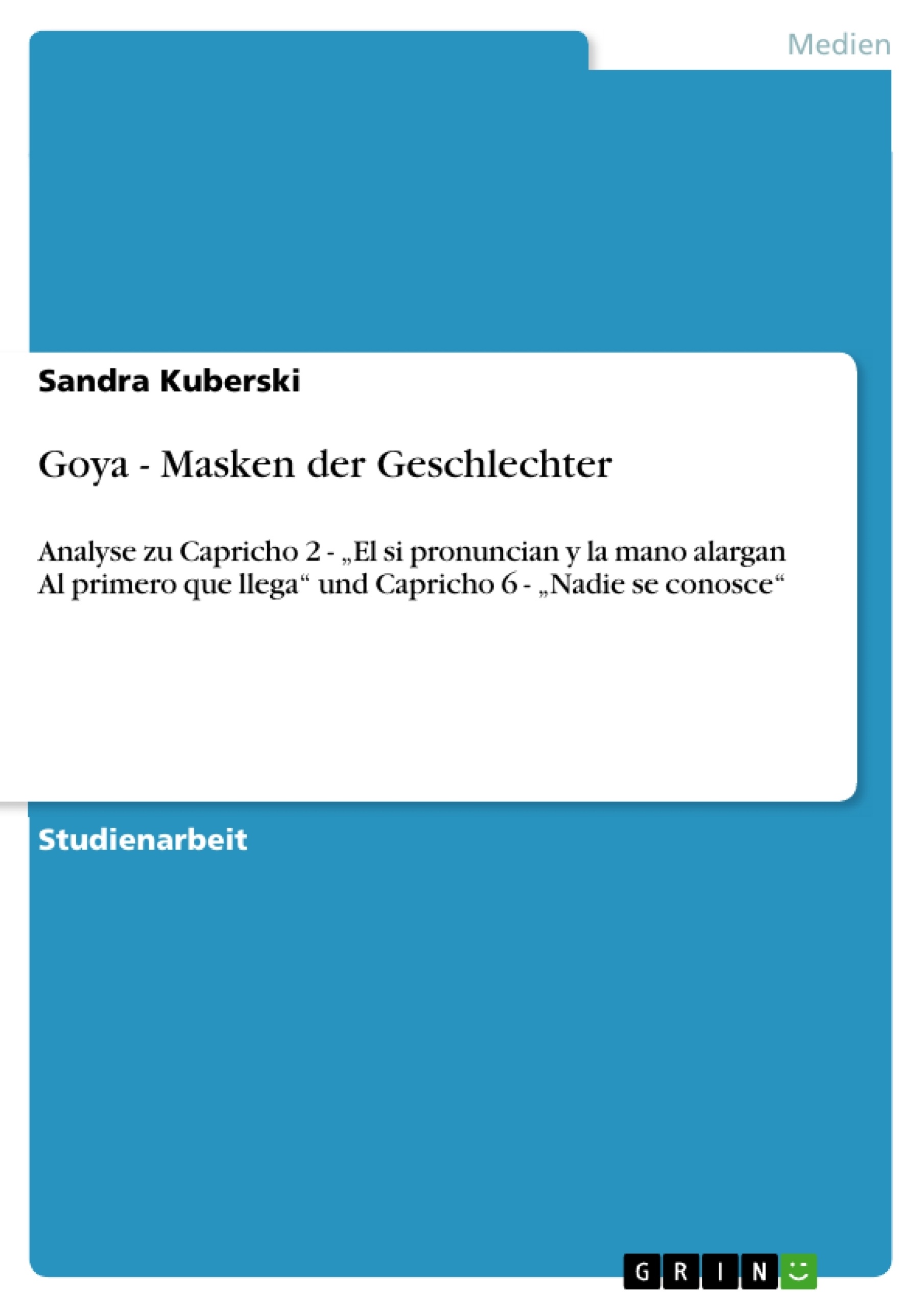Bis heute gilt der spanische Maler und Grafiker Francisco José de Goya (1746-1828) als einer der Künstler am Übergang des 18. zum 19. Jahrhunderts und setzte mit seinen Werken moderne Maßstäbe für die gesamte europäische Kunstwelt. Sein Gesamtwerk reicht von der Hofmalerei bis hin zu privat angefertigten Aquatinta-Radierungen, die von hoher Qualität zeugen und das Kunstpublikum bis in das heutige Jahrhundert faszinieren und beschäftigen.
In seiner Zeit am spanischen Hof ab 1786 fertigte Goya zahlreiche Porträts adeliger Auftragsgeber an. Von der Porträtmalerei allerdings entfernt er sich in seinen sogenannten Caprichos (span. „Launen“): die dargestellten Figuren sind Archetypen, die auf die gesamte Gesellschaft bezogen werden können. Diese wirken ebenso wie die dargestellten Situationen nur auf den ersten Blick „normal“ und „alltäglich“. Goya kratzt mit seinen satirischen Motiven unter der Oberfläche des Menschen und zeigt verborgene Laster. Goya bewirbt seine Caprichos am 6. Februar 1799 mit einer Zeitungsannonce. Die Zielsetzung der Caprichos „ist didaktischer und moralisierender Natur. Der Künstler erläuterte, daß er sich die Aufgabe gestellt habe, aus der Masse der in jeder bürgerlichen Gesellschaft verbreiteten Torheiten und Fehler, aus den durch Brauchtum, Unwissenheit oder Eigennutz gutgeheißenen Vorurteilen und Lügen jene auszuwählen, die sich am ehesten bloßstellen ließen und der schöpferischen Phantasie des Künstlers den weitesten Raum boten. Er wolle unsere Augen öffnen und unsere Entrüstung wecken. Die Absicht der Platten stimmt daher vollkommen mit den Zielen der Aufklärung überein, das Böse durch Belehrung und Erziehung auszurotten.“
Ziel der Arbeit soll es sein, anhand von Capricho 2 („El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega“) und Capricho 6 („Nadie se conosce“) aufzuzeigen, wie Goya mit der Wahrnehmung des Betrachters spielt und diesen gezielt in seine Werke einarbeitet. Desweiteren soll beleuchtet werden, wie er auf die Vorstellungen, die jeder Betrachter mit sich bringt, in seinen Bilder reagiert. Die zu untersuchenden Caprichos stehen ganz am Anfang des Zyklus, welcher insgesamt 80 Aquatinta-Radierungen umfasst. Die ersten Darstellungen, von Capricho 2 („El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega“) bis hin zu Capricho 36 („Mala Noche“), sind noch recht dicht an der der Genremalerei und zeigen somit zwar alltägliche, aber auf den zweiten Blick doch absonderliche Situationen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu Capricho 2: „El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega“
- Zu Capricho 6: „Nadie se conoce“
- Interpretation
- Lenkung des Betrachters durch die Darstellung
- Der Betrachter, seine Wahrnehmung und die Mehrdeutigkeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie Goya in seinen Caprichos 2 und 6 die Wahrnehmung des Betrachters lenkt und dessen Vorwissen in seine Werke integriert. Es wird analysiert, wie Goya auf die individuellen Vorstellungen des Betrachters reagiert und Mehrdeutigkeit in seinen Bildern erzeugt.
- Die Rolle des Betrachters in Goyas Caprichos
- Die satirische Darstellung gesellschaftlicher Normen und Konventionen
- Die Ambivalenz der Geschlechterrollen in Goyas Werk
- Die Verwendung von Masken und Symbolen zur Charakterisierung
- Die Interpretation von Mehrdeutigkeit in Goyas Bildern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Gesamtwerk Goyas ein, hebt dessen Bedeutung am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert hervor und konzentriert sich auf die Caprichos als satirische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Missständen. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Interaktion zwischen Goyas Werken und der Wahrnehmung des Betrachters anhand der Caprichos 2 und 6. Die Einleitung betont den didaktisch-moralisierenden Anspruch der Caprichos und deren Einbettung in den Kontext der Aufklärung.
Zu Capricho 2: „El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega“: Capricho 2, „Sie sprechen das Jawort und reichen ihre Hand dem Erstbesten“, zeigt eine Hochzeitsszene, die Goya mit viel Detailreichtum und subtiler Kritik darstellt. Die Braut trägt zwei Masken – eine schwarze, die ihre Augen verbirgt, und eine lächelnde, die ihre wahren Gefühle verschleiert. Der Bräutigam ist ein alter, unattraktiver Mann, der die Braut eher als Trophäe denn als Partner sieht. Der Hintergrund zeigt eine unruhige Menschenmenge, die die Ambivalenz der Situation unterstreicht. Goyas Zitat aus Jovellanos’ Gedicht „A Ernesto“ betont die finanziellen und politischen Motive hinter solchen Ehen. Goya zeigt jedoch nicht nur die Habgier der Frau, sondern auch des Mannes, hinterfragt somit die gesellschaftlichen Zwänge und die versteckten Motive der Beteiligten. Die Mehrdeutigkeit des Bildes erlaubt dem Betrachter, verschiedene Interpretationen zu entwickeln und die gesellschaftlichen Mechanismen zu hinterfragen.
Schlüsselwörter
Goya, Caprichos, Betrachterrolle, Geschlechterrollen, Satire, Aufklärung, Mehrdeutigkeit, Masken, Symbolanalyse, gesellschaftliche Kritik, Hochzeit, Archetypen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Goyas Caprichos 2 und 6
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goyas Caprichos 2 und 6, wobei der Fokus auf der Lenkung der Betrachterwahrnehmung und der Integration von Vorwissen in die Werke liegt. Es wird untersucht, wie Goya Mehrdeutigkeit erzeugt und auf die individuellen Vorstellungen des Betrachters reagiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des Betrachters in Goyas Caprichos, die satirische Darstellung gesellschaftlicher Normen und Konventionen, die Ambivalenz der Geschlechterrollen, die Verwendung von Masken und Symbolen zur Charakterisierung und die Interpretation von Mehrdeutigkeit in Goyas Bildern.
Welche Caprichos werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei spezifische Caprichos: Capricho 2 („El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega“) und Capricho 6 („Nadie se conoce“). Die Analyse von Capricho 2 bildet einen Schwerpunkt.
Wie wird Capricho 2 analysiert?
Capricho 2 wird als Hochzeitsszene interpretiert, die Goya mit viel Detailreichtum und subtiler Kritik darstellt. Die Analyse fokussiert auf die Masken der Braut, die den Betrachter zur Interpretation der wahren Gefühle auffordern, den unattraktiven Bräutigam, die unruhige Menschenmenge im Hintergrund und die politischen und finanziellen Motive hinter der Ehe, wie sie in einem Zitat aus Jovellanos’ Gedicht „A Ernesto“ angedeutet werden. Die Mehrdeutigkeit des Bildes und die daraus resultierenden verschiedenen Interpretationen werden hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Capricho 2 und Capricho 6, ein Interpretationskapitel (mit den Unterpunkten „Lenkung des Betrachters durch die Darstellung“ und „Der Betrachter, seine Wahrnehmung und die Mehrdeutigkeit“) und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goya, Caprichos, Betrachterrolle, Geschlechterrollen, Satire, Aufklärung, Mehrdeutigkeit, Masken, Symbolanalyse, gesellschaftliche Kritik, Hochzeit, Archetypen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Goya in seinen Caprichos die Wahrnehmung des Betrachters lenkt und dessen Vorwissen in seine Werke integriert. Sie analysiert, wie Goya Mehrdeutigkeit in seinen Bildern erzeugt und auf die individuellen Vorstellungen des Betrachters reagiert.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in Goyas Gesamtwerk ein, hebt dessen Bedeutung im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert hervor und konzentriert sich auf die Caprichos als satirische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Missständen. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und betont den didaktisch-moralisierenden Anspruch der Caprichos und deren Einbettung in den Kontext der Aufklärung.
- Arbeit zitieren
- Sandra Kuberski (Autor:in), 2011, Goya - Masken der Geschlechter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175899