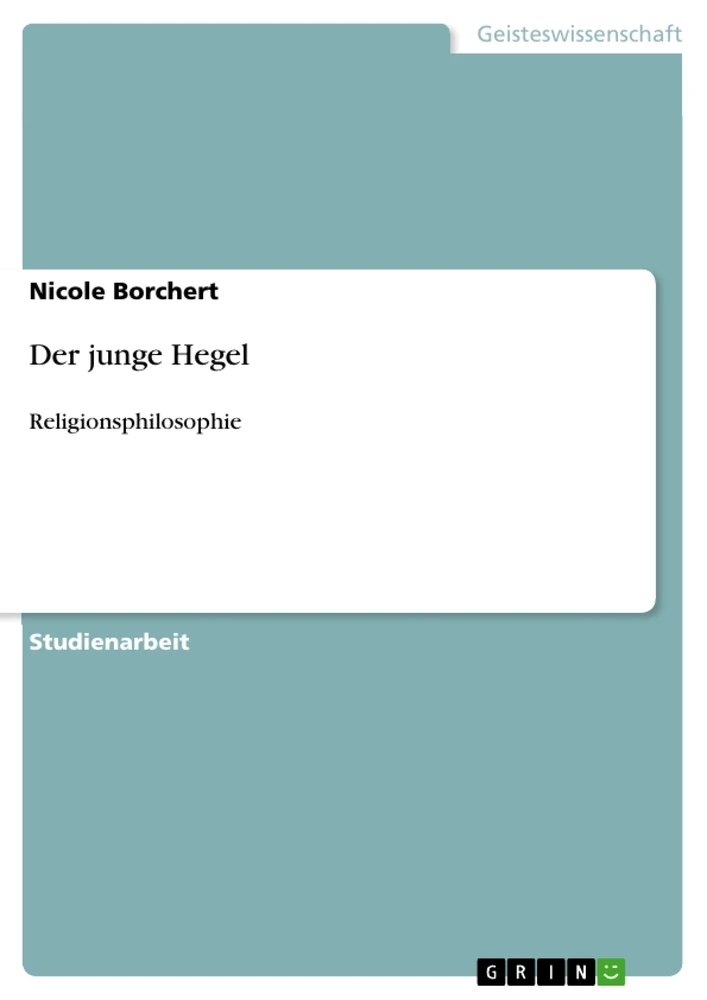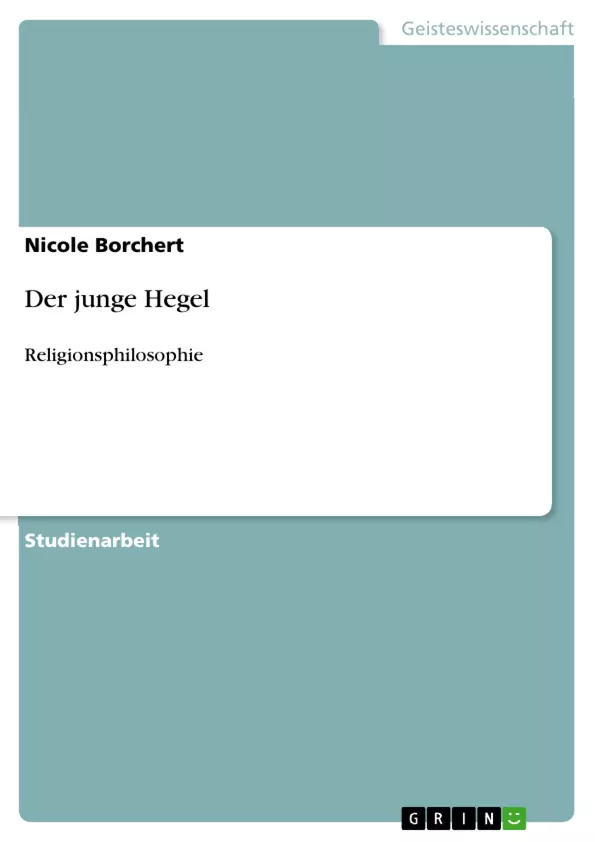1.1 Religionsbegriff bei Kant
Zentral in Kants Religionsschrift "Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" ist der Begriff der Moral. Der Mensch als vernünftiges beziehungsweise als grundsätzlich vernunftfähiges Wesen ist durch den Gebrauch der eigenen Vernunft in der Lage, moralisch zu handeln. Hierfür bedarf es nach Kant keiner Religion. Wir haben das moralische Gesetz sozusagen in uns, wir benötigen folglich keine äußere Instanz, die unserem Willen ein Gesetz geben muss.
In der ersten Vorrede zu seiner Religionsschrift betont Kant in diesem Zusammenhang die Autonomie der Vernunft und den Umstand, dass der Mensch eben keiner Religion bedarf, um moralisch zu sein. Das kantische Sittengesetz begründet demzufolge unsere Freiheit, da die Moralität keine andere Triebfeder als eben das selbst auferlegte Gesetz benötigt, welches wir Kraft unseres Gebrauchs von der praktischen Vernunft besitzen. In diesem Kontext verweist Kant darauf, dass die Moral, da sie aus dem autonomen Subjekt selbst heraus wirkt, keine Zwecksetzung braucht und als solche abstrakt ist. Wäre durch Religion ein Zweck a priori gegeben, widerspräche dies dem Sittengesetz nach Kant. Folglich darf Moral keine Zwecksetzung beinhalten. Dennoch muss eine Beziehung zu einem Zweck bestehen, um Moral wirksam werden zu lassen. Nach Kant brauchen wir eine gewisse Zweckvorstellung, weil die Moral sonst zu abstrakt wäre und keinen Bezug zur wahren Welt, also zu realen Phänomenen hätte.
Zu Beginn seiner Abhandlung macht Kant in diesem Sinne sehr deutlich, dass Religion und Religiösität keine Bedingung für moralisches Handeln darstellt, da das Sittengesetz als formale Bedingung für den Gebrauch der individuellen Freiheit keinen materiellen Bestimmungsgrund bedarf. Dennoch führt Moral nach Kant zur Religion, er gesteht demnach notwendige Berührungspunkte zu. Moral erweitert sich in diesem Sinne in der Religion zu einem moralischen Gesetzgeber, sprich zu einer Idee, die außerhalb des Menschen gesetzt ist.
Auf diese Weise betrachtet Kant die „Idee des höchsten Gutes“ als moralischen Endzweck, welcher durch eine Religion im Sinne einer Vernunftreligion erreicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Frage 1: Vergleich des Religionsbegriffs bei Kant und Hegel
- 1.1 Religionsbegriff bei Kant
- 1.2 Vergleich: Religionsbegriff bei Hegel
- Frage 2: Transformationen des Begriffs „Liebe“ bei Hegel
- 2.1 Fragmente über Volksreligion und Christentum
- 2.2 Vergleich: Entwürfe über Religion und Liebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Religionsphilosophie Immanuel Kants und Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Ziel ist es, den Religionsbegriff beider Denker zu vergleichen, insbesondere in Bezug auf Moral und Vernunft. Darüber hinaus werden die Transformationen des Begriffs „Liebe“ in Hegels frühen Schriften untersucht.
- Vergleich des Religionsbegriffs bei Kant und Hegel
- Die Rolle der Moral in der Religion
- Die Bedeutung der Vernunft für die Religion
- Transformationen des Begriffs „Liebe“ bei Hegel
- Verbindung von Religion und Sinnlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Frage 1: Vergleich des Religionsbegriffs bei Kant und Hegel
Dieses Kapitel untersucht Kants Religionsschrift und Hegels Fragmente über Volksreligion und Christentum. Es analysiert die zentrale Rolle der Moral im kantischen Religionsverständnis und vergleicht Kants Betonung der Vernunft und Autonomie mit Hegels Schwerpunkt auf die Gesellschaftliche Bedeutung der Religion.
Frage 2: Transformationen des Begriffs „Liebe“ bei Hegel
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Begriffs „Liebe“ in Hegels Schriften, von den Fragmenten über Volksreligion und Christentum bis zu den Entwürfen über Religion und Liebe. Es untersucht die Veränderung dieses Begriffs und die Gründe für diese Transformation.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Religionsphilosophie, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Moral, Vernunft, Religion, Liebe, Volksreligion, Christentum, Fragmente, Entwürfe.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Kant den Zusammenhang zwischen Moral und Religion?
Für Kant benötigt der Mensch keine Religion, um moralisch zu handeln, da das Sittengesetz aus der autonomen Vernunft stammt. Moral führt jedoch letztlich zur Idee eines göttlichen Gesetzgebers.
Was unterscheidet Hegels Religionsbegriff von dem Kants?
Während Kant die Moral und individuelle Vernunft betont, legt der junge Hegel in seinen frühen Schriften mehr Gewicht auf die gesellschaftliche Bedeutung und die "Volksreligion".
Welche Rolle spielt der Begriff "Liebe" in Hegels Frühwerk?
Hegel untersucht die Liebe als ein bindendes Element, das über die rein abstrakte Vernunft hinausgeht und eine Einheit in der religiösen Erfahrung ermöglicht.
Was versteht Hegel unter einer "Volksreligion"?
Eine Volksreligion ist für den frühen Hegel eine lebendige, in der Kultur und dem Empfinden des Volkes verwurzelte Religion, im Gegensatz zu einer rein dogmatischen "Verstandesreligion".
Warum ist Kants Sittengesetz "autonom"?
Es ist autonom, weil es keine äußere Instanz benötigt; der Mensch gibt sich das Gesetz Kraft seiner praktischen Vernunft selbst.
Wie transformiert sich der Liebesbegriff bei Hegel?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung von den "Fragmenten über Volksreligion" hin zu den "Entwürfen über Religion und Liebe", wobei die Verbindung von Sinnlichkeit und Geist zentral ist.
- Citation du texte
- Nicole Borchert (Auteur), 2011, Der junge Hegel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175901