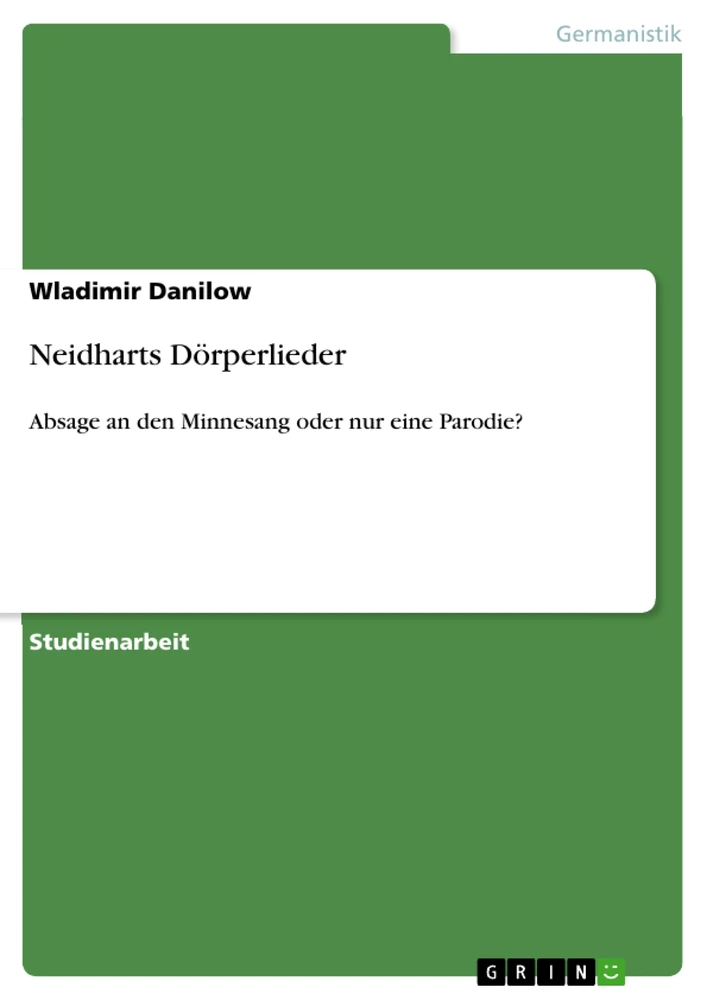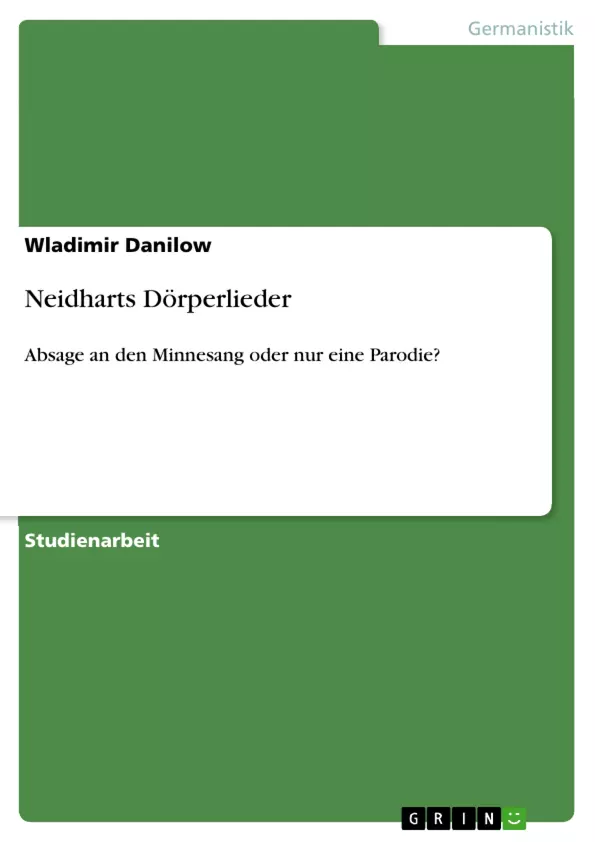Der Minnesang stellte eine der typischsten Erscheinungen der höfischen literarischen Kultur des Mittelalters. Das Leitmotiv dieser Lieder war oft die unerwiderte Liebe des Sängers zu einer Dame. Wie auch immer der Sänger die Schönheit seiner Angebeteten zu preisen versuchte, stets blieb die Reaktion der vornehmen Dame gleich – die Zuneigung wurde nicht erwidert, worauf der Sänger natürlich verletzt reagierte und des öfteren seinem Minnedienst abschwor. Die Handlung spielte sich meistens am Hofe ab und beide, der todtraurige Sänger und seine unerwiderte Liebe, kamen aus den Adelskreisen, wenn auch nicht immer aus gleich hohen. Vorgetragen wurden solche Lieder ebenfalls am Hofe und dienten wohl der Unterhaltung der feinen Gesellschaft. Die bedeutendsten Minnesangdichter waren unter anderem Der Kürenberger, Hartmann von Aue, Walther von der Vogelweide, Konrad von Würzburg oder Der Tannhäuser. Im 13. Jahrhundert änderten sich mit Neidhart Motive und Thematik des höfischen Minnelieds. Neidhart verlagerte die Handlungen des typischen Minnelieds vom Hofe in eine bäuerliche Dorfwelt und schuf damit eine neue Gattung, das sogenannte dörper-Lied. In der vorliegenden Arbeit soll diese neue Gattung vorgestellt und beschrieben werden. Neidharts Lieder weisen immer wiederkehrende Merkmale und Strukturen auf, die im nächstfolgenden Kapitel erläutert werden sollen. Im Kapitel 3 sollen die neuen Protagonisten und Motive näher betrachtet werden. Es sind ja, wie bereits erwähnt, nicht mehr Angehörige der erlesenen höfischen Kreise, sondern die aus der damaligen Sicht eher die primitive und einfache Dorfbevölkerung. Das Verhältnis zwischen der Angebeteten und dem Sänger und das zwischen den Dörpern und dem Sänger, ebenso wie die vielfältigen erotischen Motive, die durch ihre Direktheit die zaghaften Anspielungen des klassischen Minnelieds weit hinter sich lassen, sollen an Hand von einigen ausgewählten Bespielen aus Neidharts Liedern vorgestellt und analysiert werden. Im letzten Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, für wen Neidhart seine Lieder dichtete und welche Position diese neue Gattung gegenüber der alten eingenommen hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charakteristische Merkmale des Dörperlieds
- Natureingang
- Sommerlied
- Winterlied
- „Klassische“ Motive im Dörperlied
- Darstellung der Dörper
- Erotische Motive
- Fazit: An wen richtete Neidhart seine Dörperlieder und mit welcher Intention?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der neuen Gattung des „Dörperlieds“, die Neidhart im 13. Jahrhundert als Abkehr vom klassischen Minnesang etablierte. Sie analysiert die charakteristischen Merkmale, Motive und Strukturen dieser Liedform und beleuchtet, wie Neidhart durch die Verlagerung der Handlung in die bäuerliche Dorfwelt die traditionelle höfische Minnedichtung parodierte oder sogar ablehnte.
- Charakteristische Merkmale des Dörperlieds
- Darstellung der Dörper in den Liedern
- Erotische Motive und ihre Abgrenzung zum klassischen Minnesang
- Neidharts Intention und Zielgruppe
- Die Einordnung des Dörperlieds in den Kontext des Minnesangs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Minnesang als dominierende literarische Form des Mittelalters vor und beleuchtet die typischen Motive und die höfische Tradition dieser Gattung. Die Arbeit fokussiert auf die Veränderung dieser Tradition durch Neidhart und seine Einführung des Dörperlieds.
Charakteristische Merkmale des Dörperlieds
Dieses Kapitel analysiert die wiederkehrenden Merkmale des Dörperlieds, darunter der obligatorische Natureingang, die Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterliedern sowie die jeweils typischen Themen und Motive.
„Klassische“ Motive im Dörperlied
Das Kapitel beleuchtet die Darstellung der Dörper und die erotischen Motive in Neidharts Liedern. Es stellt heraus, wie Neidhart durch die direkte und unverstellte Darstellung der bäuerlichen Lebenswelt eine Abgrenzung zum klassischem Minnesang vollzieht.
Fazit: An wen richtete Neidhart seine Dörperlieder und mit welcher Intention?
Das Kapitel erörtert Neidharts Intention beim Dichten der Dörperlieder und die mögliche Zielgruppe. Es wird diskutiert, ob die Lieder eine Parodie auf den höfischen Minnesang darstellen oder eine bewusst gewählte, alternative Form der Liebesdichtung.
Schlüsselwörter
Dörperlied, Neidhart, Minnesang, höfische Literatur, bäuerliche Lebenswelt, Parodie, Abgrenzung, Erotik, Sommerlied, Winterlied, Natureingang, Motiv, Struktur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Dörperlied“?
Ein Dörperlied ist eine von Neidhart geschaffene Gattung, die Motive des höfischen Minnesangs in eine bäuerliche Dorfwelt (Dörper = Dörfler) verlagert.
Wie unterscheidet sich Neidharts Lyrik vom klassischen Minnesang?
Während der klassische Minnesang idealisierte Liebe am Hofe thematisiert, nutzt Neidhart eine direktere, oft erotische Sprache und siedelt die Handlung im bäuerlichen Milieu an.
Welche charakteristischen Merkmale haben Neidharts Lieder?
Typisch sind der Natureingang sowie die Einteilung in Sommerlieder (Tanz im Freien) und Winterlieder (Tanz in der Stube).
Wer war die Zielgruppe für Neidharts Dörperlieder?
Die Lieder wurden am Hofe vorgetragen und dienten der Unterhaltung der feinen Gesellschaft, oft als Parodie auf die bäuerliche Lebensweise.
Welche Rolle spielen erotische Motive in diesen Liedern?
Neidharts erotische Motive sind deutlich direkter und weniger zaghaft als die Anspielungen im klassischen Minnelied, was den Kontrast zwischen Hof und Dorf betont.
- Citar trabajo
- M.A. Wladimir Danilow (Autor), 2011, Neidharts Dörperlieder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175951