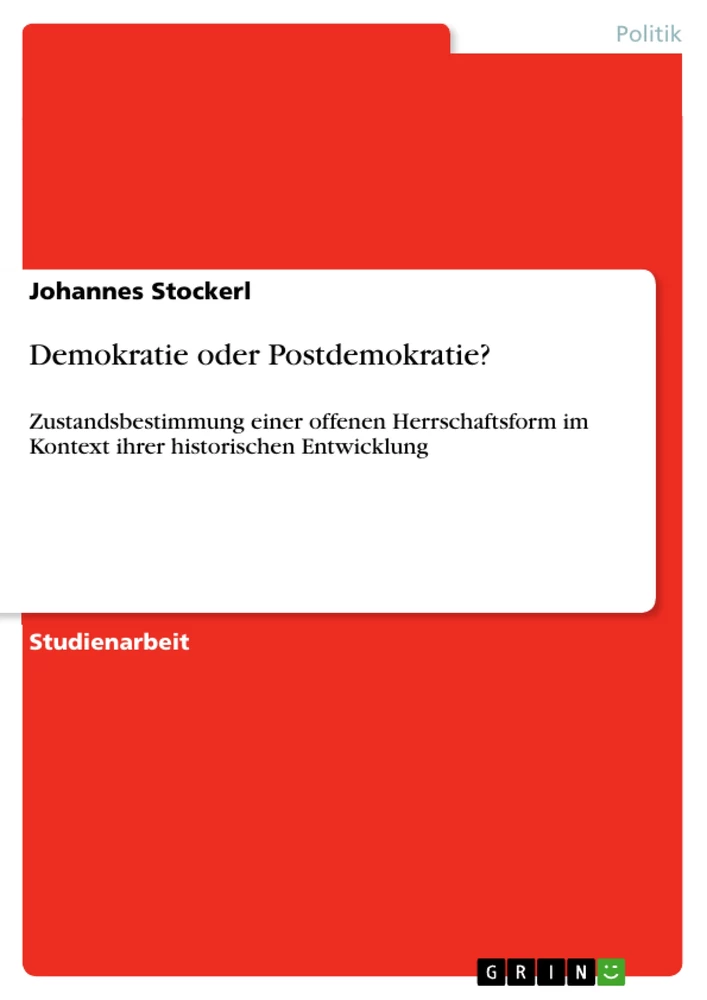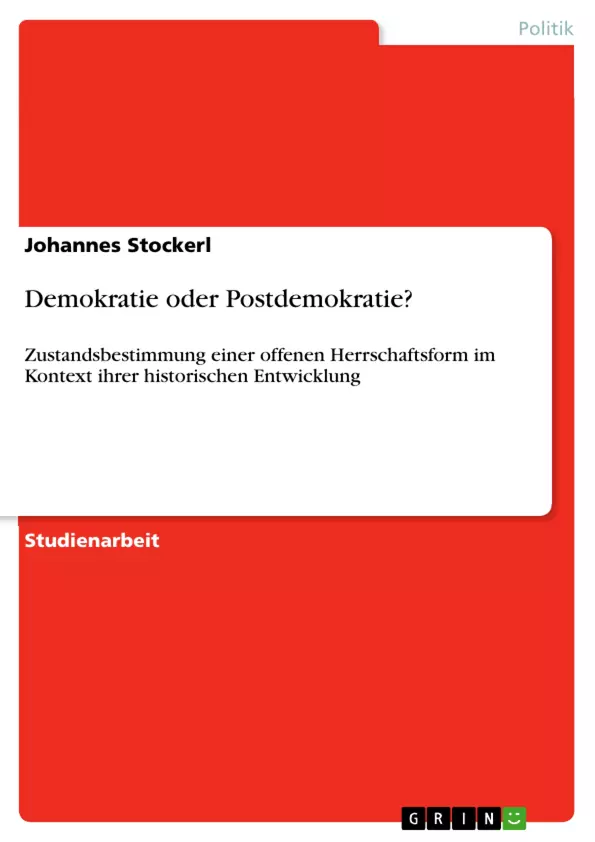In der folgenden Arbeit soll, trotz der Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit, welche die Demokratie in ihrer gelebten Form in der Lage ist, anzunehmen, der Versuch unternommen werden, das postdemokratische Phänomen an eben dieser Entwicklung festzumachen. Der Autor bietet in dem Zusammenhang –nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Demokratie- eine Definition derselben an, welche zum einen der Prozesshaftigkeit dieser Herrschaftsform Rechnung trägt und welche zum anderen dazu geeignet ist, eine Abgrenzung zur Postdemokratie vorzunehmen. Anschließend soll mit Hilfe aktueller Tendenzen und Trends der Zustand eines repräsentativen Querschnitts demokratischer Systeme analysiert werden. Abschließend sollen diese Analysen zu einem Gesamtbild vereint werden, das eine konkrete Aussage über die Qualität der Demokratie zulässt, in der gegenwärtig ein bedeutender Anteil der Weltbevölkerung lebt.
Worum es bei dieser Untersuchung letztendlich geht, ist die Frage, ob die sich vollziehenden Entwicklungen und ihre teils äußerst negative Perzeption dadurch zu erklären sind, dass „[…] wir – die Bürgerinnen und Bürger demokratischer Gesellschaften- immer noch zu eng an das alte Gerüst der repräsentativen Demokratie gebunden [sind]“, oder doch eher mit einem objektiv schlechten Zustand konfrontiert sind. Oder anders ausgedrückt: Sind wir es, die die Demokratie falsch wahrnehmen, oder ist es eine „falsche“ Demokratie, die uns im Alltag begegnet?
Inhaltsverzeichnis
- I. Ein Leben in der Postdemokratie? – Ein problematisches Konzept und seine Einordnung..
- II. Literaturbericht
- III. Demokratie als Prozess - Die Entwicklung einer Regierungsform
- III.1. Frühe Formen
- III.2. Die Demokratie in ihrer modernen Ausprägung..
- IV. Von der Demokratiedefinition zur Charakterisierung der Postdemokratie……………
- V. Die (post)demokratische Konstellation – Zahlen und Trends.
- V.1. Partizipation…………
- V.2. Populismus…
- V.3. Outputseite..
- VI. Ein Leben in der Postdemokratie…
- VII. Ausblick und positive Optionen für eine Stärkung der Demokratie…
- IIX. Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob die Demokratie im Wandel ist und ob es sich bei den beobachteten Entwicklungen um eine postdemokratische Konstellation handelt. Sie befasst sich mit der Problematik der Postdemokratie und ihren Einordnungsproblemen. Ziel ist es, den "Gesundheitszustand" der Demokratie im Kontext ihrer historischen Entwicklung zu analysieren und die Frage zu beantworten, ob es sich um eine "falsche" Demokratie oder eine falsche Wahrnehmung der Demokratie handelt.
- Das Konzept der Postdemokratie und seine Kritikpunkte
- Die historische Entwicklung der Demokratie von frühen Formen bis zur modernen Ausprägung
- Die Charakterisierung der Postdemokratie im Vergleich zur Demokratie
- Analyse aktueller Trends und Zahlen, die auf eine postdemokratische Konstellation hindeuten
- Zusammenführung der Analysen zu einem Gesamtbild, das die Qualität der Demokratie in der heutigen Zeit beleuchtet
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der Postdemokratie und den Schwierigkeiten, das Phänomen klar zu definieren. Es zeigt auf, wie die Bandbreite der Kritikpunkte von der Kommerzialisierung medialer Inhalte bis hin zur Diskussion um Steueroasen reicht. Das zweite Kapitel gibt einen Einblick in die Auswahl und Verwendung der Literatur für die Arbeit. Kapitel drei beleuchtet die historische Entwicklung der Demokratie, beginnend mit den frühen Formen in Athen bis hin zur modernen Ausprägung. Im vierten Kapitel wird die Demokratie anhand ihrer Merkmale definiert und die Abgrenzung zur Postdemokratie vorgenommen. Das fünfte Kapitel analysiert aktuelle Trends und Zahlen, die die (post)demokratische Konstellation verdeutlichen. In Kapitel sechs werden die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln zusammengeführt und die Frage nach dem "Leben in der Postdemokratie" diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Demokratie und Postdemokratie, analysiert die historische Entwicklung der Demokratie und untersucht aktuelle Trends und Zahlen, die auf eine postdemokratische Konstellation hindeuten. Wichtige Themenfelder sind die Partizipation, der Populismus, die Kommerzialisierung medialer Inhalte und die Rolle der Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft. Die Arbeit verwendet Werke von Colin Crouch, Hans Vorländer, Manfred G. Schmidt und Luciano Canfora sowie Beiträge aus Zeitungsartikeln und Online-Ressourcen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Konzept der Postdemokratie?
Postdemokratie beschreibt einen Zustand, in dem zwar formale demokratische Institutionen (wie Wahlen) existieren, die tatsächliche politische Gestaltungskraft jedoch zunehmend an Eliten, Lobbygruppen oder globale Märkte verloren geht.
Wer sind die wichtigsten Theoretiker, die in dieser Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf Werke von Colin Crouch, Hans Vorländer, Manfred G. Schmidt und Luciano Canfora.
Welche Trends deuten auf eine postdemokratische Entwicklung hin?
Analysiert werden Trends wie sinkende politische Partizipation, das Erstarken des Populismus, die Kommerzialisierung medialer Inhalte und die Verschiebung von Entscheidungsprozessen auf die Outputseite.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen Demokratie und Postdemokratie?
Die Arbeit definiert Demokratie als dynamischen Prozess und nutzt diese Definition, um eine klare Abgrenzung zur Postdemokratie vorzunehmen, basierend auf der Qualität der Bürgerbeteiligung und Freiheit.
Welche Rolle spielt die Medialisierung in der Postdemokratie?
Ein zentraler Kritikpunkt ist die Kommerzialisierung medialer Inhalte, die dazu führt, dass politische Debatten eher als Spektakel denn als inhaltliche Auseinandersetzung wahrgenommen werden.
- Arbeit zitieren
- Johannes Stockerl (Autor:in), 2011, Demokratie oder Postdemokratie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176002