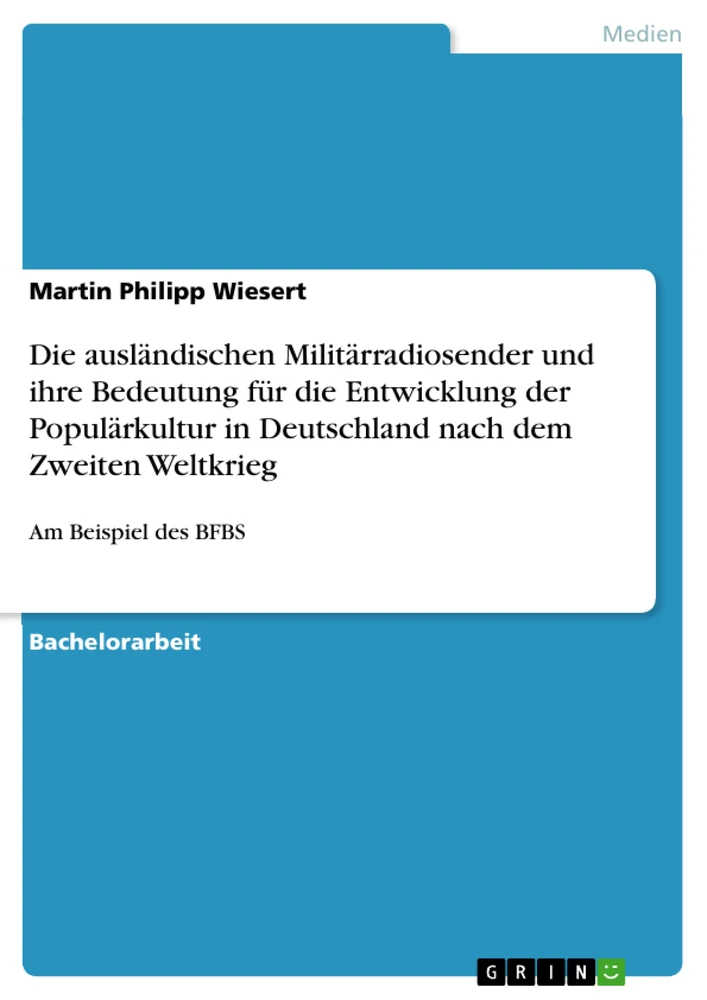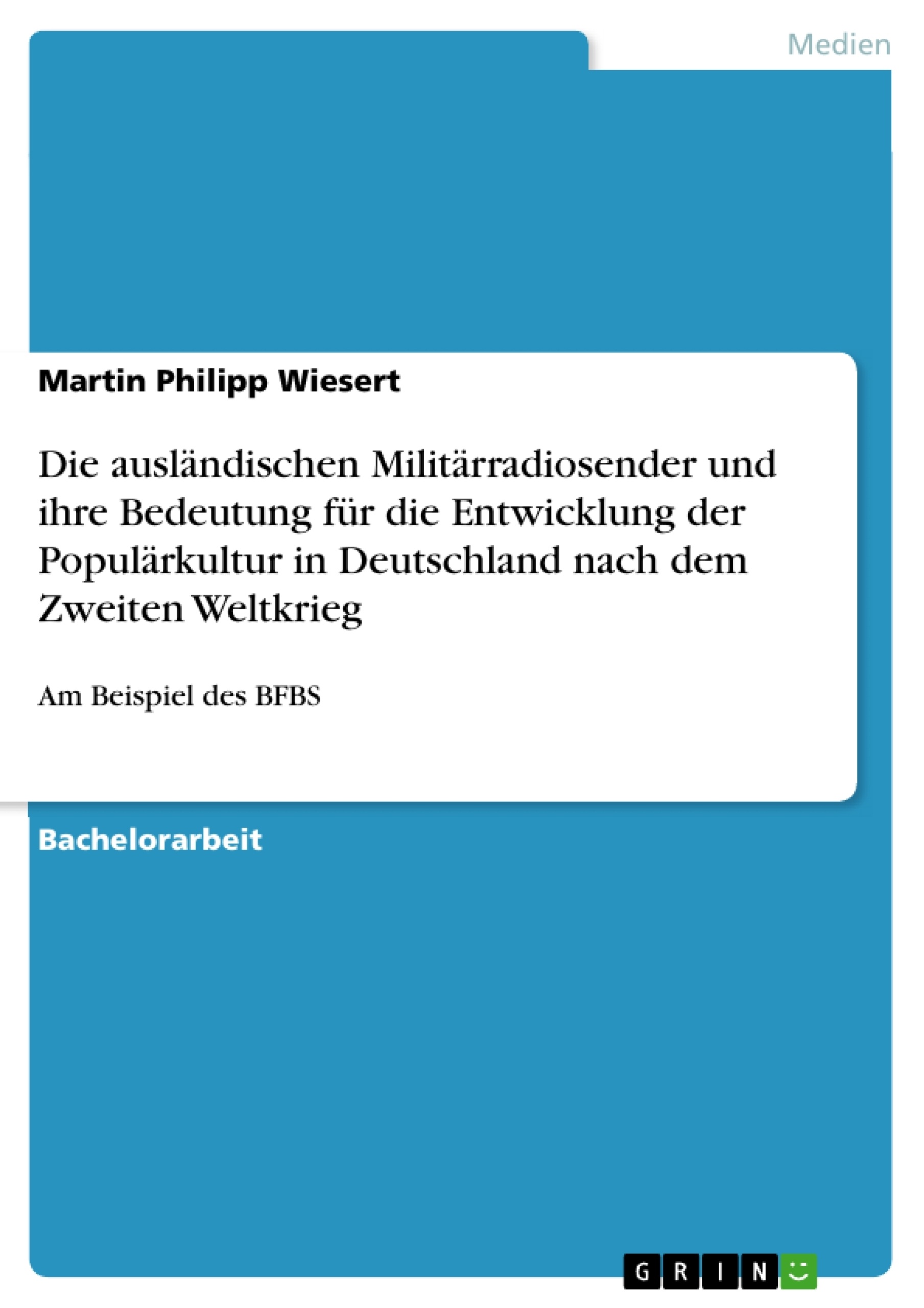Wer sich aus historischer Perspektive mit der Populärkultur in Deutschland ab 1945 beschäftigt, der wird unweigerlich auf Untersuchungen oder Aussagen von Zeitzeugen treffen, die von einem geringen populärkulturellen Angebot in der deutschen Medienlandschaft der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg berichten.Insbesondere junge Rezipienten empfanden einen Mangel an Formaten, die sich stilistisch und inhaltlich an sie richteten. Gemeint sind damit vor allem Programme über zeitgenössische, international populäre Musik oder Jugendbewegungen. Stattdessen herrschten in den Medien seriös vorgetragene Themen wie Politik oder Wirtschaft vor. Unterhaltende Programme waren entweder hochkulturell oder volkstümlich. Das Populärkultur in den Medien heutzutage wie selbstverständlich, teilweise gerade zu inflationär behandelt wird, war in Deutschland also nicht immer der Fall.
Auf der Suche nach Popmusik und -kultur gab es für junge Deutsche in den 1950er bis 1970er Jahren aber auch trotz des Angebotmangels in den Medien einige Bezugspunkte. Zu diesen gehörten die Radiosender der westalliierten Besatzungstruppen in der Bundesrepublik. Im Norden und Westen konnte der britische Soldatensender BFBS (bis 1964 BFN) gehört werden, im Süden und Südwesten und Süden war das US-amerikanische AFN empfangbar. Diese Radiosender waren eigentlich für die angloamerikanischen Besatzungstruppen bestimmt und wollten die Masse an jungen Soldaten fernab ihrer Heimat mit vertrauten Klängen unterhalten. Einen weitaus größeren Rezipientenkreis erreichten BFBS und AFN allerdings schnell bei Millionen von mithörenden Deutschen, die die Soldatensender wegen ihrer für damalige deutsche Radioverhältnisse unkonventionellen Art so attraktiv fanden. Beliebt waren die Stationen natürlich allem voran, da sie die einzigen Quellen für die neueste moderne Popmusik aus den USA und Großbritannien waren.
Meine These lautet deshalb, dass die ausländischen Soldatensender, wie der BFBS, nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der deutschen Populärkultur und schließlich auch der Medien-, speziell der Radiolandschaft, zu einem entscheidenden Anteil mitgeprägt haben. Als akustisches Medium konnte das Radio seinen Beitrag zu
dieser Entwicklung logischerweise hauptsächlich über die Popmusik leisten, die in dieser Form in den deutschen Medien lange Zeit kaum existent war. So wurden die Militärradios speziell für deutsche Jugendliche interessant.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Populärkultur
- Populärmusik und Jugendkultur
- Pop, Jugend und Radio
- Populär- und Jugendkultur in Deutschland 1920 - 1945
- Die nachkriegsdeutsche Hörfunklandschaft
- Alliierte Neuordnung
- Hochkulturelle Tradition und Pop-Tabu
- Ausländische Soldatensender als Gegenpole
- BFBS - der Rundfunk der britischen Streitkräfte
- Entstehungsgeschichte
- Sendeauftrag
- Radiosender
- BFBS Radio Germany
- Die ,,swinging“ Nachkriegszeit
- Rock und Beat auf dem Äther – die 1950er und 60er
- Der BFBS und die subkulturellen Nischen
- Eine deutsche „Kulturrevolution\"
- Die,,Westernisierung“ Deutschlands
- Erste Pop- und Jugendformate
- Der private Hörfunk und die Pop- und Jugendwellen der ARD
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss des britischen Soldatensenders BFBS auf die Entwicklung der deutschen Populärkultur und Radiolandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht, wie der Sender, der ursprünglich für britische Truppen bestimmt war, Millionen deutsche Zuhörer erreichte und die Verbreitung moderner Popmusik in Deutschland maßgeblich beeinflusste. Die Arbeit argumentiert, dass BFBS eine entscheidende Rolle bei der Einführung und Popularisierung von Popkultur in Deutschland spielte.
- Die Entwicklung der Populärkultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- Der Einfluss des BFBS auf die deutsche Medienlandschaft, insbesondere auf das Radio
- Die Bedeutung des BFBS für die Verbreitung moderner Popmusik in Deutschland
- Die kulturellen Auswirkungen des BFBS auf die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle von ausländischen Soldatensendern als Katalysatoren für kulturelle Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These vor, dass ausländische Soldatensender, wie der BFBS, nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der deutschen Populärkultur entscheidend mitprägten. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff der Populärkultur und diskutiert die verschiedenen Definitionen und Perspektiven auf dieses Phänomen.
Kapitel 3 widmet sich dem Zusammenhang zwischen Populärkultur und Radio, besonders im Hinblick auf die deutsche Hörfunklandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Kapitel 4 untersucht den BFBS als ein beispielhaftes Analyseobjekt und erläutert seine Entstehungsgeschichte, seinen Sendeauftrag und seine Programmanalyse. Die Auswirkungen des BFBS auf die deutsche Populärkultur, die Medienlandschaft und die Gesellschaft werden im letzten Kapitel detailliert diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Populärkultur, Radio, Soldatensender, BFBS, Deutschland, Nachkriegszeit, Musik, Jugendkultur, Medienlandschaft, Kulturrevolution, „Westernisierung“ und kulturelle Einflüsse. Die Arbeit untersucht, wie der BFBS als ein ausländischer Soldatensender die deutsche Populärkultur und Medienlandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg prägte und die Verbreitung moderner Popmusik in Deutschland maßgeblich beeinflusste.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Soldatensender für die deutsche Jugend nach 1945?
Sender wie BFBS (britisch) und AFN (US-amerikanisch) waren für viele Jugendliche die einzige Quelle für moderne Popmusik und ein Gegenpol zum konservativen deutschen Rundfunk.
Warum war das deutsche Radioangebot nach dem Krieg für Junge unattraktiv?
Die deutschen Medien waren stark auf Politik, Wirtschaft oder Hochkultur ausgerichtet. Unterhaltung war oft volkstümlich und bot kaum Platz für zeitgenössische Popkultur.
Was bedeutet „Westernisierung“ in diesem Kontext?
Es beschreibt den kulturellen Wandel Deutschlands hin zu westlichen, insbesondere angloamerikanischen Lebensstilen, der maßgeblich durch die Musik der Soldatensender gefördert wurde.
Was war der Sendeauftrag des BFBS?
Ursprünglich sollte der British Forces Broadcasting Service (BFBS) die britischen Soldaten in Deutschland mit vertrauten Klängen aus der Heimat unterhalten.
Wie beeinflussten Soldatensender die spätere deutsche Radiolandschaft?
Der Erfolg der Soldatensender zwang die ARD-Anstalten dazu, eigene Pop- und Jugendwellen zu entwickeln und führte langfristig zur Etablierung des privaten Rundfunks.
Wann wurde Rock und Beat im deutschen Radio populär?
In den 1950er und 60er Jahren verbreitete vor allem der BFBS diese Musikrichtungen, bevor sie allmählich auch in deutschen Formaten Einzug hielten.
- Quote paper
- Martin Philipp Wiesert (Author), 2011, Die ausländischen Militärradiosender und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Populärkultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176083