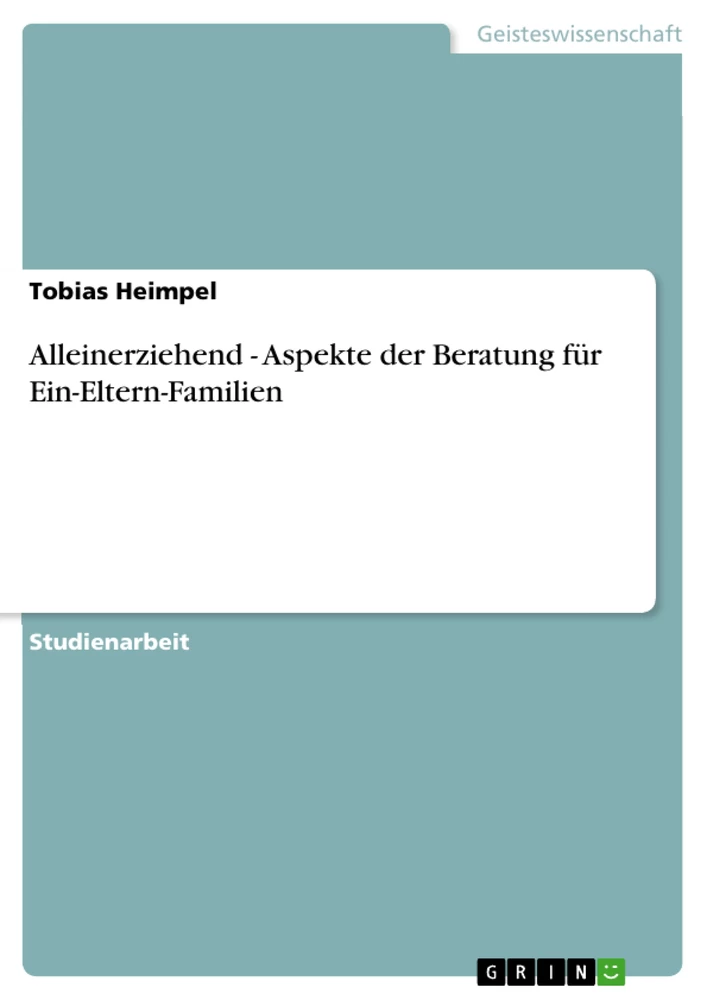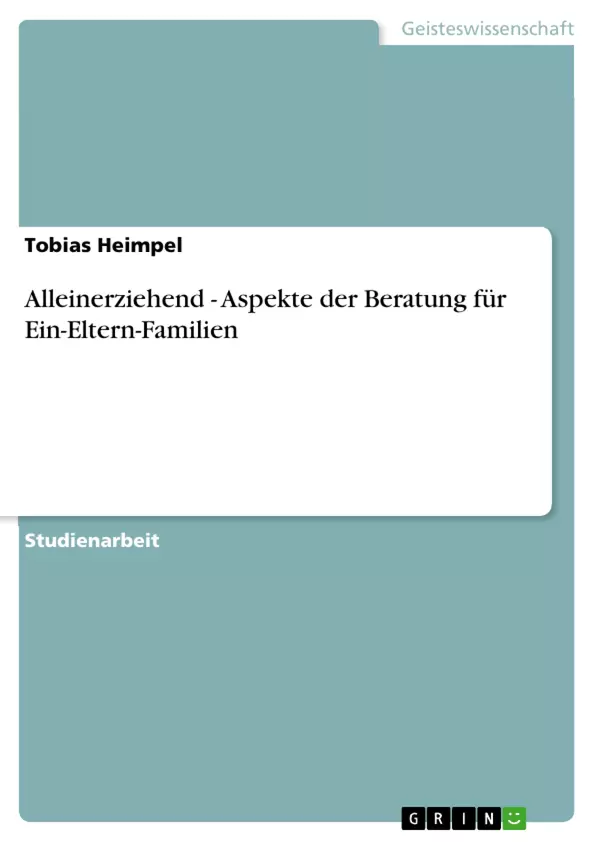Im Jahr 2008 wurden in der Bundesrepublik Deutschland laut dem statistischen Bundesamt fast 380.000 Ehen geschlossen. Allerdings wurden auch wieder über 190.000 Ehen geschieden (Statistisches Bundesamt, 2010). Das bedeutet, dass während jeder zweiten Eheschließung in Deutschlands Standesämtern gleichzeitig ein Ehepaar vor Gericht die Ehe wieder beendet. In vielen dieser Familien leben auch noch minderjährige Kinder, die nicht nur die teilweise heftigen Auseinandersetzungen miterleben mussten, die letztendlich zu der Scheidung führen, sondern in Zukunft die meiste Zeit ihres minderjährigen Lebens auf eines der Elternteile verzichten müssen. Das statistische Bundesamt zählte im Jahr 2003 2,2 Millionen Kinder unter 18 Jahren, die bei einer alleinerziehenden Mutter, oder auch bei einem alleinerziehenden Vater leben. Jedes siebte Kind in Deutschland muss somit mit nur einem Elternteil groß werden (Statistisches Bundesamt, 2003).
Deutlich wird, dass viele Familien mit Kindern in Deutschland von Trennung und Scheidung betroffen sind. Nicht selten werden dabei aber die Streitigkeiten, die zur Trennung führen, auch nach der Scheidung weiter geführt. Häufig werden diese auch auf dem Rücken und vor den Augen der Kinder ausgefochten, was diese nicht selten traumatisieren und verunsichern kann. Neben den Trennungskonflikten müssen Ein-Eltern-Familien aber auch eine große Zahl weiterer Anforderungen bewältigen. Ohne eine zielgerichtete Unterstützung ist dies alles oft nicht zufriedenstellend möglich. Eine wichtige Stütze hierbei ist sicherlich die Beratungsarbeit, die versucht, die alleinerziehenden Elternteile in ihren Lebenslagen und bei den damit verbundenen Anforderungen zu unterstützen.
Zuerst soll diese Arbeit einen kurzen Einblick in die Lebenssituation alleinerziehender Elternteile geben. Es sollen anfangs neben den Ereignissen, die zu einer Ein-Eltern-Familie führen, auch verschiedene Konstellationen beschrieben werden. Außerdem sollen Statistiken einen groben Überblick über die Häufigkeit dieser Familienform geben. Anschließend sollen besondere Anforderungen gezeigt werden, mit denen sich Ein-Eltern-Familien häufig konfrontiert sehen. Als besondere Form der Unterstützung zu diesen vielfältigen Problemen werden abschließend verschiedene Settings der Beratung für Alleinerziehende vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen der Ein-Eltern-Familie
- Rechtliche Regelungen
- Besondere Anforderungen
- Beratungsarbeit
- Schwangerschaftskonfliktberatung mit Alleinerziehenden
- Finanzielle Beratung
- Erziehungsberatung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Lebensbedingungen alleinerziehender Elternteile in Deutschland und die spezifischen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Die Hauptaufgabe des Textes ist es, die komplexen Aspekte der Beratung für Ein-Eltern-Familien zu beleuchten.
- Die verschiedenen Formen von Ein-Eltern-Familien
- Rechtliche Regelungen und ihre Auswirkungen auf alleinerziehende Elternteile
- Besondere Anforderungen, denen Ein-Eltern-Familien gegenüberstehen
- Vielfältige Formen der Beratungsarbeit für Alleinerziehende
- Die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung für alleinerziehende Elternteile
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die wachsende Bedeutung von Ein-Eltern-Familien in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Folgen von Trennung und Scheidung für Kinder und beschreibt die Herausforderungen, denen Ein-Eltern-Familien gegenüberstehen.
Formen der Ein-Eltern-Familie
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Ein-Eltern-Familie und beschreibt verschiedene Konstellationen, die innerhalb dieser Familienform entstehen können. Die Autorin erläutert die Ursachen für die Entstehung von Ein-Eltern-Familien und die steigende Bedeutung von Trennungs- und Scheidungsfamilien.
Rechtliche Regelungen
Das Kapitel befasst sich mit den wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen, die für Ein-Eltern-Familien relevant sind. Es werden Regelungen zum Unterhalt für verwitwete Elternteile, für geschiedene oder getrennt lebende Elternteile sowie zum Umgangs- und Sorgerecht behandelt.
Besondere Anforderungen
Hier werden die besonderen Herausforderungen beleuchtet, denen Ein-Eltern-Familien aufgrund ihrer besonderen Lebenslage gegenüberstehen. Es werden Themen wie finanzielle Engpässe, soziale Isolation und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Ein-Eltern-Familien, Trennung und Scheidung, rechtliche Regelungen, Unterhalt, Sorgerecht, Umgangsrecht, Beratungsarbeit und die vielfältigen Anforderungen, denen alleinerziehende Elternteile gegenüberstehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder leben in Deutschland bei Alleinerziehenden?
Laut Statistiken aus dem Jahr 2003 wächst etwa jedes siebte Kind in Deutschland (ca. 2,2 Millionen unter 18 Jahren) bei nur einem Elternteil auf.
Was sind die größten Herausforderungen für Ein-Eltern-Familien?
Zu den Belastungen zählen finanzielle Engpässe, soziale Isolation, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie anhaltende Trennungskonflikte.
Welche rechtlichen Regelungen sind für Alleinerziehende wichtig?
Besonders relevant sind Regelungen zum Unterhalt, zum Sorge- und Umgangsrecht sowie gesetzliche Bestimmungen für verwitwete oder geschiedene Elternteile.
Welche Arten der Beratung werden angeboten?
Es gibt spezialisierte Angebote wie Schwangerschaftskonfliktberatung, finanzielle Beratung und Erziehungsberatung für Ein-Eltern-Familien.
Wie wirken sich Trennungskonflikte auf Kinder aus?
Streitigkeiten, die auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden, können diese traumatisieren, verunsichern und langfristig belasten.
Gibt es Unterschiede zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Konstellationen und stellt fest, dass beide Gruppen spezifische Unterstützung benötigen, wobei Mütter statistisch häufiger betroffen sind.
- Quote paper
- Tobias Heimpel (Author), 2010, Alleinerziehend - Aspekte der Beratung für Ein-Eltern-Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176104