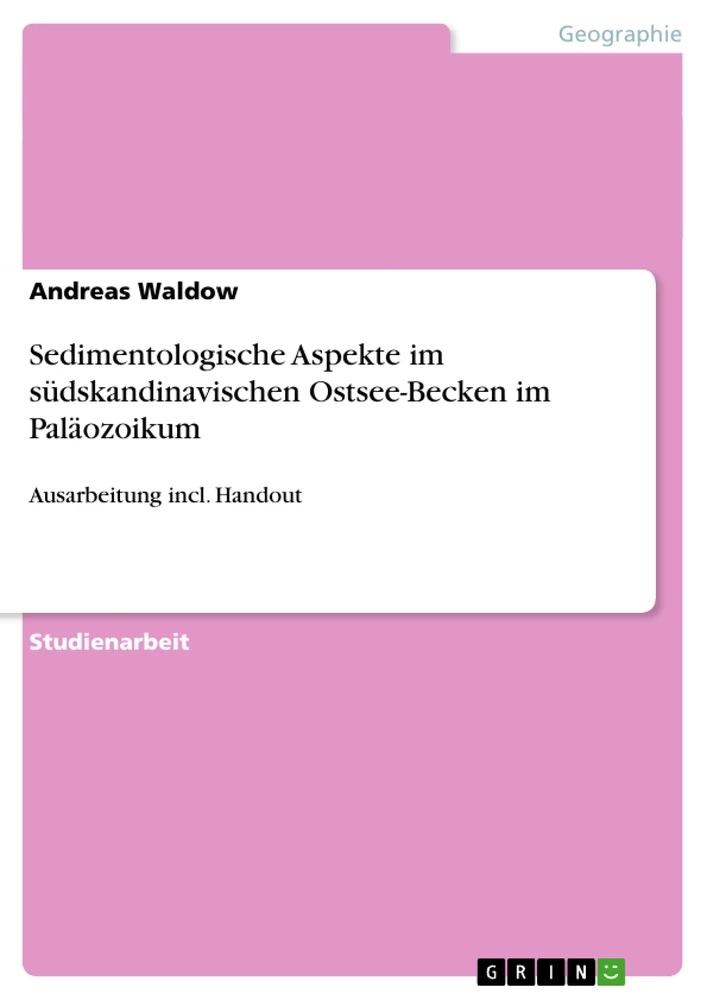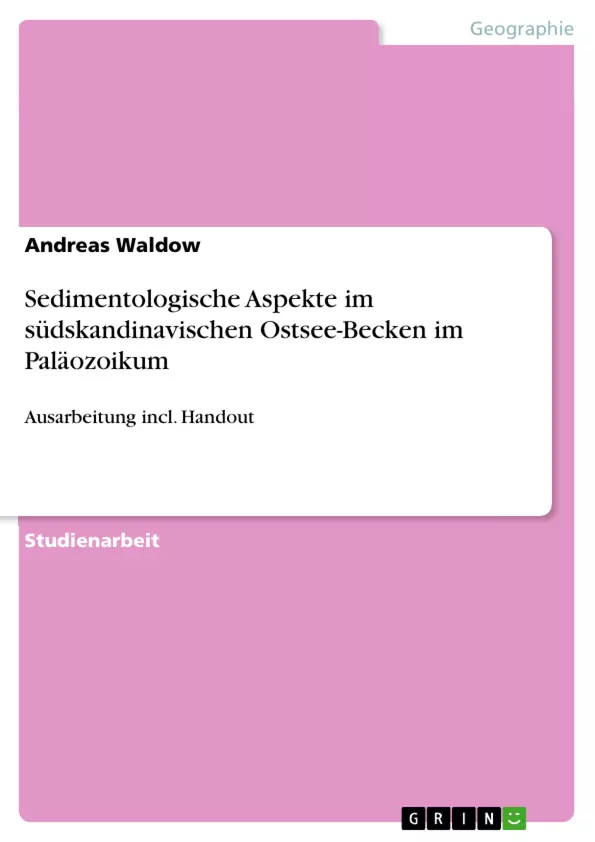Die Ausarbeitung behandelt die sedimentologischen Aspekte (Material und Ablagerungsmilieu) im skandinavischen Ostseebecken im Paläozoikum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines
- 2.1 Präkambrium
- 2.2 Unterkambrium
- 2.3 Mittelkambrium
- 2.4 Oberstes Mittelkambrium bis Ordovizium
- 2.5 Übergang Kambrium/Ordovizium
- 2.6 Ordovizium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht sedimentologische Aspekte des südskandinavischen Ostsee-Beckens im Paläozoikum. Ziel ist es, die Ablagerungsbedingungen und die Entwicklung des Sedimentationsmilieus von Kambrium bis Ordovizium zu rekonstruieren.
- Paläogeogeografische Entwicklung Skandinaviens im Paläozoikum
- Sedimentationsbedingungen und -umgebungen im Kambrium und Ordovizium
- Analyse der Faziesentwicklung und deren Bedeutung für das Verständnis der Umweltbedingungen
- Zusammenhang zwischen Sedimentation und Klimaänderungen
- Die Rolle tektonischer Prozesse auf die Sedimentation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines: Dieser einleitende Abschnitt beschreibt die paläogeographische Lage Baltikas im Zeitraum Kambrium bis Silur, mit einer langsamen Bewegung von südlichen Breitengraden in Richtung Äquatornähe. Die resultierenden Klimaveränderungen hatten einen signifikanten Einfluss auf die Sedimentationsprozesse, die im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert untersucht werden.
2.1 Präkambrium: Dieses Kapitel behandelt die präkambrischen Grundlagen des südskandinavischen Ostsee-Beckens. Es beschreibt das Vorhandensein von leicht verwitterten, metamorphen Grundgebirgsresten (Granite, Gneise etc.), welche ein Peneplain bildeten. Die Abtragung dieses Grundgebirges führte zur Ablagerung von Basiskonglomeraten, die als Fluss- und Seesedimente interpretiert werden und auf ein wüstenartiges Tiefland hindeuten. Die genaue Einordnung dieser Sedimente ist aufgrund fehlender Fossilien unsicher.
2.2 Unterkambrium: Die schrittweise Überflutung des Gebietes im Unterkambrium wird hier beschrieben. Die abgelagerten Sedimente bestehen aus gut sortierten, mittelkörnigen Sandsteinen mit verschiedenen Strukturen (Schrägschichtung, Rippelmarken etc.), die auf ein flaches, energiereiches Meeresmilieu hindeuten. Das Vorhandensein von Glaukonit in den oberen Schichten deutet auf eine Verlangsamung der Sedimentation und eine zunehmende Meerestransgression hin. Die Kapitel beschreibt wechselnde Phasen von Transgression und Regression.
2.3 Mittelkambrium: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Mittelkambrischen Ablagerungen, die regional unterschiedlich sind. Während in einigen Gebieten grauschwarze Ton- und Siltsteine vorherrschen, kennzeichnet sich ein anderes Gebiet durch die Alaunschieferfazies mit Stinkkalken. Die Entstehung des Alaunschiefers als Verwitterungsprodukt von Sulfiden im Schwarzschiefer wird erklärt. Der Abschnitt hebt regionale Unterschiede in der Sedimentation hervor.
2.4 Oberstes Mittelkambrium bis Ordovizium: Das Kapitel beschreibt die kambrischen Alaunschiefer, die reich an organischer Substanz und Pyrit sind und eine charakteristische dunkle Färbung aufweisen. Die Fauna ist artenarm, aber individuenreich, was auf extreme Lebensbedingungen hindeutet. Die Entstehung der Stinkkalkkonkretionen als frühdiagenetische Bildungen wird erläutert, wobei der Zusammenhang zwischen der Mächtigkeit der Alaunschiefer-Einheit und dem Eintrag von terrigenem Material hervorgehoben wird. Die Ablagerung der Alaunschiefer erfolgte langsam und in größerer Wassertiefe.
2.5 Übergang Kambrium/Ordovizium: Der Übergang vom Kambrium zum Ordovizium ist durch eine weitverbreitete Unterbrechung der Sedimentation und Eisen-Sulfidvererzungen gekennzeichnet. Das Kapitel beschreibt Kondensations- und Aufarbeitungshorizonte mit regionaler Verbreitung, die auf Oszillationen eines Flachmeeres zurückgeführt werden. Der Abschnitt markiert einen bedeutenden Wandel in den Sedimentationsverhältnissen.
2.6 Ordovizium: Das Kapitel beschreibt die Fortsetzung der Alaunschieferfazies ins jüngere Tremadocium, jedoch mit erhöhter Artenvielfalt und hellerer Färbung. Der Übergang zur Cephalopodenkalk-Fazies im Unterordovizium deutet auf oxidierendere Verhältnisse und ein wärmeres Klima hin. Die Ablagerung von hellgrauen bis rot gefärbten Kalksteinen wird beschrieben, die durch Bioturbation und den hohen Gehalt an Trilobitenfragmenten gekennzeichnet sind. Es wird der Wechsel zu einem wärmeren Klima und anderen Sedimentationsbedingungen im Ordovizium verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Sedimentologie, Paläozoikum, Kambrium, Ordovizium, Südskandinavien, Ostsee-Becken, Baltika, Fazies, Alaunschiefer, Stinkkalk, Transgression, Regression, Klimaänderung, Tektonik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sedimentologie des südskandinavischen Ostsee-Beckens im Paläozoikum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sedimentologischen Aspekte des südskandinavischen Ostsee-Beckens im Paläozoikum, speziell im Zeitraum vom Kambrium bis zum Ordovizium. Ziel ist die Rekonstruktion der Ablagerungsbedingungen und der Entwicklung des Sedimentationsmilieus in diesem Zeitraum.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die paläogeogeografische Entwicklung Skandinaviens im Paläozoikum, die Sedimentationsbedingungen und -umgebungen im Kambrium und Ordovizium, die Analyse der Faziesentwicklung und deren Bedeutung für das Verständnis der Umweltbedingungen, den Zusammenhang zwischen Sedimentation und Klimaänderungen sowie die Rolle tektonischer Prozesse auf die Sedimentation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Allgemeines: Einleitung, paläogeographische Lage Baltikas. 2.1 Präkambrium: Präkambrische Grundlagen, Grundgebirgsreste, Basiskonglomerate. 2.2 Unterkambrium: Überflutung, Sandsteine, Meeresmilieu, Transgression und Regression. 2.3 Mittelkambrium: Regionale Unterschiede, Ton-/Siltsteine, Alaunschieferfazies, Stinkkalke. 2.4 Oberstes Mittelkambrium bis Ordovizium: Alaunschiefer, organische Substanz, Pyrit, Stinkkalkkonkretionen. 2.5 Übergang Kambrium/Ordovizium: Sedimentationsunterbrechung, Eisen-Sulfidvererzungen, Kondensationshorizonte. 2.6 Ordovizium: Alaunschieferfazies, Cephalopodenkalk-Fazies, Kalksteine, Klimawandel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Sedimentologie, Paläozoikum, Kambrium, Ordovizium, Südskandinavien, Ostsee-Becken, Baltika, Fazies, Alaunschiefer, Stinkkalk, Transgression, Regression, Klimaänderung, Tektonik.
Welche Fazies werden im Detail beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Alaunschieferfazies mit ihren charakteristischen Eigenschaften (organische Substanz, Pyrit, dunkle Färbung), die Entstehung der Stinkkalke und den Übergang zur Cephalopodenkalk-Fazies im Ordovizium. Es wird auch auf die Sandsteine des Unterkambriums und die regional unterschiedlichen Ablagerungen im Mittelkambrium eingegangen.
Welche Rolle spielen Klimaänderungen in der Arbeit?
Klimaänderungen spielen eine entscheidende Rolle. Die langsame Bewegung Baltikas von südlichen Breitengraden in Richtung Äquatornähe führte zu signifikanten Klimaveränderungen, welche die Sedimentationsprozesse maßgeblich beeinflussten. Der Übergang von reduzierenden (Alaunschiefer) zu oxidierenden Bedingungen (Cephalopodenkalke) wird mit einem wärmeren Klima in Verbindung gebracht.
Wie wird der Übergang vom Kambrium zum Ordovizium beschrieben?
Der Übergang ist durch eine weitverbreitete Unterbrechung der Sedimentation und Eisen-Sulfidvererzungen gekennzeichnet. Es werden Kondensations- und Aufarbeitungshorizonte beschrieben, die auf Oszillationen eines Flachmeeres zurückgeführt werden und einen bedeutenden Wandel in den Sedimentationsverhältnissen markieren.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Min. Andreas Waldow (Autor:in), 2008, Sedimentologische Aspekte im südskandinavischen Ostsee-Becken im Paläozoikum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176122