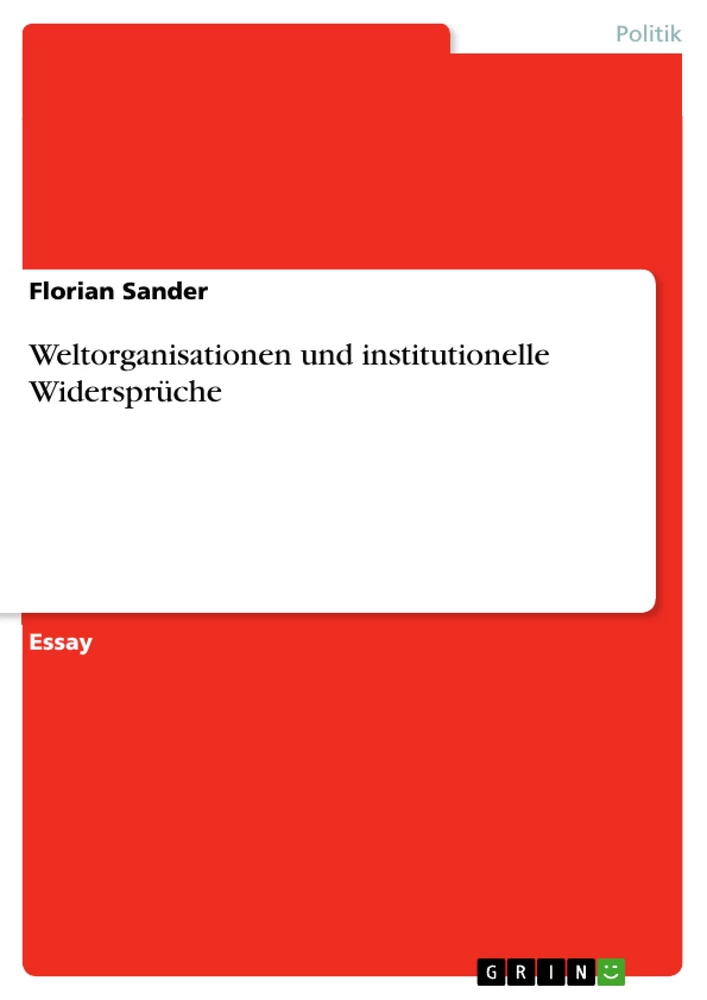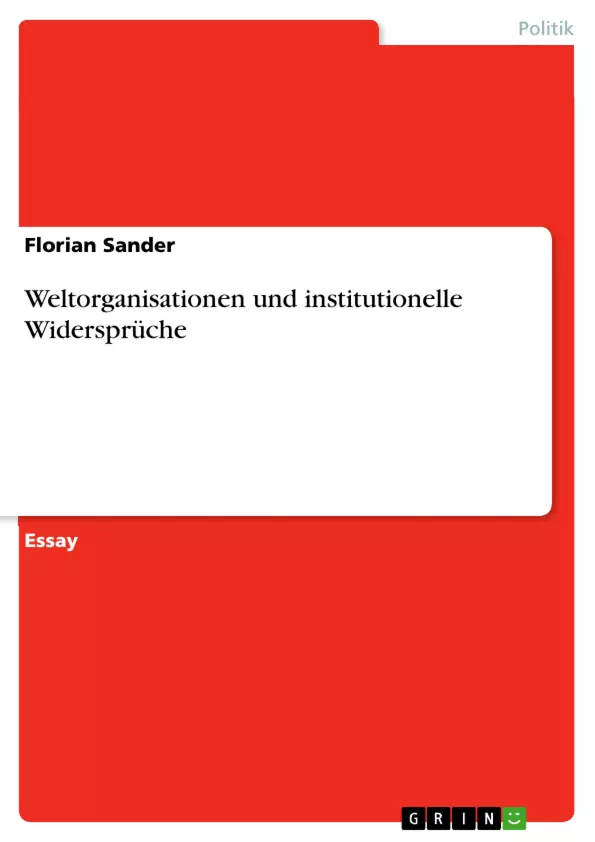Die Weltbank hat seit ihrer Gründung im Jahre 1945 verschiedene Phasen durchlaufen, die gekennzeichnet sind durch bestimmte Vorstellungen von dem, was Entwicklungspolitik ausmachen sollte. Dies hatte mitunter gravierende Effekte auf die konkrete Ausgestaltung der Politik der Weltbank und führte in diesem Bereich im Laufe der Jahrzehnte zu zahlreichen Wendepunkten, welche u. a. Franz Nuscheler (2006) näher beschrieben hat. In diesem Zusammenhang stellt sich die logische Folgefrage, was diese divergierenden Konstruktionen von Entwicklung und damit die Wendepunkte der Entwicklungspolitik verursacht hat und wie diese zu erklären sind, ohne dabei auf Ansätze im Kontext der Theorie rationaler Wahl zurückgreifen zu müssen, deren Thesen angesichts der Ambivalenz, die die Weltbankpolitik eben nicht lediglich in der Zeitdimension, sondern auch hinsichtlich anderen Faktoren (wie etwa: Lose Kopplung zwischen Reden und Handeln) auszeichnet, nicht befriedigend wären. Um diese Erscheinungen beleuchten zu können, werde ich auf ein Erklärungsmodell zurückgreifen, das sich aus der Konzeption des soziologischen Neo-Institutionalismus speist, unter besonderer Berücksichtigung des „world polity“-Ansatzes John Meyers (2005) sowie des organisationssoziologischen Ansatzes Nils Brunssons (1989). Beides wird verbunden mit Martin Kochs Konzept der Weltorganisationen (2011), um im Fazit dieses Essays auch Rückschlüsse auf Organisationen dieses Typs insgesamt ziehen zu können, zu denen die Weltbank zählt.
Weltorganisationen und institutionelle Widersprüche
ESSAY
1. Einleitung
Die Weltbank hat seit ihrer Gründung im Jahre 1945 verschiedene Phasen durchlaufen, die gekennzeichnet sind durch bestimmte Vorstellungen von dem, was Entwicklungspolitik ausmachen sollte. Dies hatte mitunter gravierende Effekte auf die konkrete Ausgestaltung der Politik der Weltbank und führte in diesem Bereich im Laufe der Jahrzehnte zu zahlreichen Wendepunkten, welche u. a. Franz Nuscheler (2006) näher beschrieben hat. In diesem Zusammenhang stellt sich die logische Folgefrage, was diese divergierenden Konstruktionen von Entwicklung und damit die Wendepunkte der Entwicklungspolitik verursacht hat und wie diese zu erklären sind, ohne dabei auf Ansätze im Kontext der Theorie rationaler Wahl zurückgreifen zu müssen, deren Thesen angesichts der Ambivalenz, die die Weltbankpolitik eben nicht lediglich in der Zeitdimension, sondern auch hinsichtlich anderen Faktoren (wie etwa: Lose Kopplung zwischen Reden und Handeln) auszeichnet, nicht befriedigend wären. Um diese Erscheinungen beleuchten zu können, werde ich auf ein Erklärungsmodell zurückgreifen, das sich aus der Konzeption des soziologischen Neo-Institutionalismus speist, unter besonderer Berücksichtigung des „world polity“-Ansatzes John Meyers (2005) sowie des organisationssoziologischen Ansatzes Nils Brunssons (1989). Beides wird verbunden mit Martin Kochs Konzept der Weltorganisationen (2011), um im Fazit dieses Essays auch Rückschlüsse auf Organisationen dieses Typs insgesamt ziehen zu können, zu denen die Weltbank zählt.
2. Die Konstitution der Weltkultur
Im Rahmen der neo-institutionalistischen Stanford School wird die These vertreten, dass sich die Weltgesellschaft durch ein Konglomerat an Institutionen auszeichnet, die ihr in Form von Prinzipien, Werten, Normen etc. kollektiven Sinn verleihen (vgl. Meyer / Boli / Thomas 2005: 18) und sie somit zu einer Weltkultur werden lassen. Institutionen sind somit verfestigte kollektive Erwartungen, die nicht länger hinterfragt werden.
Die Annahme einer solchen Weltkultur hat zu gewissen Missverständnissen geführt, als dass sie bei einigen scheinbar assoziativ den Eindruck generiert hat, die Weltkultur als Ergebnis einer weltweiten Diffusion solcher Mythen sei somit ein homogenes, in sich geschlossenes, konsistentes und ausschließlich von Isomorphie geprägtes Gebilde, in dem Unterschiede seltener werden und Differenzierung unwahrscheinlicher. Zwar hat sich mit der Herausbildung der Weltkultur in der Tat eine weltweite Verbreitung ähnlich gearteter Deutungsmuster ergeben, jedoch hatte gerade dies die Folge, dass Unterschiede sich auf besondere Art manifestieren und über die Perspektive der Weltgesellschaft erst global beobachtbar werden konnten. Der Begriff der „Glokalisierung“ etwa beschreibt – wenn auch verschoben in eine räumliche Dimension, die zwar Teil der Problematik ist, jedoch nicht Ursprung – das Phänomen, bei dem Globalisierung, allgemein assoziiert als eine Art Prozess der „Verwestlichung“, die Folge hat, dass sich zunehmend Gruppen, Ethnien und Völker überall auf der Welt auf ihre Traditionen zurückbesinnen, um zu verhindern, dass diese im Rahmen des oben genannten Prozesses untergehen. Die damit auftretende Lokalisierung tritt als Effekt somit zeitgleich zur Globalisierung auf, was das scheinbar paradoxe Phänomen der Glokalisierung zur Folge hat.
Ein interessanter Bestandteil dieses Prozesses, den der Begriff so noch nicht impliziert, ist dabei das Aufkommen institutioneller Widersprüche (vgl. Friedland / Alford 1991). Die Weltkultur wird nicht erst im Rahmen einer Glokalisierung zu einem heterogenen Sinnsystem, sondern ist dies schon allein dadurch, dass die sie prägenden Institutionen sich mitunter gegenseitig widersprechen können und letztlich nur aufgrund des Abstraktionsniveaus, das „Prinzipien“ und „Werte“ immer auszeichnen muss, nebeneinander existieren können. Der westliche Grundrechtekanon ist ein gutes Beispiel: Hier existieren etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz) nebeneinander, obwohl allgemein bekannt ist, dass beide sich bei näherer Ausgestaltung in konkreter Form widersprechen können. Die Abstraktion verhindert jedoch zunächst, dass es zu Kollisionen dieser Art kommt, und ermöglicht zumindest auf der semantisch-formalen Ebene die zeitgleiche Postulierung beider Grundrechte.
Nicht anders ist es bei den Institutionen der Weltkultur, welche in ihrer Widersprüchlichkeit denjenigen Gruppen, die ihre eigenen Traditionen und Bräuche gegen die Globalisierung „verteidigen“ wollen, das kommunikative Rüstzeug liefern, um diese Verteidigung gegenüber der sozialen Umwelt zu legitimieren. So erwähnten Meyer et al. einen Fall, bei dem afrikanische Intellektuelle versucht haben, die Anwendung des Institution der Gleichberechtigung der Geschlechter auf ihre Gesellschaften zu verhindern, indem sie sich auf die Institution kultureller Selbstbestimmung und Autonomie berufen haben (vgl. Meyer / Boli / Thomas / Ramirez 2005: 125). Es wird im Folgenden zu zeigen sein, dass das Phänomen institutioneller Widersprüche auch und gerade für Weltorganisationen sowohl eine Möglichkeit zur Legitimation gegenüber ihren Umwelten bietet, jedoch gleichzeitig für sie auch eine beständige Herausforderung darstellt.
3. Weltorganisationen und institutionelle Widersprüche
Organisationen werden in ihren tagtäglichen Operationen entscheidend geprägt von ihren sozialen Umwelten. Die organisationalen Umwelten haben Erwartungen an die jeweilige Organisation, welche von dieser dann entweder erfüllt oder enttäuscht werden, wobei sie mit ersterem ihre eigene Legitimation gewährleistet. Insbesondere im Falle politischer Organisationen bleibt jedoch gerade die beständige Enttäuschung von Umwelterwartungen nicht aus, da diese sich zumeist durch äußerst heterogene Umwelten auszeichnen, die wiederum durch divergierende Erwartungen an die Organisation gekennzeichnet sind (vgl. Brunsson 1989: 20 ff.). Die Organisation kann somit niemals alle Erwartungen erfüllen und ist mitunter gezwungen, Elemente ihrer Operationen lose bzw. Reden („talk“) und Handeln („action“) zu entkoppeln. Dies kann von Erfolg gekrönt sein, birgt jedoch auch die Gefahr, dass bei Erkennen dieser Strategie durch die Umwelt der Vorwurf der Heuchelei aufkommt, der in der Politik bekanntlich nicht selten ist: „Hypocrisy is a fundamental type of behaviour in the political organization: to talk in a way that satifies one demand, to decide in a way that satifies another, and to supply products in a way that satifies a third“ (Brunsson 1989: 27). Die Organisation hat dabei die Option, die Entkopplung auf verschiedene Weisen zu vollziehen, bei denen nicht zwingend nur von einer Entkopplung von „talk“ und „action“ ausgegangen werden muss, sondern auch von einer losen Kopplung einzelner „talk“-Elemente wie beispielsweise Themen oder struktureller Elemente wie organisationalen Einheiten. Ferner kann nach Zeit sowie nach Umwelten entkoppelt werden (vgl. ebd.: 34 ff.). Das Beispiel der Weltbank wird zeigen, wie sich dies konkret vollzieht.
Insbesondere politische Organisationen operieren im Rahmen institutioneller Umwelten, d. h., sie sind nicht lediglich leichter erfüllbaren, technisch-formalen Rationalitätserwartungen ausgesetzt, sondern unterliegen unmittelbar den Auswirkungen institutioneller Widersprüche (man denke hier etwa an das Beispiel „Datenschutz versus körperliche Unversehrtheit“ in Abschnitt 2). Diese Tatsache stellt im Besonderen für Weltorganisationen eine Herausforderung dar, da diese über ihren globalen Status unter besonderer Beobachtung stehen und Entkopplung bzw. Heuchelei schneller registriert und damit auch kritisiert wird, was die Legitimationsbemühungen beständig gefährdet. Die Weltorganisation muss, konfrontiert mit widersprüchlichen weltkulturellen Institutionen, beständig klären, welche Semantiken sie aufgreift und verwendet – und damit auch, welche sie nicht verwendet und welche sie ablehnt. Zugleich muss sie im Zuge ihrer politischen Funktion entscheiden, welche Normen sie aufgreift und welche nicht. Da Weltorganisationen selbst nicht nur Objekte, sondern über ihren globalen Status auch Agenten weltkultureller Institutionalisierung sind, haben diese Entscheidungen direkte Auswirkungen auf die politische Weltordnung und damit die Konstitution der „world polity“. Dies werde ich im nächsten Abschnitt am Beispiel der Weltbank ausführen.
4. Empirisches Beispiel: Weltbank
Zwar ist die Ausdifferenzierung der Weltgesellschaft ein Prozess, der schon deutlich länger als nur ein Jahrhundert andauert, jedoch markiert die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN im Jahre 1948 einen besonderen Punkt, der für die Institutionalisierung der Weltkultur essenziell war. Mit der zwar nur formalen, aber so gut wie globalen Anerkennung der Menschenrechte hat sich der damit einhergehende Katalog an politischen Prinzipien so einer Sammlung zumindest in abstrakter Form nicht mehr hinterfragbarer Normen entwickelt. Zugleich wurde damit und mit den danach folgenden Präzisierungen der Menschenrechte das Primat der Entwicklung geschaffen: Politische Systeme und Regierung erhielten damit den Auftrag, für die Verwirklichung dieser Rechte weltweit einzutreten, auch abseits des eigenen Territoriums. Somit war es die logische Konsequenz, die (zunächst nur für den Zweck des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete) Weltbank mit der globalen Organisation dieser Politik zu betrauen.
Eine Entscheidung hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung einer globalen Entwicklungspolitik der Weltbank war damit freilich noch nicht vorgegeben. Diese ergab sich später vielmehr aus dem Zusammenwirken verschiedener weltkultureller Institutionen, welche selbst bis heute in einem ständigen Wettstreit miteinander stehen. Franz Nuscheler (2006) hat die Entwicklungspolitik der Weltbank in mehrere Phasen unterschieden; an seine Analyse werde ich mich im Folgenden halten.
Zu einer der prägendsten westlichen Institutionen zählt der kapitalistische Markt (vgl. Friedland / Alford 1991: 232). Ihn entdecken wir wieder, wenn wir die erste maßgebliche Entwicklungsdekade betrachten, die sich grob in den 60er Jahren verorten lässt und auf dem Konzept „Entwicklung durch Wachstum“ beruhte: Sie ist gekennzeichnet vom Paradigma der Modernisierung und dem Grundgedanken, dass Unterentwicklung eine Folge von Kapitalmangel ist und durch Wirtschaftswachstum, Einbindung in den Weltmarkt und Handel ein Modernisierungs- und Entwicklungseffekt erreicht werden könne (vgl. Nuscheler 2006: 78 f.). Das Prinzip des kapitalistischen Marktes war hier der prägende institutionelle Einfluss.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus des Essays "Weltorganisationen und institutionelle Widersprüche"?
Der Essay untersucht, wie Weltorganisationen, insbesondere die Weltbank, durch institutionelle Widersprüche innerhalb der Weltkultur beeinflusst werden. Er betrachtet, wie diese Organisationen mit divergierenden Erwartungen umgehen und wie sie Entscheidungen treffen, die sowohl Legitimation gewährleisten als auch Herausforderungen darstellen.
Welche theoretischen Ansätze werden in dem Essay verwendet?
Der Essay greift auf den soziologischen Neo-Institutionalismus zurück, insbesondere den "world polity"-Ansatz von John Meyer und den organisationssoziologischen Ansatz von Nils Brunsson. Diese werden mit Martin Kochs Konzept der Weltorganisationen verbunden.
Was ist die "world polity" und wie beeinflusst sie Weltorganisationen?
Die "world polity" ist ein Konglomerat von Institutionen, Prinzipien, Werten und Normen, die der Weltgesellschaft kollektiven Sinn verleihen. Weltorganisationen sind sowohl Objekte als auch Agenten dieser Institutionalisierung und müssen Entscheidungen treffen, die direkte Auswirkungen auf die politische Weltordnung haben.
Was sind institutionelle Widersprüche und wie manifestieren sie sich?
Institutionelle Widersprüche entstehen, wenn sich die Institutionen der Weltkultur gegenseitig widersprechen. Ein Beispiel ist der Konflikt zwischen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Diese Widersprüche bieten Gruppen, die ihre Traditionen verteidigen wollen, ein Rüstzeug zur Legitimation.
Wie geht die Weltbank mit widersprüchlichen Erwartungen um?
Die Weltbank, wie andere politische Organisationen, ist mit heterogenen Umwelten konfrontiert, die divergierende Erwartungen haben. Um diesen gerecht zu werden, kann die Weltbank Elemente ihrer Operationen lose koppeln oder Reden und Handeln entkoppeln. Dies birgt jedoch das Risiko des Vorwurfs der Heuchelei.
Welche Phasen hat die Entwicklungspolitik der Weltbank durchlaufen?
Franz Nuscheler unterscheidet mehrere Phasen der Entwicklungspolitik der Weltbank. Eine frühe Phase war geprägt von "Entwicklung durch Wachstum" und dem Paradigma der Modernisierung, das auf Kapitalmangel als Ursache von Unterentwicklung fokussierte. Später erfolgte ein Schwenk hin zur direkten Armutsbekämpfung durch Verbesserung der Gesundheit, Schaffung von Arbeitsplätzen und Verbesserung der Bildung.
Welche Rolle spielt der kapitalistische Markt in der Entwicklungspolitik der Weltbank?
In der ersten Entwicklungsdekade spielte der kapitalistische Markt eine prägende Rolle. Die Idee war, dass Wirtschaftswachstum, Einbindung in den Weltmarkt und Handel zu Modernisierungs- und Entwicklungseffekten führen würden.
Wie haben sich die Institutionen der Wohlfahrtsstaatlichkeit und Bildung auf die Politik der Weltbank ausgewirkt?
Die Erkenntnis, dass Bildung zur Armutsbekämpfung beitragen kann, und die Einsicht, dass primär wachstumsfördernde Maßnahmen vor allem den reichsten Bevölkerungsschichten zugute kommen, führten zu einer verstärkten Fokussierung auf Wohlfahrtsstaatlichkeit und Bildung in der Politik der Weltbank.
- Arbeit zitieren
- Florian Sander (Autor:in), 2011, Weltorganisationen und institutionelle Widersprüche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176368