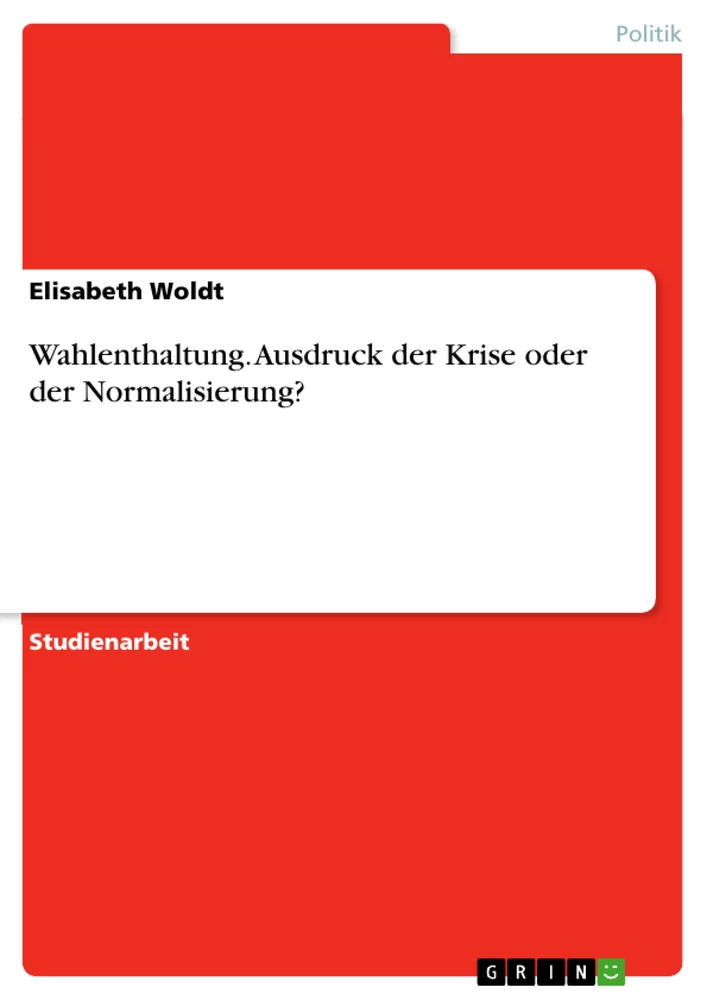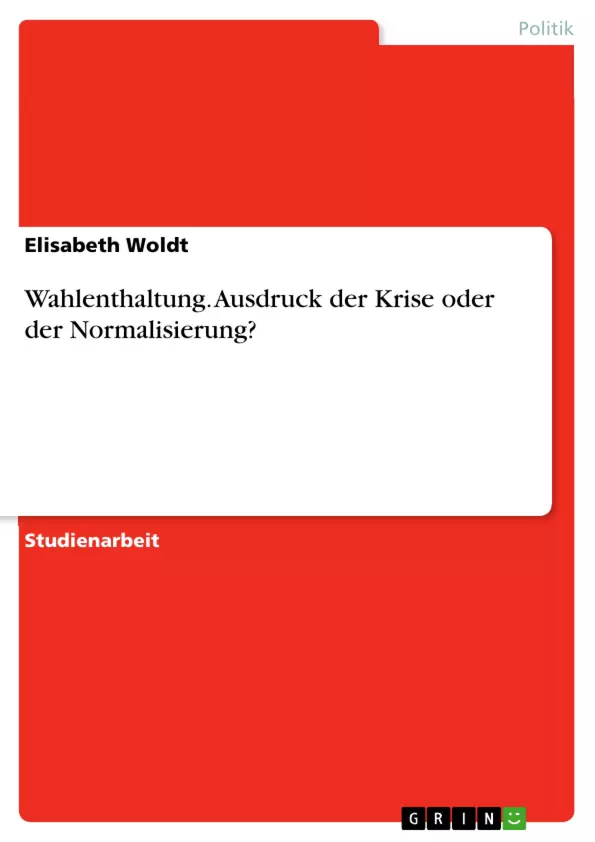Abraham Lincoln definierte Demokratie 1863 einprägsam als government of the people, by the people, for the people” In dieser Regierungsform geht demzufolge die Herrschaft aus dem Volk hervor und wird dann durch das Volk selbst und in seinem Interesse ausgeübt. Bestätigt wird ein solches Verständnis der Demokratie im deutschen Grundgesetz. Auch dort heißt es im Artikel 20.2, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausginge.
Es scheint jedoch, als würde in Ländern, in denen die Demokratie einst groß wurde, die Herrschaft in den letzten Jahren nur noch von einem Teil des Volkes getragen, denn Fakt ist, dass in fast allen westlichen Demokratien die Wahlbeteiligung sinkt. Seit der Jahrtausendwende beteiligten sich in Frankreich nur noch durchschnittlich 62,43% der berechtigten Bürgerinnen und Bürger an den Wahlen. In Großbritannien sind es nur noch 60,37%. In den USA lag die Wahlbeteiligung 1996 gar auf einem historischen Tiefstand von
49%. Auch in der vergleichsweise jungen Demokratie Deutschlands blieben in den letzten Jahren immer mehr Wahlberechtigte zuhause. Wenngleich die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Deutschland von 1949 bis 2005 bei 84,6% und somit rund 4% höher als der Durchschnitt bei sämtlichen nationalen Parlamentswahlen in allen anderen westlichen Demokratien in diesen Jahren liegt , die Zeiten von Nichtwähleranteilen unter 10% scheinen auch hier vorbei zu sein. 2005 begaben sich nur noch rund 77,5% der deutschen Wahlberechtigten an die Urne.
Unter dem Eindruck dieser Entwicklungen, wecken die Wahlenthaltungen auch in Deutschland zunehmend das Interesse von Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern. Das Resultat dieser Beschäftigung ist ein Diskurs, der nach wie vor ungelöst scheint. Die Frage ist: Befindet sich die Demokratie in der Krise oder sind Wahlbeteiligungen auf diesem Niveau schlicht ein Zeichen von Normalität?
Zur Untersuchung dieser Fragestellung soll in der vorliegenden Hausarbeit der Wahlakt in seiner Bedeutung für die Demokratie kurz näher erläutert werden. Es folgt eine genauere Betrachtung der Gruppe der Nichtwähler und insbesondere der Gründe, die nach bisherigen empirischen Untersuchungen zur Wahlenthaltung führen können. Auf diese Art und Weise kann dann zum Ende der Arbeit ein Antwortversuch gegeben werden, inwiefern die wachsende Gruppe der Nichtwählenden die Legitimität westlicher Demokratien untergräbt, beziehungsweise nur eine Normalisierung oder gar einfach eine andere Form der Wahlentscheidung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie
- Eine Kategorisierung der Nichtwähler
- Ungültigwähler
- Technische Nichtwähler
- Grundsätzliche Nichtwähler
- Konjunkturelle Nichtwähler
- Eine neue Nichtwähler-Kategorie?
- Gründe für die Stimmenthaltung anhand verschiedener Ansätze zur Erklärung von Wahlverhalten
- Soziologische Ansätze
- Der sozialpsychologische Ansatz
- Der Rational-Choice-Ansatz
- Schlussbetrachtung: Sind Nichtwähler eine Gefahr für die Demokratie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die steigende Wahlenthaltung in westlichen Demokratien, insbesondere in Deutschland. Dabei untersucht sie, ob diese Entwicklung als Ausdruck einer Krise der Demokratie oder als Normalisierung anzusehen ist. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie, kategorisiert verschiedene Nichtwählertypen und analysiert die Gründe für Wahlenthaltung anhand verschiedener wissenschaftlicher Ansätze.
- Die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie und das Prinzip der Volkssouveränität
- Die verschiedenen Kategorien von Nichtwählern
- Die Erklärung von Wahlenthaltung aus soziologischer, sozialpsychologischer und rational-choice-theoretischer Perspektive
- Die Frage nach der Legitimität von demokratischen Systemen angesichts steigender Wahlenthaltung
- Die Debatte über die Bedeutung von Nichtwählern für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Problematik der sinkenden Wahlbeteiligung in westlichen Demokratien und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung von Wahlenthaltung für die Demokratie. Sie führt kurz die wichtigsten Studien und Ansätze zur Erklärung von Nichtwahlverhalten ein.
Das zweite Kapitel behandelt die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie und die Funktion von Wahlen als ein zentrales Element des demokratischen Prozesses. Es wird argumentiert, dass Wahlen die Grundlage für die Legitimität und Stabilität demokratischer Systeme darstellen.
Im dritten Kapitel erfolgt eine Kategorisierung verschiedener Nichtwählertypen. Es werden unterschiedliche Formen der Nichtwahl, wie beispielsweise Ungültigwahl, technische Nichtwahl und konjunkturelle Nichtwahl, definiert und abgegrenzt. Auch die Frage nach einer neuen Nichtwählerkategorie wird in diesem Kapitel erörtert.
Kapitel 4 beleuchtet die Gründe für Wahlenthaltung aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Soziologische Ansätze, der sozialpsychologische Ansatz sowie der Rational-Choice-Ansatz werden vorgestellt und ihre Erklärungspotenziale für Nichtwahlverhalten diskutiert.
Schlüsselwörter
Wahlenthaltung, Nichtwähler, Demokratie, Legitimität, Volkssouveränität, Wahlbeteiligung, Soziologie, Sozialpsychologie, Rational-Choice-Theorie, politische Partizipation
Häufig gestellte Fragen
Ist die sinkende Wahlbeteiligung ein Zeichen für eine Krise der Demokratie?
Die Arbeit untersucht, ob Nichtwählen Ausdruck von Desinteresse und Legitimationsverlust ist oder schlicht eine Form der "Normalisierung" in stabilen Systemen darstellt.
Welche Arten von Nichtwählern gibt es?
Man unterscheidet u.a. zwischen technischen Nichtwählern (verhindert), grundsätzlichen Nichtwählern (prinzipielle Ablehnung) und konjunkturellen Nichtwählern (situationsbedingt).
Was erklärt der Rational-Choice-Ansatz beim Wahlverhalten?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Bürger Kosten (Aufwand) und Nutzen (Einfluss der Stimme) abwägen und bei geringem erwartetem Nutzen der Wahl fernbleiben.
Welche soziologischen Gründe führen zur Wahlenthaltung?
Soziologische Faktoren wie soziale Schichtung, Bildungsgrad und die Einbindung in soziale Netzwerke beeinflussen maßgeblich die Wahrscheinlichkeit der Partizipation.
Wie hoch war die Wahlbeteiligung in Deutschland im historischen Vergleich?
Von 1949 bis 2005 lag sie durchschnittlich bei 84,6 %, sank jedoch in den letzten Jahren deutlich unter die 80-Prozent-Marke.
- Quote paper
- Elisabeth Woldt (Author), 2009, Wahlenthaltung. Ausdruck der Krise oder der Normalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176406