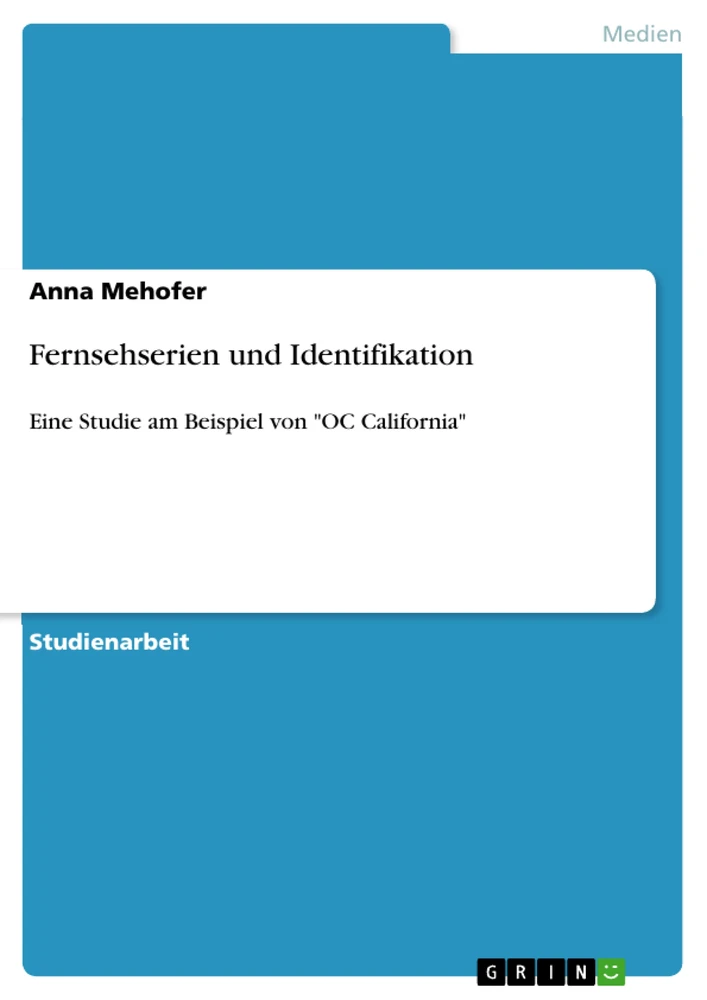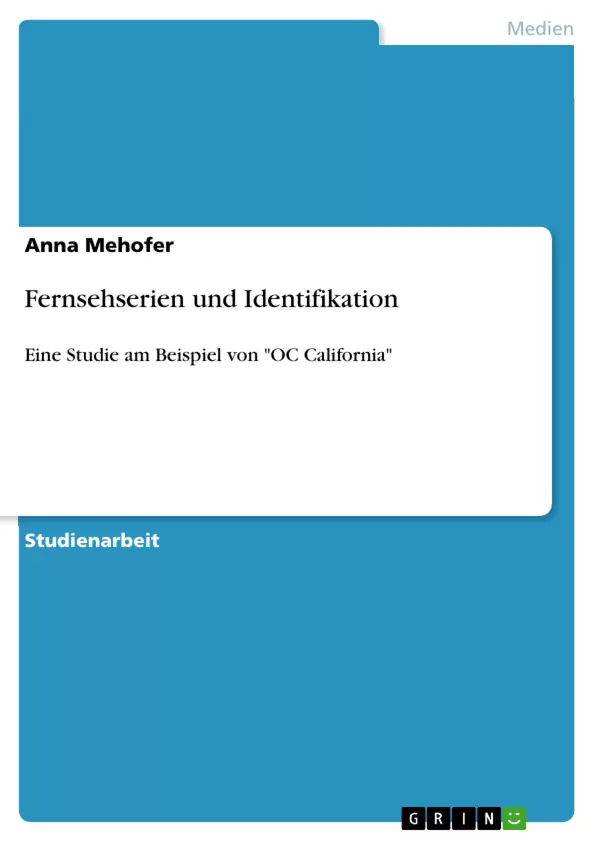Oft wurde in den letzten Jahren, und auch schon davor, die klassische Fernsehserie als Instanz der „Persönlichkeitsbildung“/„Identifikation“ thematisiert. Vor allem die Wirkung auf jugendliche Rezipienten stand zur Debatte. Meist geschah dies mit kritischem oder gar verächtlichem Unterton, da Serien an sich nicht gerade ein hohes Ansehen unter den Fernsehangeboten genießen. Trivial und einfach gestrickt seien sie, heißt es. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit richtet sich auf die Faszination der Fernsehserie: Warum genießen gerade die „klassisch gestrickten“ (durch spezifische Merkmale als solche definierten) Serien derart hohe Einschaltquoten? Das bedeutet vor allem: Wie gelingt es ihnen, die emotionalen und psychischen Bedürfnisse der Zuseher nach Identifikation zu erfüllen? Um diese Frage zu beantworten, wird sich das Forschungsdesign am viel zitierten Uses-and-Gratifications- Ansatz orientieren. Dieser geht von einem aktiven Publikum aus, das den Medienkonsum nach eigenen Bedürfnissen ausrichtet. Als Beispiel wird die Jugendserie „O.C. – California“ (im englischen Original „The O.C.“) herangezogen werden. Sie ist repräsentativ für das Genre der Fernsehserie mit dramatischem Inhalt (Definition siehe unten), weil sie inhaltlich alle für eine Befragung relevanten Merkmale aufweist. Bei Betrachtung der Forschungsergebnisse wird noch genauer auf die Frage eingegangen werden, warum sich die Identifikation bei den Geschlechtern unterscheidet. Um die Gründe hierfür zu klären, wird eine theoretische Komponente der Cultural Studies, nämlich der soziale Konstruktivismus, in die Arbeit mit einfließen und – vor allem hinsichtlich ihrer Voraussetzung eines passiven Publikums – kritisch beleuchten. Zuletzt wird sich diese Arbeit der These widmen, warum es trotz technischer Neuerungen und den Angeboten auf youtube nicht zu dem oftmals prophezeiten Untergang der Fernsehserie kommen wird. Vorausgesetzt wird in allen Fällen, dass sich die Wirkung und Funktion der Fernsehserie über die Jahre ihres Bestehens kaum verändert hat; lediglich der Zugang ist ein anderer geworden (mehr Leute besitzen einen Fernseher etc.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse, theoretische Orientierung sowie ein erster Ausblick auf die inhaltliche Zusammensetzung der Arbeit...
- Kommunikationswissenschaftliche Relevanz des Themas..
- Begriffsdefinitionen...
- Was unter einer Serie zu verstehen ist.
- Was ist ein Genre? Gibt es die „typische Serie“ überhaupt?
- Das Forschungsobjekt – Erste Definition der relevanten Merkmale.
- Das Publikum.....
- Theoretische Hinführung zu den Forschungsfragen: Stand der Forschung
- Zum Wesen des Uses-and-Gratifications-Ansatzes...
- Die soziale Identität...
- Der Symbolische Interaktionismus als Basis für das Prinzip der Identifikation……….
- Spannung als Anlass für intensives Involvement und als Qualitätsmerkmal……………………
- Beziehungen zu Serienfiguren als ein auf emotionaler Identifikation basierender Prozess /Eigentliche Empathie als Form der Identifikation...
- Identifikationsbegriff vs. Involvement...
- Voraussetzungen für und Arten von Involvement..
- Identifikation vs. Empathie, oder: Warum Empathie eine Art der Identifikation ist.
- Die Forschungsfrage..
- Die Hypothesen...
- Geplante Vorgehensweise & Operationalisierung der Variablen
- Vorgehensweise....
- Einige Worte zur Operationalisierung der Begriffe….
- Das Forschungsdesign
- Umstände der Untersuchung.….
- Indikatoren für die Variablen..
- „Aufschlüsselung“ der Testfragen..
- Demographische Daten..
- Die Variable Häufigkeit..
- Die Variable Ähnlichkeit..
- Die Variable Sympathie..
- Die Variable Spannung.
- Die Variable Auseinandersetzung..
- Bemerkung zu den Fragen und den dazu gehörigen Skalen..
- Der Weg von den Daten zum Ergebnis..
- Auswertung und erste Interpretation der Daten
- Die Antworten in Tabellenform…………
- Statistische Auswertung mit Interpretation.....
- Korrelationen und ihre Bedeutung
- Mögliche Fehlerquellen.....
- Fans und Nicht-Fans..
- Andere Korrelationen..
- Fehlende Korrelationen..
- Bedeutung der Korrelationen...
- Blick auf die Geschlechterdifferenzen
- Interpretation der Ergebnisse nach dem Faktor Geschlecht..
- Zwei Sichtweisen aus dem Bereich der Cultural Studies………
- Warum die Serie überleben wird...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Fernsehserien und Identifikation: Am Beispiel von „OC-California““ untersucht die Faszination von Fernsehserien und insbesondere die Gründe für ihre hohen Einschaltquoten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie klassische Serien die emotionalen und psychischen Bedürfnisse der Zuschauer nach Identifikation erfüllen. Die Arbeit basiert auf dem Uses-and-Gratifications-Ansatz, der von einem aktiven Publikum ausgeht, das Medien nach eigenen Bedürfnissen konsumiert.
- Identifikation mit Serienfiguren
- Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
- Die Rolle von Spannung und Involvement
- Das Genre der Fernsehserie
- Geschlechterdifferenzen in der Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfrage vor. Es wird auf die Relevanz des Themas für die Kommunikationswissenschaft eingegangen und zentrale Begriffe wie „Serie“ und „Genre“ definiert. Kapitel 2 bietet einen theoretischen Rahmen, indem der Uses-and-Gratifications-Ansatz, die soziale Identität und der Symbolische Interaktionismus vorgestellt werden. In den folgenden Kapiteln werden die Forschungsfrage und die Hypothesen erläutert, das Forschungsdesign vorgestellt und die Operationalisierung der Variablen besprochen. Kapitel 7 analysiert die erhobenen Daten und interpretiert die Ergebnisse. In Kapitel 8 werden Korrelationen und ihre Bedeutung untersucht, während Kapitel 9 die Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen analysiert. Die Arbeit schließt mit einem Blick auf die Gründe für das Überleben der Fernsehserie.
Schlüsselwörter
Fernsehserien, Identifikation, Uses-and-Gratifications-Ansatz, sozialer Konstruktivismus, Genre, „O.C. California“, Spannung, Involvement, Empathie, Rezeption, Geschlechterdifferenzen, Cultural Studies.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Uses-and-Gratifications-Ansatz?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Publikum Medien aktiv nutzt, um spezifische Bedürfnisse (z. B. Identifikation oder Unterhaltung) zu befriedigen.
Wie funktioniert Identifikation mit Serienfiguren?
Identifikation basiert auf emotionalen Prozessen, Empathie und der Wahrnehmung von Ähnlichkeit oder Sympathie gegenüber den Charakteren.
Warum wurde die Serie "O.C. – California" als Beispiel gewählt?
Sie gilt als repräsentativ für das Genre der Jugendserie mit dramatischem Inhalt und bietet vielfältige Identifikationsmöglichkeiten für die Zielgruppe.
Gibt es Unterschiede bei der Identifikation zwischen Geschlechtern?
Die Arbeit untersucht, warum sich Männer und Frauen unterschiedlich mit Figuren identifizieren, und nutzt dafür Ansätze der Cultural Studies.
Warum wird die klassische Fernsehserie trotz YouTube überleben?
Weil sie psychische Grundbedürfnisse nach kontinuierlicher Erzählung und emotionalem Involvement erfüllt, die durch Kurzform-Inhalte oft nicht abgedeckt werden.
Was ist Symbolischer Interaktionismus?
Es ist eine soziologische Theorie, die besagt, dass Identität durch soziale Interaktion und die Interpretation von Symbolen entsteht, was auch auf die Beziehung zu Medienfiguren zutrifft.
- Quote paper
- Anna Mehofer (Author), 2009, Fernsehserien und Identifikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176423