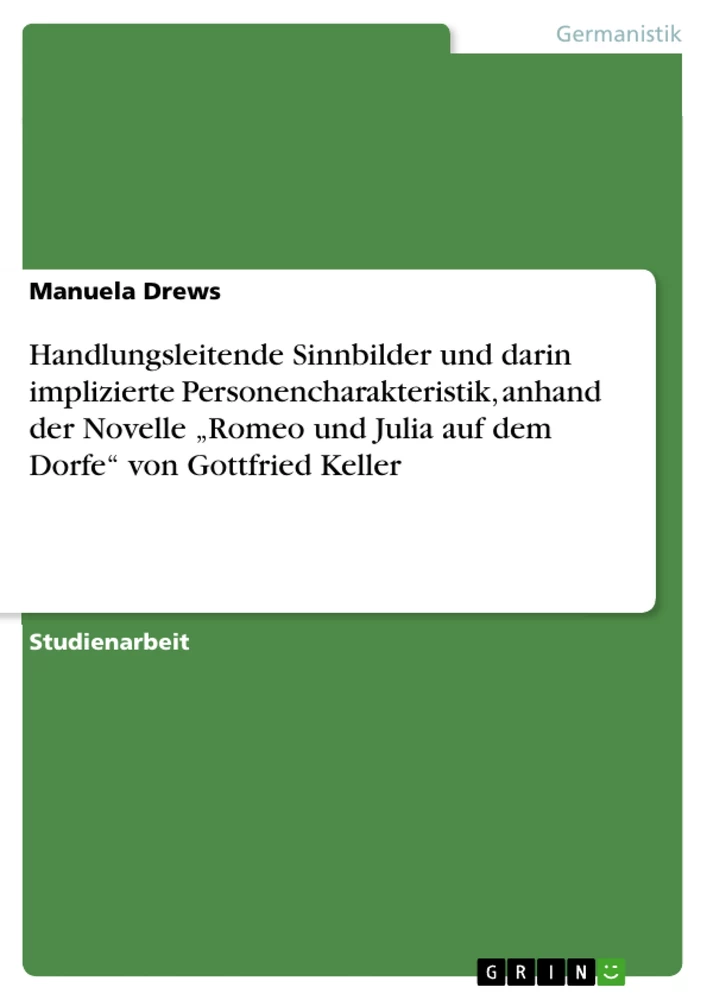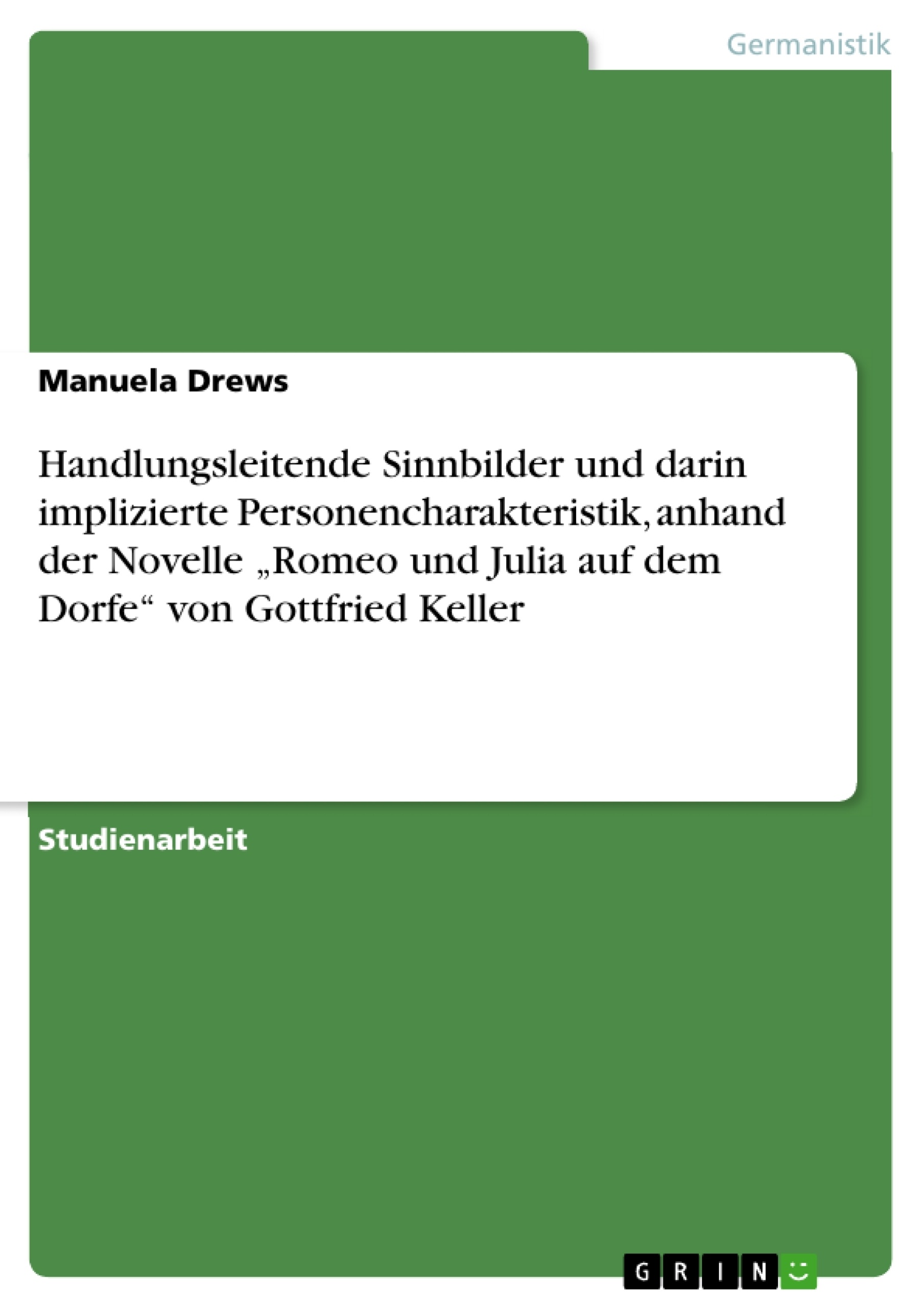„Romeo und Julia auf dem Dorfe“ ist eine von Gottfried Keller verfasste Novelle. Erschienen ist sie in der Novellensammlung „Die Leute von Seldwyla“ und wurde erstmals 1856 veröffentlicht. Sie erzählt die Geschichte des jungen Liebespaares Salomon „Sali“ Manz und Vrenchen Marti, die, auf Grund der verfeindeten Väter und dem fehlenden Rückhalt in der Gesellschaft, schließlich gemeinsam Suizid begehen. Die folgende Ausarbeitung wird sich mit den folgenden Fragestellungen befassen:
Enthält der Text leitende Sinnbilder, die bereits das Ende der Geschichte andeuten?
Geben diese Sinnbilder Aufschluss über die Persönlichkeiten der beiden Hauptfiguren?
Was sagt die Persönlichkeitsstruktur, in Verbindung mit dem jeweiligen Sinnbild, über die Zukunft des Paares aus?
Da die Bildsymbolik in der Novelle sehr ausgeprägt ist, wird nur das „Puppenmotiv“ und das Dingsymbol „Haus“ ausführlich untersucht werden. Weitere Motive, wie zum Beispiel der „Acker“ oder der „schwarze Geiger“, würden den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Die Vorgehensweise wird sich ein wenig unterscheiden. Das Puppenmotiv umfasst eine Szene in der Kindheit, das Symbol „Haus“ zieht sich jedoch durch die gesamte Handlung, vor allem aber durch die Jugend der Beiden. Das gemeinsame Ergebnis sollte jedoch sein, dass sich nach der Analyse der Sinnbilder, die Protagonisten charakterisieren lassen. Außerdem sollte deutlich werden, welche Bedeutung sie im Hinblick auf die Zukunft des Paares haben werden. Zitiert wird dabei hauptsächlich aus folgendem Primärtext:
Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe : mit Materialien / Gottfried Keller. Ausgew. u. eingel. von Peter Haida. -1. Aufl., [Nachdr.] Stuttgart: Klett, 2003.
Sämtliche Zitate aus diesem Text werden mit Klammernotationen kenntlich gemacht, Zitate aus Sekundärliteratur durch Fußnoten am Ende der jeweiligen Seite.
Im Schlussteil soll dann festgestellt werden, ob die Eingangsfragen beantwortet werden konnten und Keller tatsächlich solche Sinnbilder verwendet. Möglicherweise ergibt sich durch die Personencharakteristik außerdem eine Antwort darauf, warum ein junges Liebespaar keinen anderen Ausweg, als den gemeinsamen Freitod sieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erstes Sinnbild: Das Puppenmotiv
- Einführung in die Szene
- Personencharakteristik: die Mädchenfigur „Vrenchen“ im Kindesalter
- Personencharakteristik: Sali im Kindesalter
- Deutungen des „Puppenmotivs“
- Zweites Sinnbild: das „Haus“
- Bedeutung des Dingsymbols „Haus“ in der gesamten Novelle
- Weiterführende Charakterisierung von Vrenchen als junge Erwachsene
- Weiterführende Charakterisierung von Sali im Jugendalter
- Symbolische Bedeutung des „Hauses“ für Vrenchens und Salis Zukunft
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die leitenden Sinnbilder „Puppenmotiv“ und „Haus“ in Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Symbole für die Charakterisierung der Hauptfiguren Sali und Vrenchen und deren zukünftige Entwicklung zu analysieren. Die Arbeit fragt nach der Funktion der Sinnbilder als Vorwegnahme des tragischen Endes und nach den Ursachen für den gemeinsamen Suizid des jungen Paares.
- Analyse der Symbolkraft des „Puppenmotivs“ und seiner Bedeutung für die kindliche Entwicklung von Sali und Vrenchen.
- Untersuchung des „Hauses“ als wiederkehrendes Symbol und dessen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Protagonisten.
- Charakterisierung von Sali und Vrenchen anhand der ausgewählten Sinnbilder.
- Interpretation der Sinnbilder im Hinblick auf die tragische Zukunftsaussicht des Liebespaares.
- Erforschung der gesellschaftlichen und familiären Umstände, die zum tragischen Ausgang beitragen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ ein und benennt die zentralen Forschungsfragen. Es wird die Fokussierung auf die Sinnbilder „Puppenmotiv“ und „Haus“ begründet und die Methodik der Analyse erläutert. Die Einleitung skizziert den Zusammenhang zwischen der Charakterisierung der Hauptfiguren und der symbolischen Bedeutung der ausgewählten Motive für die Zukunftsaussichten des Paares.
Erstes Sinnbild: Das Puppenmotiv: Dieses Kapitel analysiert eine Szene auf dem „wilden Acker“, in der die Kinder Sali und Vrenchen mit einer Puppe spielen. Die Analyse der Szene dient dazu, die Persönlichkeiten der beiden Hauptfiguren im Kindesalter zu charakterisieren. Vrenchens liebevolles und kreatives Spiel mit der Puppe steht im Kontrast zu Salis destruktivem Verhalten. Die gemeinsame Zerstörung und Beerdigung der Puppe offenbart sowohl die grausamen als auch die einfühlsamen Seiten der Kinder. Die Szene wird interpretiert als Vorbote der späteren tragischen Ereignisse. Die Analyse verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen den Kindern und ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale, die bereits im Kindesalter angelegt sind.
Zweites Sinnbild: das „Haus“: Das Kapitel erweitert die Charakterisierung von Sali und Vrenchen auf ihr Jugendalter und analysiert die symbolische Bedeutung des „Hauses“ im Verlauf der gesamten Novelle. Das Haus repräsentiert dabei nicht nur einen physischen Ort, sondern symbolisiert auch die sozialen und familiären Verhältnisse, die das Leben der Protagonisten prägen. Die Analyse beleuchtet, wie die unterschiedlichen Perspektiven der Figuren auf das „Haus“ und dessen Bedeutung ihre Entwicklung und ihre Beziehung zueinander beeinflussen. Das Haus als Ort der Geborgenheit und gleichzeitig der Einschränkung wird im Zusammenhang mit den zukünftigen Entwicklungen der Protagonisten interpretiert.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, Sinnbild, Puppenmotiv, Haussymbol, Personencharakterisierung, Sali Manz, Vrenchen Marti, Liebespaar, Suizid, gesellschaftliche Verhältnisse, Familiendrama, Tragödie.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Kellers "Romeo und Julia auf dem Dorfe" - Symbolanalyse
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die leitenden Sinnbilder „Puppenmotiv“ und „Haus“ in Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Symbole für die Charakterisierung der Hauptfiguren Sali und Vrenchen und deren zukünftige Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen Suizid des Paares.
Welche Sinnbilder werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei zentrale Sinnbilder: das „Puppenmotiv“, das im Kindesalter von Sali und Vrenchen eingeführt wird, und das „Haus“, das als wiederkehrendes Symbol die sozialen und familiären Verhältnisse der Protagonisten repräsentiert.
Wie werden die Sinnbilder analysiert?
Die Analyse untersucht die Symbolkraft der Motive in Bezug auf die kindliche Entwicklung von Sali und Vrenchen (Puppenmotiv) und deren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter (Haus). Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven der Figuren auf die Symbole und deren Bedeutung für ihre Beziehung und ihre Zukunftsaussichten.
Welche Aspekte der Charakterisierung von Sali und Vrenchen werden behandelt?
Die Arbeit charakterisiert Sali und Vrenchen anhand der ausgewählten Sinnbilder, indem sie deren Persönlichkeitsmerkmale im Kindes- und Jugendalter herausarbeitet und die Entwicklung ihrer Beziehung beleuchtet. Der Kontrast zwischen Vrenchens liebevollem und Salis destruktivem Umgang mit der Puppe wird beispielsweise analysiert.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Symbolen und dem tragischen Ende?
Die Arbeit untersucht, wie die Sinnbilder als Vorwegnahme des tragischen Endes fungieren und welche Rolle die gesellschaftlichen und familiären Umstände spielen. Die Interpretation der Symbole im Hinblick auf die tragische Zukunftsaussicht des Liebespaares ist ein zentraler Aspekt der Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum „Puppenmotiv“, ein Kapitel zum „Haussymbol“ und einen Schlussteil. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und Methodik. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Sinnbilder und deren Bedeutung für die Charakterisierung der Protagonisten. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, Sinnbild, Puppenmotiv, Haussymbol, Personencharakterisierung, Sali Manz, Vrenchen Marti, Liebespaar, Suizid, gesellschaftliche Verhältnisse, Familiendrama, Tragödie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung der Sinnbilder „Puppenmotiv“ und „Haus“ für die Charakterisierung von Sali und Vrenchen und deren zukünftige Entwicklung zu analysieren und den Zusammenhang mit dem tragischen Ausgang der Geschichte zu ergründen.
- Quote paper
- Manuela Drews (Author), 2010, Handlungsleitende Sinnbilder und darin implizierte Personencharakteristik, anhand der Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ von Gottfried Keller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176514