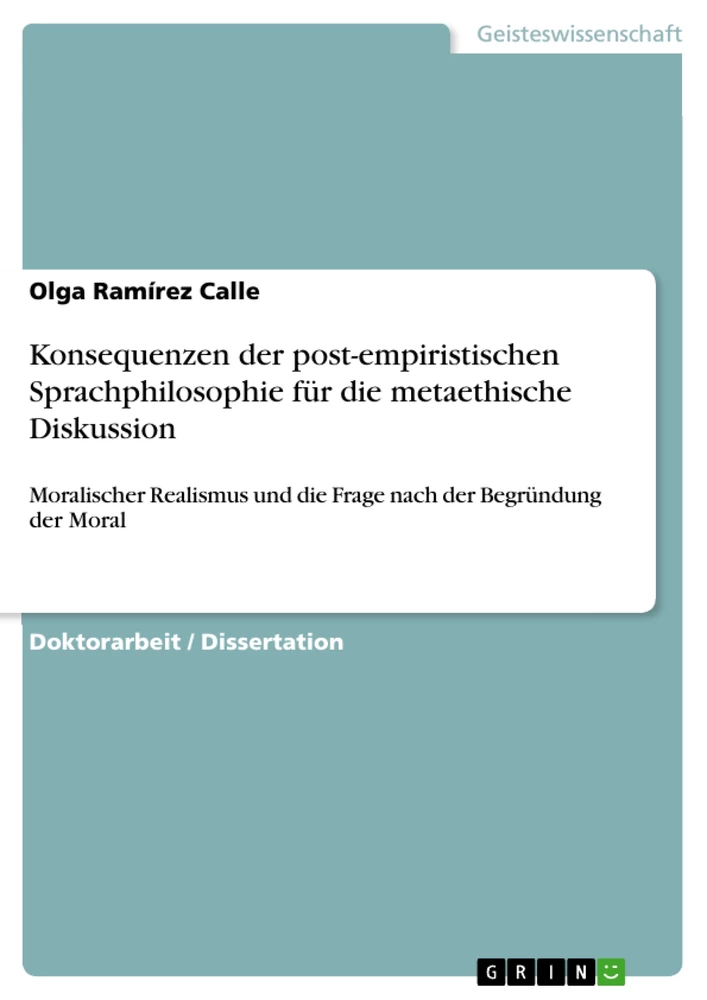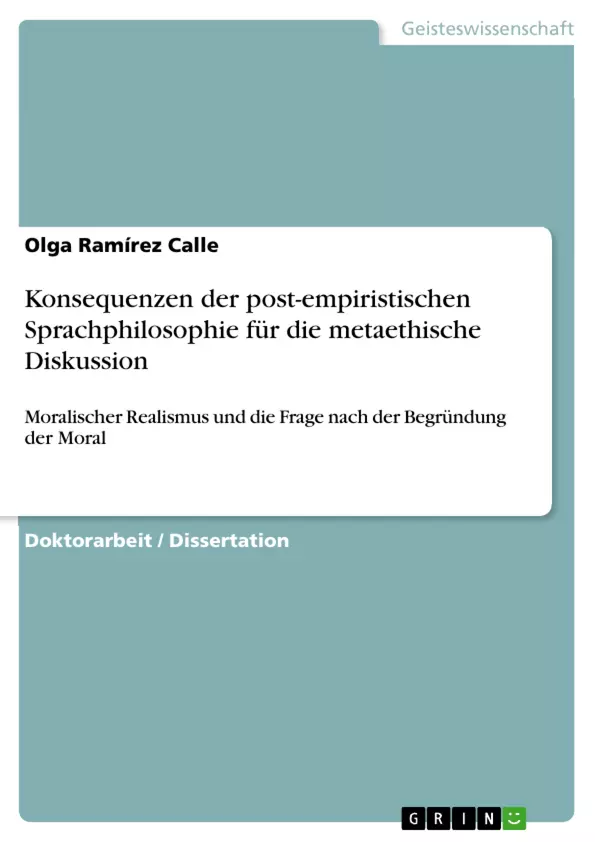Die Arbeit liefert eine historische Rekonstruktion der post-empiristischen sprachphilosophischen Prämissen, die zu der heutigen Debatte um den moralischen Realismus führten. Diese Perspektive ermoglicht, die Schwächen der realistischen Position sichtbar zu machen, in dem man auf die Unzulänglichkeiten der pragmatischen Sprachphilosophie zeigt, die ihr Rückhalt gibt. In diesem Zusammenhang untersucht die Arbeit die relevantesten Argumente in der Diskussion um den Moralischen Realismus, insbesonders bezüglich der Frage nach der Wahrheit dichter ethischer Aussagen. In Rahmen einer sprachanalytischen Untersuchung, welche 'dichte Begriffe' als kondensierte Aussagen versteht, und dabei die sogenannte ‚Entanglement These‘ in Frage stellt, wird eine nicht-realistische, aber dennoch kognitivistische Position vertretten
Die Arbeit befasst sich ferner mit der Frage nach der Möglichkeit einer realistischen Begründung der Moral und nähert sich von dieser Perspektive aus wieder der Debatte um den moralischen Realismus an. Es geht mir darum zu untersuchen, inwiefern diese Diskussion um den moralischen Realismus einen Beitrag zur Beantwortung der Begründungsfrage liefern kann. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Diskussion um die Frage nach der Wahrheit moralischer Aussagen, nichts Entscheidendes zur Beantwortung der Frage nach einer realistischer Begründbarkeit der Moral liefern kann. Dasselbe gilt für die Diskussion im Rahmen der Diskursethik nach der Richtigkeit moralischer Normen. Auch diese Diskussion – unabhängig davon, ob wir die Gültigkeit von Normen im (anti-realistischen) Sinne von Richtigkeit oder von (realistischer) Wahrheit verstehen – kann weder die Rede von einer realistischen Begründung der Moral noch einen Moralischen Realismus im genuinen Sinne rechtfertigen. Um eine solche Rechtfertigung zu liefern, müsste man beweisen, dass dem Maßstab (an dem die Richtigkeit moralischer Normaussagen oder Aussagen zu prüfen wäre) selbst ein realistisch verstandener ontologischer Status gegeben werden kann. Solange die Richtigkeit bzw. Wahrheit moralischer Aussagen von der Befriedigung eines nicht im realistischen Sinne bewiesenen Maßstabes abhängt, ist die Rede von einem Moralischen Realismus fehl am Platze.
Die Arbeit setzt sich unter anderem mit den Positionen von John.McDowell, Simon Blackburn, Crispin Wright, Bernard Williams, Hilary Putnam, Cristina Lafont, Jürgen Habermas auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG. DIE FRAGE NACH DER BEGRÜNDUNG DER MORAL UND DIE WIEDERKEHR REALISTISCHER ANTWORTSVERSUCHE
- 1. Wiederkehrende Aspekte einer Begründung der Moral. Erörterung einer realistischen Perspektive
- 2. Neuere Versuche einer realistischen Begründung der Moral. Zum Gegenstand dieser Untersuchung
- 3. Das sprachphilosophische Verständnis einer realistischen Begründung moralischer Überzeugungen.
- 4. Der Debatte um den Moralischen Realismus in der gegenwärtigen Philosophie
- II. KONSEQUENZEN DER POSTEMPIRISTISCHEN SPRACHPHILOSOPHIE FÜR DIE METAETHISCHE DISKUSSION
- KAPITEL I.
- HISTORISCHER RÜCKBLICK: DER ÜBERGANG VON EINER POSITIVISTISCHEN ZU EINER PRAGMATISCH-PHÄNOMENOLOGISCHEN WELTSICHT
- 1.1. The,Bluring of Boundaries' - Die Preisgabe des modernen Projektes einer auf der sinnlichen Erfahrung basierenden Demarkation unseres Wissens
- 1.2. Der Übergang von einem starken zu einem schwachen Verifikationismus
- HISTORISCHER RÜCKBLICK: DER ÜBERGANG VON EINER POSITIVISTISCHEN ZU EINER PRAGMATISCH-PHÄNOMENOLOGISCHEN WELTSICHT
- KAPITEL II.
- ZENTRALE ARGUMENTE FÜR DEN MORALISCHEN KOGNITIVISMUS
- 2.1. ERSTES ARGUMENT: DER LOGISCH_SYNKTAKTISCHE GEBRAUCH MORALISCHER AUSSAGEN
- 2.2. ZWEITES ARGUMENT: 'MORALISCHES REGELFOLGEN'
- ZENTRALE ARGUMENTE FÜR DEN MORALISCHEN KOGNITIVISMUS
- III. DIE FRAGE NACH DER WAHRHEIT DICHTER MORALISCHER AUSSAGEN
- KAPITEL III.
- DIE IDEE PERSPEKTIVISTISCHEN MORALISCHEN WISSENS. BERNARD WILLIAMS UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEM UND MORALISCHEM WISSEN UND WAHRHEIT
- 3.1. WILLIAMS NON-OBJEKTIVISTISCHER' KOGNITIVISMUS
- 3.2. PUTNAM KRITIK AN WILLIAMS
- DIE IDEE PERSPEKTIVISTISCHEN MORALISCHEN WISSENS. BERNARD WILLIAMS UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEM UND MORALISCHEM WISSEN UND WAHRHEIT
- KAPITEL IV.
- HABERMAS AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN \"POSTWITTGENSTEINIANISCHEN UND NEOARISTOTELISCHEN ANSÄTZE
- 4.1. HABERMAS ÜBER DIE OBJEKTIVITÄT MORALISCHES WISSENS.
- 4.2. PUTNAMS KRITIK AN HABERMAS VERSTÄNDNIS ETHISCHER WERTURTEILE
- 4.3. WIE SOLL DANN DICHTE BEGRIFFE UND DEREN GEBRAUCH VERSTEHEN..
- 4.4. ZURÜCK ZU PUTNAMS KRITIK AN HABERMAS.
- 4.5. INWIEFERN IST DANN PUTNAMS KRITIK AN HABERMAS' POSITION ZUTREFFEND?
- HABERMAS AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN \"POSTWITTGENSTEINIANISCHEN UND NEOARISTOTELISCHEN ANSÄTZE
- IV. KONDENSETHIK, MORALISCHE NORMEN UND DIE FRAGE NACH DER BEGRÜNDUNG DER MORAL
- KAPITEL V.
- VON DER WAHRHEIT DICHTER MORALISCHER AUSSAGEN ZU DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN
- 5.1. HABERMAS VERSTÄNDNIS MORALISCHER RICHTIGKEIT
- 5.2. ZWEI INTERPRETATIONSMODELLE DER ABHÄNGIGKEITSVERHÄLTNISSE ZWISCHEN MORALISCHEN NORMEN UND MORALISCHEN WERTAUSSAGEN
- 5.3. WELCHEN STELLENWERT HAT FÜR HABERMAS DIE RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN
- VON DER WAHRHEIT DICHTER MORALISCHER AUSSAGEN ZU DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN
- KAPITEL VI.
- REALISTISCHE UND ANTI-REALISTISCHE AUFFASSUNGEN DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN
- 6.1. HABERMAS AUSEINANDERSETZUNG MIT DER REALISTISCHEN LEKTÜRE DER DISKURSETHIK VON C. LAFONT
- 6.2. ÜBERTRAGUNG AUF DEN MORALISCHEN FALL
- REALISTISCHE UND ANTI-REALISTISCHE AUFFASSUNGEN DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN
- KAPITEL VII.
- DIE FRAGE NACH DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN UND DER ANSPRUCH AUF EINE REALISTISCHE BEGRÜNDUNG DER MORAL
- 7.1. DAS PROBLEM DER BEGRÜNDUNGSRICHTUNG
- 7.2. RICHTIG IN MORALISCHEN SINNE UND DIE NORMATIVE FRAGE NACH DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN..
- 7.3. ERGEBNISSE
- DIE FRAGE NACH DER RICHTIGKEIT MORALISCHER NORMEN UND DER ANSPRUCH AUF EINE REALISTISCHE BEGRÜNDUNG DER MORAL
- KAPITEL V.
- KAPITEL III.
- KAPITEL I.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Begründung der Moral und untersucht, wie die postempiristische Sprachphilosophie die metaethische Diskussion beeinflusst. Sie analysiert die Konsequenzen einer realistischen Perspektive auf die Begründung moralischer Überzeugungen und erörtert zentrale Argumente für den moralischen Kognitivismus.
- Die Relevanz der postempiristischen Sprachphilosophie für die Metaethik
- Die Frage nach der Wahrheit dichter moralischer Aussagen
- Die Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlichem und moralischem Wissen
- Die Rolle der Richtigkeit moralischer Normen in der Begründung der Moral
- Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen zum moralischen Realismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Übergang von einer positivistischen zu einer pragmatisch-phänomenologischen Weltsicht. Es analysiert die Preisgabe des modernen Projekts einer auf der sinnlichen Erfahrung basierenden Demarkation unseres Wissens und diskutiert den Übergang von einem starken zu einem schwachen Verifikationismus.
- Kapitel II: Dieses Kapitel präsentiert zentrale Argumente für den moralischen Kognitivismus, die auf dem logisch-syntaktischen Gebrauch moralischer Aussagen und dem Konzept von 'moralischem Regelfolgen' basieren.
- Kapitel III: Dieses Kapitel untersucht die Idee perspektivistischen moralischen Wissens und die Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlichem und moralischem Wissen und Wahrheit, die Bernard Williams vornimmt. Es analysiert Williams' non-objektivistischen Kognitivismus und diskutiert Putnams Kritik an diesem Ansatz.
- Kapitel IV: Dieses Kapitel befasst sich mit Habermas' Auseinandersetzung mit den "postwittgensteinianischen und neoaristotelischen Ansätzen". Es untersucht Habermas' Position zur Objektivität moralischen Wissens und Putnams Kritik an diesem Verständnis ethischer Werturteile.
- Kapitel V: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie man von der Wahrheit dichter moralischer Aussagen zu der Richtigkeit moralischer Normen gelangt. Es untersucht Habermas' Verständnis moralischer Richtigkeit und analysiert verschiedene Interpretationsmodelle der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen moralischen Normen und moralischen WERTAUSSAGEN.
- Kapitel VI: Dieses Kapitel diskutiert realistische und anti-realistische Auffassungen der Richtigkeit moralischer Normen. Es beleuchtet Habermas' Auseinandersetzung mit der realistischen Lektüre der Diskursethik von C. Lafont und untersucht die Übertragung dieser Konzepte auf den moralischen Fall.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Schlüsselbegriffen wie: postempiristische Sprachphilosophie, metaethische Diskussion, moralischer Realismus, moralischer Kognitivismus, Wahrheit dichter moralischer Aussagen, Richtigkeit moralischer Normen, perspektivistisches Wissen, Habermas, Williams, Putnam, Diskursethik.
- Quote paper
- Olga Ramírez Calle (Author), 2004, Konsequenzen der post-empiristischen Sprachphilosophie für die metaethische Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176516