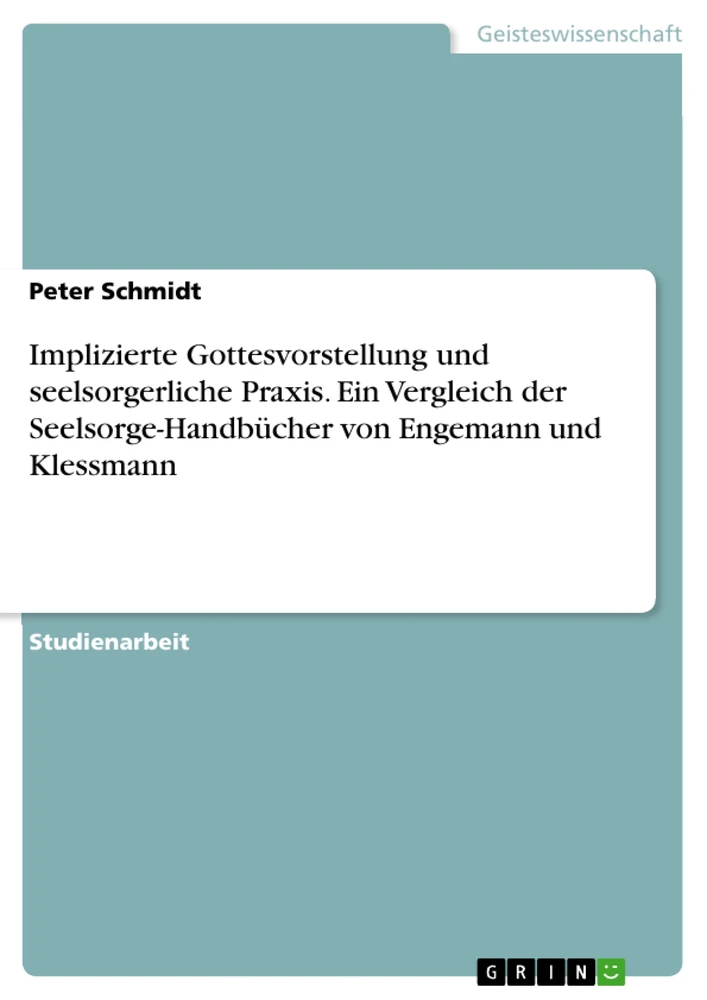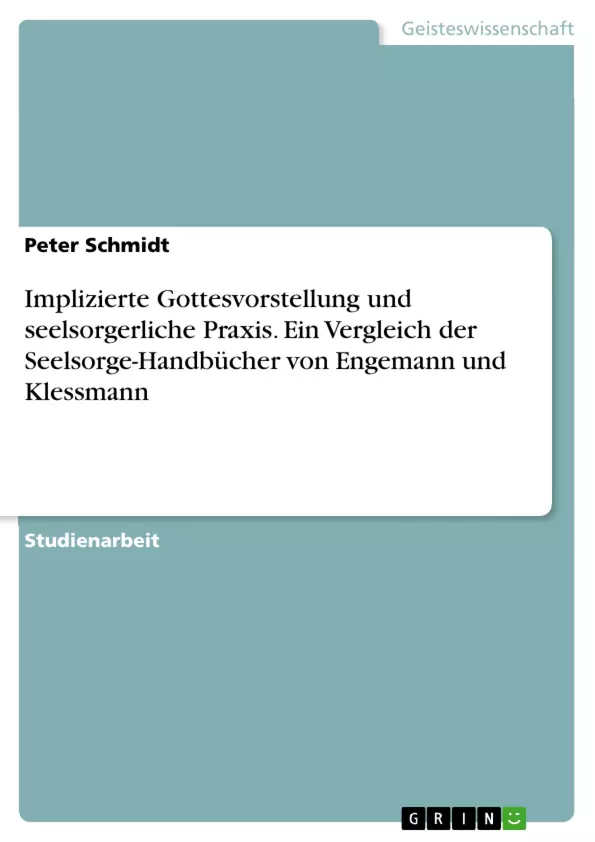Beide Herausgeber der Seelsorge-Handbücher, Engemann und Klessmann, vertreten eine lutherische Gottesvorstellung. Trotz dessen lösen sie diese in ihrer seelsorgerlichen Praxis unterschiedlich auf, was ich auf ihre Biographie zurückführe.
Engemann konzipiert Seelsorge als Gespräch mit Lehrdimension. Christlichen Ratsuchenden soll "Lebenskunst" also Hilfe zur Selbsthilfe beigebracht werden, insbesondere um sich selbst aus den gesellschaftlichen Zwängen der Erlebnisgesellschaft befreien zu können und insoweit die Heilung des "erschöpften Selbst" zu erfahren. Der "Clou" von Engemanns Theologie ist dabei die Trennung der Heilssphären Soteriologie und "Lebenskunst". Das poimenische Konzept "Lebenskunst" ist einerseits dogmatischer "Lückenfüller"; andererseits kann des-sen Grundlage, die Autonomie des Menschen, theologisch von der Gottesebenbildlichkeit ableitet und gegenüber dem Determinismus der physikalistischen Identitätstheorie mit dem Leib-Seele-Dualismus auch philosophisch verteidigt werden. Die "Freiheit zu etwas", nämlich zu einer gelungenen Lebensführung des "werdenen Selbst", unterscheidet Engemann von der "Freiheit von etwas", nämlich der Freiheit von z.B. Erbsünde oder Neurosen. Engemann grenzt sich also gegenüber beiden dominanten Paradigmen von Seelsorge des 20. Jahrhunderts, der kerygmatischen wie auch der therapeutischen Seelsorge, ab.
Klessmann hingegen übernimmt beide Paradigmen in seine poimenische Konzeption als "Begegnung" und "Begleitung" (therapeutisch) sowie "Lebensdeutung" im Horizont christlichen Glaubens (kerygmatisch). Der "Clou" von Klessmanns Poimenik ist also die Verbindung therapeutischer und kerygmatischer Elemente. Die Engemann'sche Trennung der Heilssphären kann Klessmann nicht nachvollziehen. Seine Poimenik hat durchgehend enge Bezüge zur Soteriologie, was sich inbesondere im Konzept der "Lebensdeutung" zeigt, bei der der christliche Glaube "ins Spiel" gebracht werden kann. Dass sich Klessmann gegenüber der therapeutisch üblichen Methode der affektiven Neutralität abgrenzt, ist mit der biographischen Erfahrung des "gerechten Ärger" begründbar; der "gerechte Ärger" Klessmanns findet sich wesentlich stärker im kerygmatischen Anteil von Klessmanns Poimenik in Form des Seelsorgers als "Prophet", der mit "widerständiger Haltung" das inhumane "System Krankenhaus" sowie die gesellschaftliche Überhöhung von Gesundheit als "höchstes Gut" im Gespräch mit den Mitarbeitenden des Krankenhauses sowie den Patienten kritisiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- 1. Hermeneutisches Vorverständnis
- 2. Exegese der Themenstellung und Methodik
- II. HAUPTTEIL
- 1. Das Seelsorge-Handbuch von Engemann
- 1.1 Engemanns Biographie
- 1.2 Die seelsorgerliche Praxis
- 1.2.1 Das Verständnis von Praktischer Theologie und der Aufbau des Handbuches
- 1.2.2 Die Problemstellung in der Seelsorge
- 1.2.3 Das Ziel der Seelsorge
- 1.2.4 Die Mittel des Seelsorgenden
- 1.3 Die Gottesvorstellung und ihre Rolle für die seelsorgerliche Praxis
- 1.3.1 Die Prolegomena
- 1.3.2 Von Gott
- 1.3.3 Vom Mensch
- 1.3.4 Vom Heil zwischen Gott und Mensch
- 2. Das Seelsorge-Handbuch von Klessmann
- 2.1 Klessmanns Biographie
- 2.2 Die seelsorgerliche Praxis
- 2.2.1 Das Verständnis von Praktischer Theologie und der Aufbau des Handbuches
- 2.2.2 Die Problemstellung in der Seelsorge
- 2.2.3 Das Ziel der Seelsorge
- 2.2.4 Die Mittel des Seelsorgenden
- 2.3 Die Gottesvorstellung und ihre Rolle für die seelsorgerliche Praxis
- 2.3.1 Die Prolegomena
- 2.3.2 Von Gott
- 2.3.3 Vom Mensch
- 2.3.4 Vom Heil zwischen Gott und Mensch
- 3. Der Vergleich hinsichtlich der Rolle der Gottesvorstellung
- 3.1 Die Prolegomena und ihre Rolle für die Poimenik
- 3.2 Von Gott und seine Rolle für die Poimenik
- 3.3 Vom Mensch und seine Rolle für die Poimenik
- 3.4 Vom Heil zwischen Gott und Mensch und seine Rolle für die Poimenik
- Die Hermeneutische Analyse der Gottesvorstellungen in den Handbüchern
- Der Vergleich der seelsorgerlichen Praxis in den Handbüchern
- Die Rolle der Gottesvorstellung in der seelsorgerlichen Praxis
- Die Implikationen der Gottesvorstellungen für die Poimenik
- Die Bedeutung der Prolegomena für die seelsorgerliche Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit einem Vergleich der Seelsorge-Handbücher von Wilfried Engemann (2007) und Michael Klessmann (2008) hinsichtlich der implizierten Gottesvorstellung und ihrer Rolle für die seelsorgerliche Praxis. Ziel ist es, die Gottesvorstellungen der Herausgeber zu erforschen und ihre Auswirkung auf die seelsorgerliche Praxis zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem hermeneutischen Vorverständnis und der Exegese der Themenstellung und Methodik. Der Hauptteil analysiert die Seelsorge-Handbücher von Engemann und Klessmann, wobei die Biografien der Autoren sowie die seelsorgerliche Praxis und die Gottesvorstellungen der Herausgeber im Fokus stehen. Der Vergleich hinsichtlich der Rolle der Gottesvorstellung erfolgt im dritten Teil, wobei die Prolegomena, Gott, Mensch und das Heil zwischen Gott und Mensch analysiert werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der wissenschaftlichen Hausarbeit sind Seelsorge, Gottesvorstellung, Poimenik, Praktische Theologie, Engemann, Klessmann, Handbuch, Vergleich, Hermeneutik, Prolegomena, Heil.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vergleichs der Seelsorge-Handbücher?
Ziel ist es, die impliziten Gottesvorstellungen von Wilfried Engemann und Michael Klessmann zu analysieren und zu zeigen, wie diese ihre jeweilige seelsorgerliche Praxis beeinflussen.
Wie versteht Engemann die seelsorgerliche Praxis?
Engemann konzipiert Seelsorge als „Lebenskunst“ und Hilfe zur Selbsthilfe. Er trennt dabei strikt zwischen der Sphäre des Heils (Soteriologie) und der psychologischen Lebensführung.
Was ist das Besondere an Klessmanns Poimenik?
Klessmann verbindet therapeutische Elemente (Begegnung und Begleitung) mit kerygmatischen Elementen (Lebensdeutung im Glauben). Er lehnt die Trennung der Heilssphären ab.
Welche Rolle spielt die Biographie der Herausgeber?
Die Arbeit führt die unterschiedlichen Ansätze auf die Biographien zurück. So wird Klessmanns Konzept des „gerechten Ärgers“ und der widerständigen Haltung mit seinen persönlichen Erfahrungen erklärt.
Wie definieren die Autoren den Menschen in der Seelsorge?
Engemann betont die Autonomie und Gottesebenbildlichkeit des Menschen, während Klessmann den Menschen stärker in seinem sozialen System und im Horizont der christlichen Botschaft sieht.
Was sind die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit?
Die wichtigsten Begriffe sind Seelsorge, Gottesvorstellung, Poimenik, Praktische Theologie, Hermeneutik und Heil.
- Quote paper
- Diplom-Theologe (Univ.) Diplom-Verwaltungswirt (FH) Peter Schmidt (Author), 2011, Implizierte Gottesvorstellung und seelsorgerliche Praxis. Ein Vergleich der Seelsorge-Handbücher von Engemann und Klessmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176543