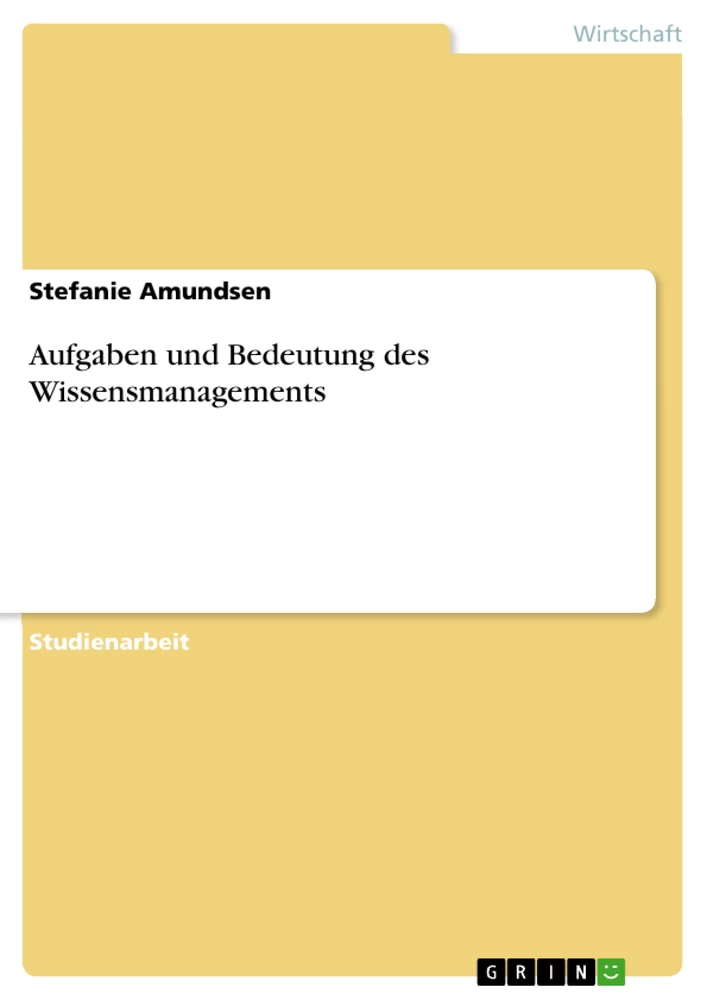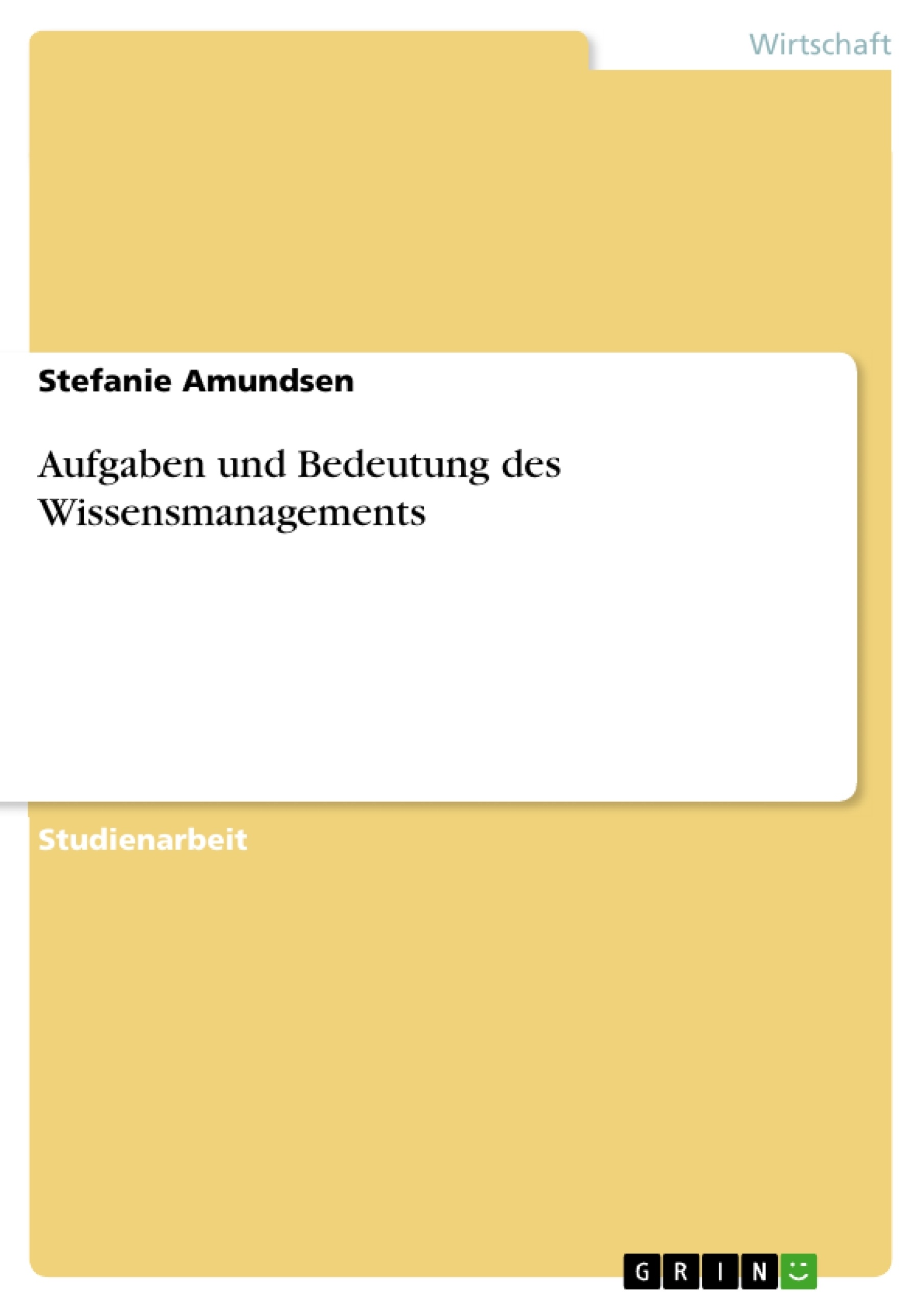Das Wissen einer Organisation ist im Zuge immer kürzer werdender Produktions- und Entwicklungszeiten, Rationalisierungsbestrebungen und eines intensiven globalen Wettbewerbs zu einem wichtigen Innovations- und Wettbewerbsfaktor aufgestiegen. Wissen wird in der Volkswirtschaftslehre neben Arbeit, Boden und Kapital als weiterer bedeutender volkswirtschaftlicher Faktor angesiedelt. Schon der bekannte englische Philosoph Francis Bacon (1561–1626) sagte im Jahre 1597: „Wissen ist Macht“.
Für Organisationen wird es also unumgänglich, wenn nicht sogar überlebensnotwendig,sich rechtzeitig und ausführlich mit der Ressource Wissen zu beschäftigen. Die Erhaltung des Wissens erfordert neue Ideen, Konzepte und vor allem neue Betrachtungsweisen der ursprünglichen Kernprozesse der Organisationen.
Doch was versteht man in diesem Zusammenhang unter Wissensmanagement? Was ist eigentlich Wissen und wie entsteht es? Was sind die Aufgaben des Wissensmanagements und wie bedeutsam ist es insbesondere für Organisationen? Diese Fragestellungen sollen in der folgenden Hausarbeit durch eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema erarbeitet werden.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Aufgaben und der Bedeutung des Wissensmanagements. Die primäre Zielsetzung besteht darin, dessen Bedeutung und Nutzen im Kontext zu Organisationen zu betrachten. Zunächst erfolgt daher eine kurze begriffliche Bestimmung von Zeichen, Daten, Informationen und Wissen. Außerdem werden für das tiefere Verständnis die wichtigsten Wissensarten kurz erläutert. Danach wird die organisationale Wissensbasis vorgestellt. Nach den Grundlagen folgen Abschnitte über die Aufgaben des Wissensmanagements sowie ein Ausblick auf ausgewählte Ansätze. Anschließend wird die Bedeutung des Wissensmanagements für Organisationen dargestellt. In einem Fazit werden am Ende der Hausarbeit die wichtigsten Inhalte kurz zusammengefasst und kritisch gewürdigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung Wissensmanagement
- 2.1 Zeichen, Daten, Informationen und Wissen
- 2.2 Wissensarten
- 2.3 Definition Wissensmanagement
- 3. Aufgaben des Wissensmanagements
- 3.1 Ansätze des Wissensmanagements
- 3.2 Konzepte des Wissensmanagements
- 3.2.1 Konzept nach Nonaka und Takeuchi
- 3.2.2 Konzept von Probst et al.
- 4. Bedeutung des Wissensmanagements
- 4.1 Wissen als Produktionsfaktor
- 4.2 Entwicklung der Wissensgesellschaft
- 4.2.1 Wissensarbeiter
- 4.2.2 Problem der Informationsflut
- 4.3 Wissensmanagement im demographischen Wandel
- 4.4 Empirische Studie zum Wissensmanagement
- 4.5 Wissensmanagement als Wettbewerbsvorteil
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Aufgaben und der Bedeutung des Wissensmanagements in Organisationen. Ziel ist es, die Relevanz dieser Thematik für Unternehmen zu beleuchten und verschiedene Aspekte des Wissensmanagements zu erörtern.
- Definition und Abgrenzung von Wissen und Wissensmanagement
- Aufgaben und Ansätze des Wissensmanagements
- Die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor in der heutigen Wirtschaft
- Der Einfluss des demografischen Wandels auf das Wissensmanagement
- Wissensmanagement als strategischer Wettbewerbsvorteil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Wissensmanagement ein und verdeutlicht die steigende Bedeutung von Wissen für Unternehmen in Zeiten des globalen Wettbewerbs. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor.
Kapitel 2 widmet sich der begrifflichen Bestimmung von Wissensmanagement. Es werden die Unterschiede zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen erläutert, verschiedene Wissensarten vorgestellt und die Definition des Wissensmanagements erörtert.
Kapitel 3 beleuchtet die Aufgaben des Wissensmanagements und stellt verschiedene Ansätze und Konzepte vor, darunter das Konzept von Nonaka und Takeuchi sowie das von Probst et al.
Kapitel 4 untersucht die Bedeutung des Wissensmanagements für Unternehmen. Es wird die Rolle des Wissens als Produktionsfaktor sowie die Entwicklung der Wissensgesellschaft beleuchtet. Zudem werden die Herausforderungen des demografischen Wandels im Kontext des Wissensmanagements betrachtet und empirische Studien zu diesem Thema vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Wissensmanagement, Wissensarten, Aufgaben des Wissensmanagements, Bedeutung des Wissens, Produktionsfaktor, Wissensgesellschaft, demographischer Wandel und Wissensmanagement als Wettbewerbsvorteil.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Wissen im Vergleich zu Daten und Informationen definiert?
Die Arbeit grenzt Zeichen, Daten und Informationen voneinander ab, wobei Wissen als die höchstwertige Stufe durch Vernetzung und Anwendung von Informationen entsteht.
Welche Konzepte des Wissensmanagements werden vorgestellt?
Es werden insbesondere das Modell von Nonaka und Takeuchi (SECI-Modell) sowie die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al. erläutert.
Warum ist Wissensmanagement im demografischen Wandel so wichtig?
Durch das Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter droht ein massiver Wissensverlust; Wissensmanagement hilft dabei, dieses "implizite Wissen" im Unternehmen zu sichern.
Was versteht man unter dem Begriff "Wissensgesellschaft"?
Es beschreibt eine Gesellschaftsform, in der Wissen neben Arbeit, Boden und Kapital zum zentralen Produktionsfaktor und Wettbewerbsvorteil geworden ist.
Welche Aufgaben übernimmt ein effektives Wissensmanagement?
Zu den Aufgaben gehören die Identifikation, der Erwerb, die Entwicklung, die Verteilung, die Nutzung und die Bewahrung von Wissen innerhalb einer Organisation.
- Quote paper
- Dipl.-Kffr. (FH) Stefanie Amundsen (Author), 2010, Aufgaben und Bedeutung des Wissensmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176558