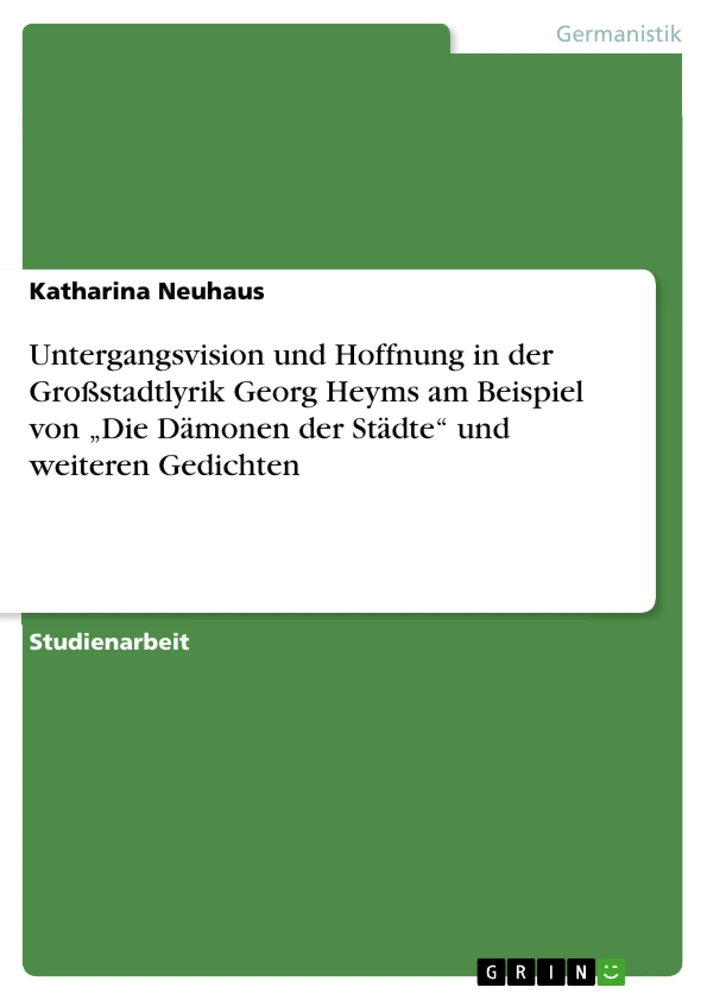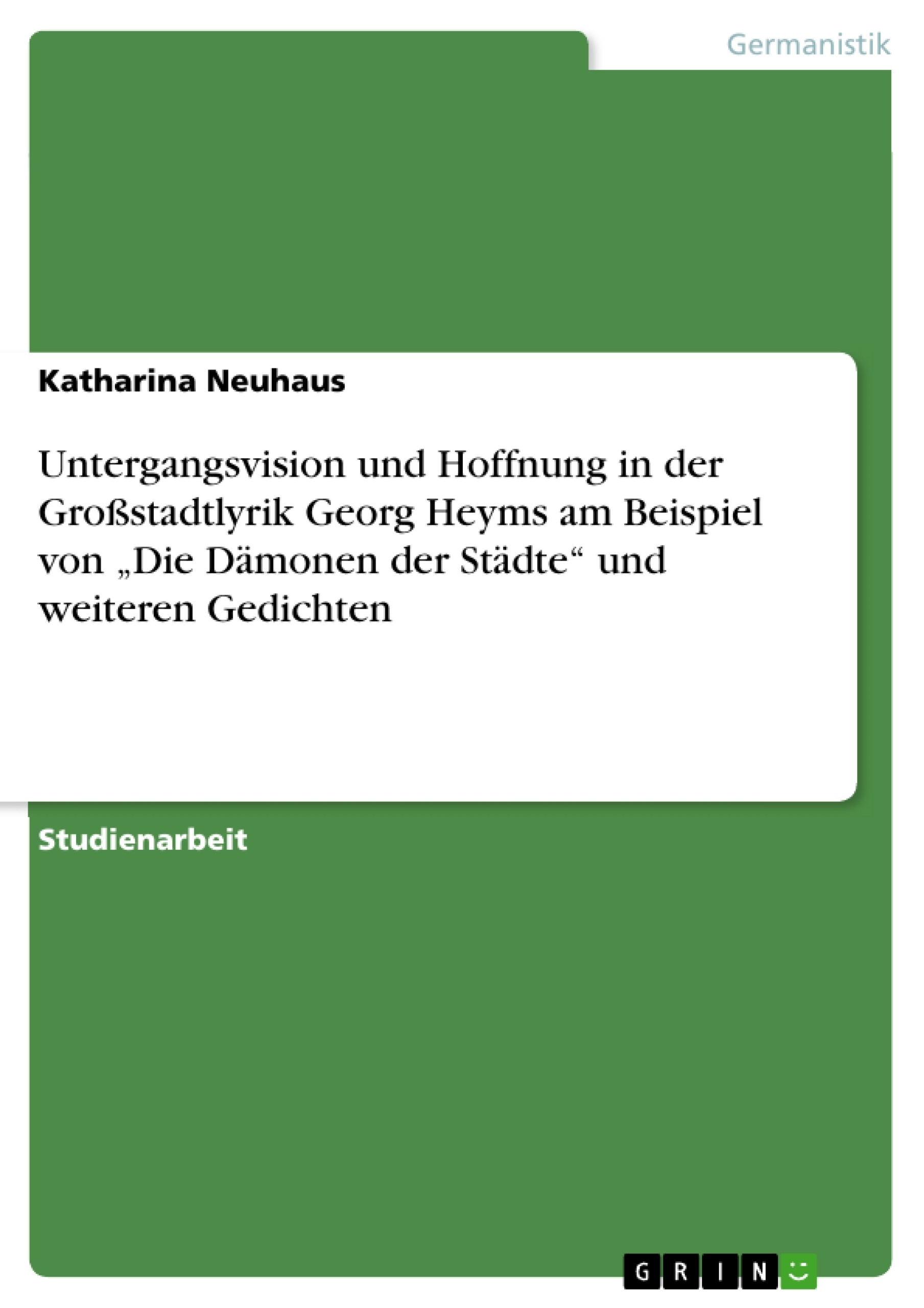„Sie [i.e. die Dämonen, K.N.] lehnen schwer auf einer Brückenwand
Und strecken ihre Hände in den Schwarm
Der Menschen aus, wie Faune, die am Rand
Der Sümpfe bohren in den Schlamm den Arm.“
Georg Heym, Die Dämonen der Städte
Als sich in der Übergangszeit vom 19. ins 20. Jahrhundert der technische und indust-rielle Fortschritt rasant entwickelt, verändert sich besonders in den Großstädten das Leben der Menschen gravierend. Wie dieser Wandel sich in der Lyrik Georg Heyms darstellt, möchte ich exemplarisch anhand des Gedichts „Die Dämonen der Städte“ und dreier weiterer ausgewählter Gedichte untersuchen.
Der Hauptteil meiner Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Nach einer kurzen Ein-führung in den literarischen Expressionismus und in die Situation der Großstadt zur damaligen Zeit folgt eine ausführliche Interpretation des Gedichts „Die Dämonen der Städte“. Von besonderem Interesse ist dabei zunächst, mit welchen Mitteln das titel-gebende Dämonische dargestellt wird und welchen Einfluss es auf die Städte und die darin lebenden Menschen hat. Mit der Frage, ob das Gedicht einen Lösungsan-satz dafür anbietet, wie der Mensch mit dem Dämonischen, mit der Bedrohung, die von den „Dämonen der Städte“ ausgeht, umgehen kann oder soll, beschäftige ich mich im Anschluss daran.
Im dritten Teil meiner Arbeit ziehe ich die Heym-Gedichte „Umbra Vitae“, „Der Gott der Stadt“ und „Die Stadt“ zu einem Vergleich heran. Eine ausführliche Inter-pretation ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich; es erfolgt daher eine Konzent-ration auf ausgewählte Themen. So untersuche ich, wie es sich mit der Darstellung der Menschen in diesen Gedichten verhält und was sie gegebenenfalls von den „Dä-monen der Städte“ unterscheidet. Von Interesse ist auch die Frage, ob es eine Mög-lichkeit für den Menschen gibt, sich aus der Dämonenherrschaft und den Zeitverhält-nissen zu befreien oder ob der Mensch rettungslos verloren in einer sterbenden Welt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Hintergrund
- Der literarische Expressionismus
- Großstadterfahrung im Expressionismus
- Das Menschenbild im Expressionismus
- Georg Heym und die Großstadt
- ,,Die Dämonen der Städte“
- Formale Analyse
- Darstellung der Dämonen
- Die Städte
- Der Mensch in der Stadt
- Naturerfahrung
- Mythologisierung
- Fazit: Apokalyptische Endzeitstimmung
- Stadt und Menschenbild in weiteren Gedichten von Georg Heym
- ,,Der Gott der Stadt“
- „Umbra Vitae“
- ,,Die Stadt“
- Hintergrund
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Großstadt in der Lyrik Georg Heyms am Beispiel des Gedichts „Die Dämonen der Städte“ und weiterer ausgewählter Gedichte. Dabei wird der Einfluss des literarischen Expressionismus auf Heyms Werk beleuchtet und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Stadt in der expressionistischen Ära untersucht.
- Der Einfluss des literarischen Expressionismus auf die Darstellung der Großstadt
- Die Bedeutung des „Dämonischen“ in Heyms Gedicht „Die Dämonen der Städte“
- Das Menschenbild in Heyms Großstadtlyrik
- Der Konflikt zwischen Mensch und Stadt in Heyms Gedichten
- Mögliche Hoffnungszeichen und Fluchtmöglichkeiten in Heyms Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Großstadtlyrik Georg Heyms ein und erläutert den Kontext der Arbeit. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar und gibt einen Überblick über den Aufbau des Hauptteils. Der erste Abschnitt des Hauptteils befasst sich mit dem literarischen Expressionismus und der Großstadterfahrung im frühen 20. Jahrhundert. Er beleuchtet die Herausforderungen, denen sich der Mensch in der Großstadt gegenübersieht, sowie die ästhetischen und inhaltlichen Merkmale des Expressionismus. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse des Gedichts „Die Dämonen der Städte“. Dabei werden die Darstellung des Dämonischen, die Rolle der Städte und die Situation des Menschen in der Stadt analysiert. Der dritte Abschnitt untersucht weitere Gedichte von Georg Heym wie „Der Gott der Stadt“, „Umbra Vitae“ und „Die Stadt“, um die Thematik des Mensch-Stadt-Verhältnisses zu erweitern und zu vertiefen. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Gedichten herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselwörter: Großstadtlyrik, Expressionismus, Georg Heym, „Die Dämonen der Städte“, Stadt und Mensch, Dämonisierung, Apokalypse, Hoffnung, Flucht, Moderne, Industrialisierung, Technik, Mensch-Natur-Verhältnis.
- Quote paper
- Katharina Neuhaus (Author), 2011, Untergangsvision und Hoffnung in der Großstadtlyrik Georg Heyms am Beispiel von „Die Dämonen der Städte“ und weiteren Gedichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176609