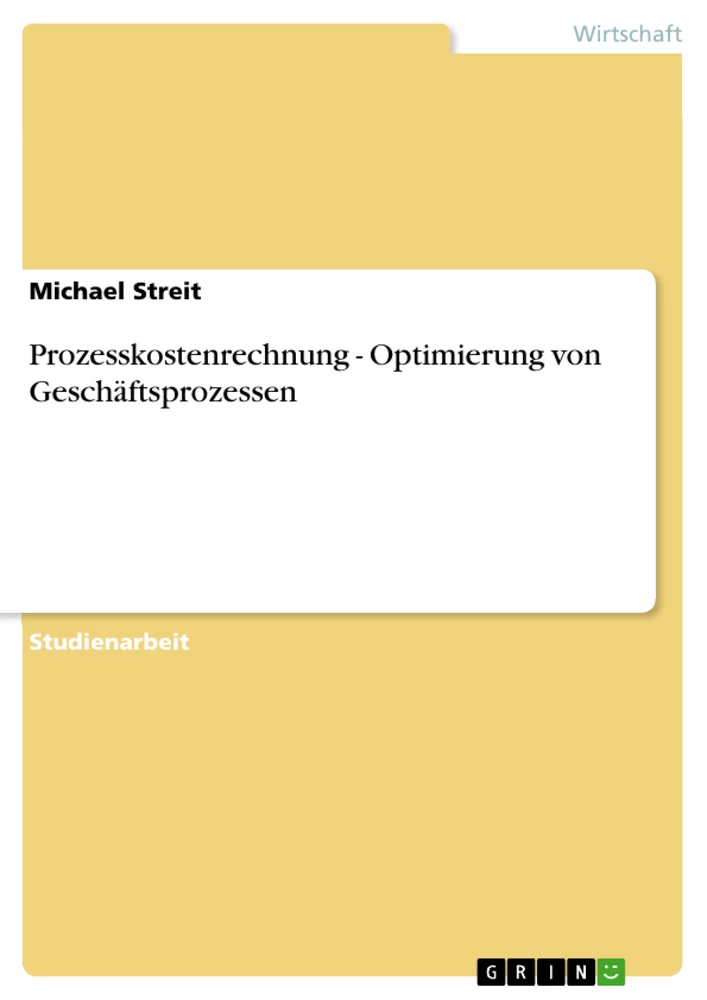Mit der vorliegenden Arbeit soll die Prozesskostenrechnung (im Folgenden: PKR) als ein sinnvolles Instrument vorgestellt werden, mit welchem abteilungsübergreifende Geschäftsprozesse analysiert und optimiert werden können. Neben einer kurzen Darstellung, wie die PKR in ein bestehendes, „traditionelles“ Kosten- und Leistungsrechnungssystem integriert werden kann, soll zunächst auf den Hintergrund der PKR eingegangen werden.
Nachdem die Ziele bzw. Aufgaben identifiziert wurden, sollen anschließend die einzelnenSchritte innerhalb der Vorgehensweise / Methodik der PKR eingehend beleuchtet werden. Im Anschluss daran wird ein vorher genannter Anwendungsfall mit Zahlen „gefüttert“.
Ergänzend zu den bisherigen Punkten gibt es bestimmte Voraussetzungen für die Anwendung der PKR, die – ebenso wie die Einsatzgebiete sowie die Vor- und Nachteile – kurz beschrieben bzw. genannt werden sollen.
Abschließend wird noch auf die Anwendung der PKR bei Prozessinnovationen und innovativen Produkten eingegangen, um den Praxisbezug dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Studiengang „Innovation im Mittelstand“ an der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt zu erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Problemstellung und Vorgehensweise
2. Ansatz der PKR und Integration in die traditionelle Kosten- und Leistungsrechnung
2.1 Ansatz und Integration
2.2 Anwendungsfall: Zuschlagskalkulation vs. prozessorientierte Kalkulation
3. Hintergrund der PKR
4. Ziele / Aufgaben der PKR
5. Vorgehensweise / Methodik
5.1 Ansatz
5.2 Tätigkeitsanalyse
5.3 Identifikation von Teil- und Hauptprozessen
5.4 Festlegung von Bezugsgrößen
5.5 Ermittlung von Prozesskostensätzen
5.6 Anwendungsbeispiel: Zuschlagskalkulation vs. prozessorientierte Kalkulation
6. Anwendungsvoraussetzungen und Einsatzgebiete der PKR
6.1 Anwendungsvoraussetzungen der PKR
6.2 Einsatzgebiete der PKR
7. Pro und Contra
8. Einsatz der PKR bei Produkt- und Prozessinnovationen
Literaturverzeichnis
-
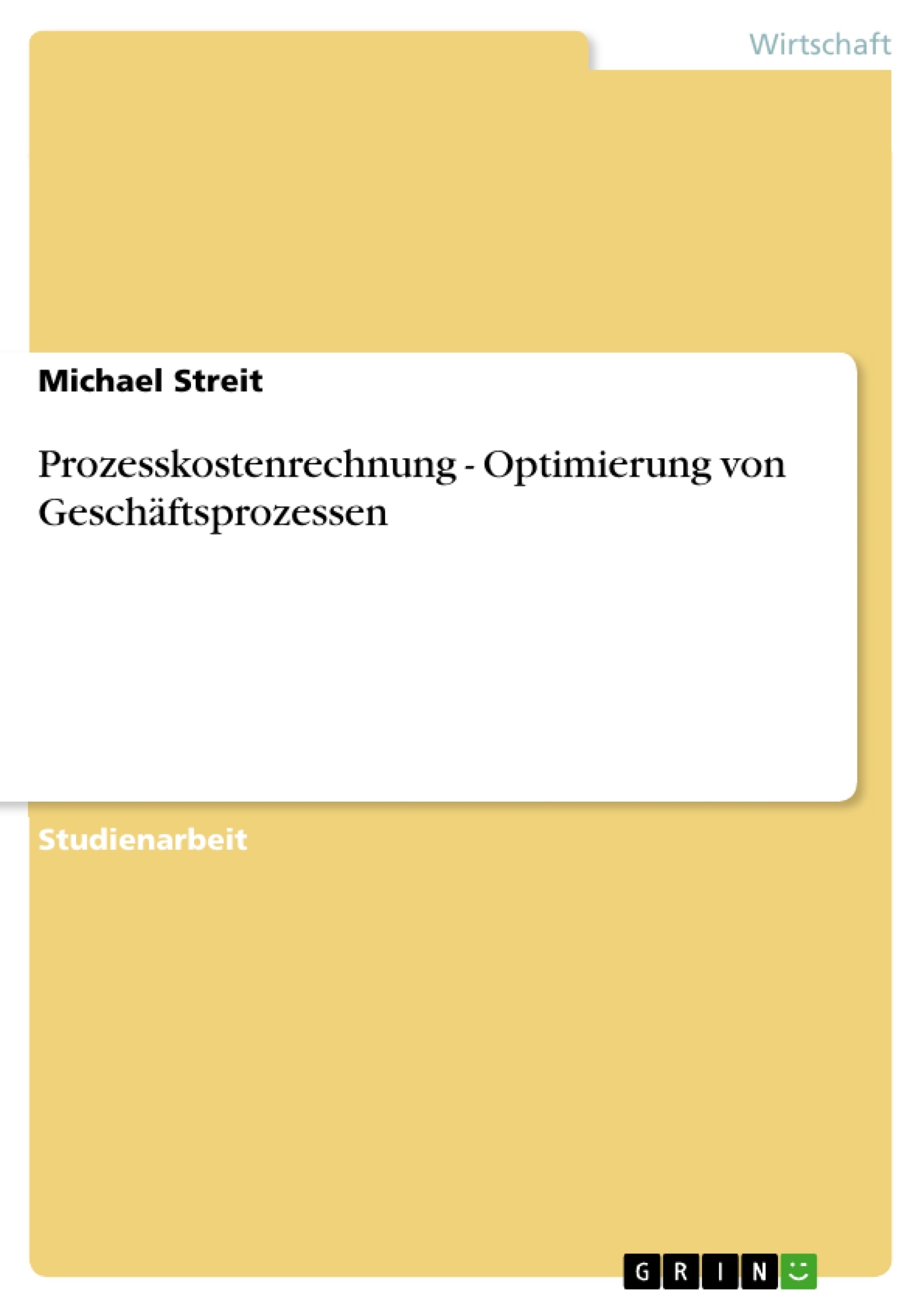
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.