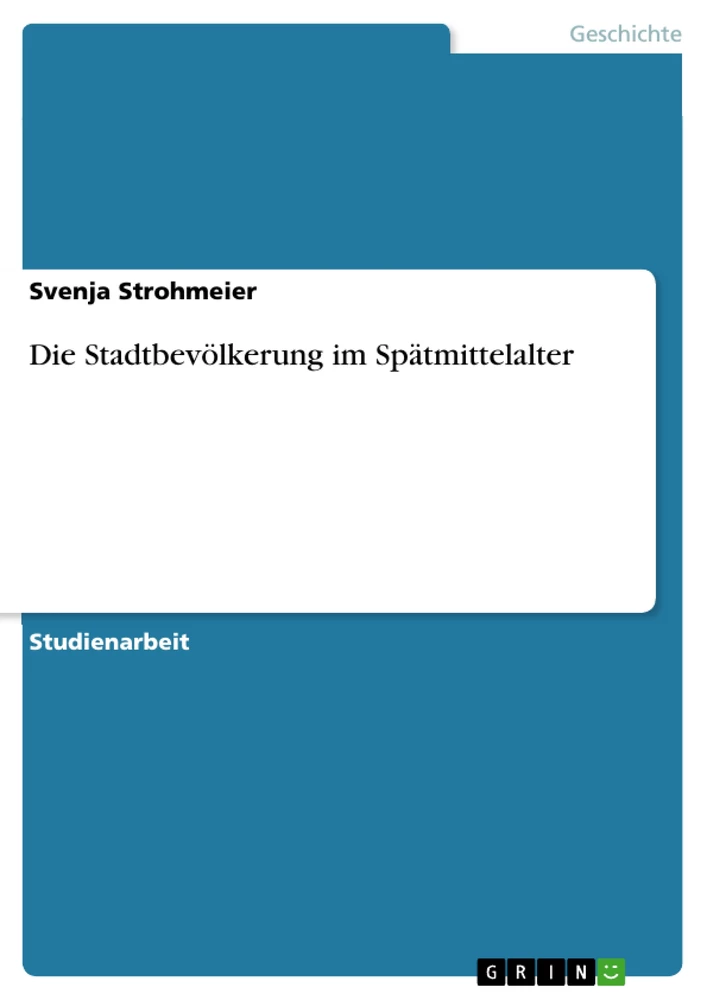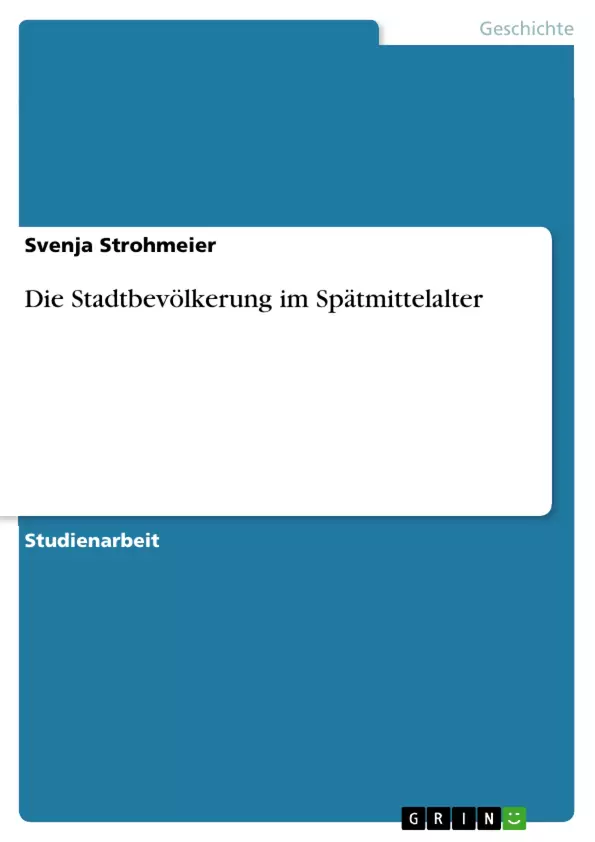II Leben in der Stadt
Die soziale Gruppe der Stadtbewohner entstand in einer Zeit, in welcher auch viele Quellen entstanden. Ein offizieller Stadtbürger war man entweder durch Geburt oder durch das Zuziehen vom Lande, wenn man denn frei war von einem Grundherrn (Juden bspw. konnten als Nicht-Christen kein Bürgerrecht erlangen, sie waren lediglich „Einwohner“1).
Für die Mitte des 14. Jahrhunderts wird der Anteil der Stadtbewohner auf etwa 20% der Gesamtbevölkerung geschätzt2.
In den Städten erreichte man eine hohe Effizienz bei der Produktion aller Produkte, Absatzmärkte gab es direkt dort am Markt. Die Produktion war meist höher als der Stadtverbrauch, dies nutzte man für Fernhandelsgeschäfte.
Geschlossene Städtebünde bekamen dadurch politisches und militärisches Gewicht, wurden aber trotz ihres meist defensiven Charakters 1231 reichsrechtlich verboten.3
Ein großes Sozialgefälle herrschte innerhalb der Städte: Die wohlhabende Ratsfamilien bildeten die Oberschicht, kleine Handwerker, Gesellen, Tagelöhner usw. die Unterschicht auf Existenzminimum (in diese Sparte gehörten auch Bettler etc.) Einen besonders negativen Status hatten gewisse „unehrliche“ Berufe, wie der des Scharfrichters, Henkers oder Abdeckers. Auch fahrende Spielleute und Totengräber gehörten dazu; Nachkommen dieser „unehrlichen Familien“ hatten kaum Chancen, später einen anderen, ehrlichen Bruf auszuüben.4
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Leben in der Stadt
- III. Soziale Gliederung der Stadt
- IV. Fazit: Städte als Gewinner der Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Reflektion beleuchtet die Stadtbevölkerung im Spätmittelalter und bietet einen Überblick über die Gesellschaft, das tägliche Leben und die Wirtschaft dieser Epoche. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Städte als Zentren des Handels und der Wirtschaft, sowie der sozialen Strukturen und Unterschiede innerhalb der städtischen Bevölkerung.
- Die Entstehung der Stadtbevölkerung und ihre soziale Einordnung
- Das Leben in den Städten: Wirtschaft, Handel, soziale Unterschiede
- Die Rolle von Zünften und die Organisation des Handwerks
- Die städtische Oberschicht und ihre Machtposition
- Die soziale Kluft zwischen Stadt und Land
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Reflektion dar: Wie war das Leben der Stadtbevölkerung im Spätmittelalter geprägt? Sie gibt einen kurzen Einblick in die Dynamik und die Rolle des Bürgertums in der damaligen Gesellschaft.
II. Leben in der Stadt
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Stadtbevölkerung und die besonderen Bedingungen des städtischen Lebens. Es beleuchtet die wirtschaftliche Bedeutung der Städte und deren Rolle im Fernhandel. Die soziale Gliederung der Stadtbevölkerung, einschließlich der Zünfte und der unterschiedlichen sozialen Klassen, wird ebenfalls thematisiert.
III. Soziale Gliederung der Stadt
In diesem Kapitel wird die soziale Gliederung der Stadtbevölkerung detailliert dargestellt. Die Oberschicht und die breite Unterschicht der "Habenichtse" werden beschrieben, sowie die Rolle der Zünfte für die Organisation des Handwerks.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Reflektion sind: Stadtbevölkerung, Spätmittelalter, soziale Gliederung, Zünfte, Wirtschaft, Handel, Oberschicht, Unterschicht, Bürgerrecht, Stadt und Land.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde man im Spätmittelalter zum Stadtbürger?
Man erhielt das Bürgerrecht entweder durch Geburt oder durch Zuzug vom Land, sofern man frei von einem Grundherrn war. Nicht-Christen wie Juden blieb das volle Bürgerrecht verwehrt.
Welche sozialen Unterschiede gab es in mittelalterlichen Städten?
Es herrschte ein großes Sozialgefälle zwischen der Oberschicht (wohlhabende Ratsfamilien) und der Unterschicht (Handwerker, Tagelöhner, Bettler), die oft am Existenzminimum lebte.
Was waren „unehrliche“ Berufe?
Berufe wie Scharfrichter, Abdecker oder Totengräber galten als „unehrlich“. Nachkommen dieser Familien hatten kaum Chancen, jemals einen anderen Beruf auszuüben.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hatten Städte im Spätmittelalter?
Städte waren Zentren für Produktion und Handel. Überschüsse wurden oft für den Fernhandel genutzt, was Städten politisches und militärisches Gewicht verlieh.
Warum wurden Städtebünde im Jahr 1231 verboten?
Trotz ihres defensiven Charakters wurden geschlossene Städtebünde reichsrechtlich verboten, um die Machtkonzentration der Städte gegenüber dem Adel zu begrenzen.
- Quote paper
- Svenja Strohmeier (Author), 2011, Die Stadtbevölkerung im Spätmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176642