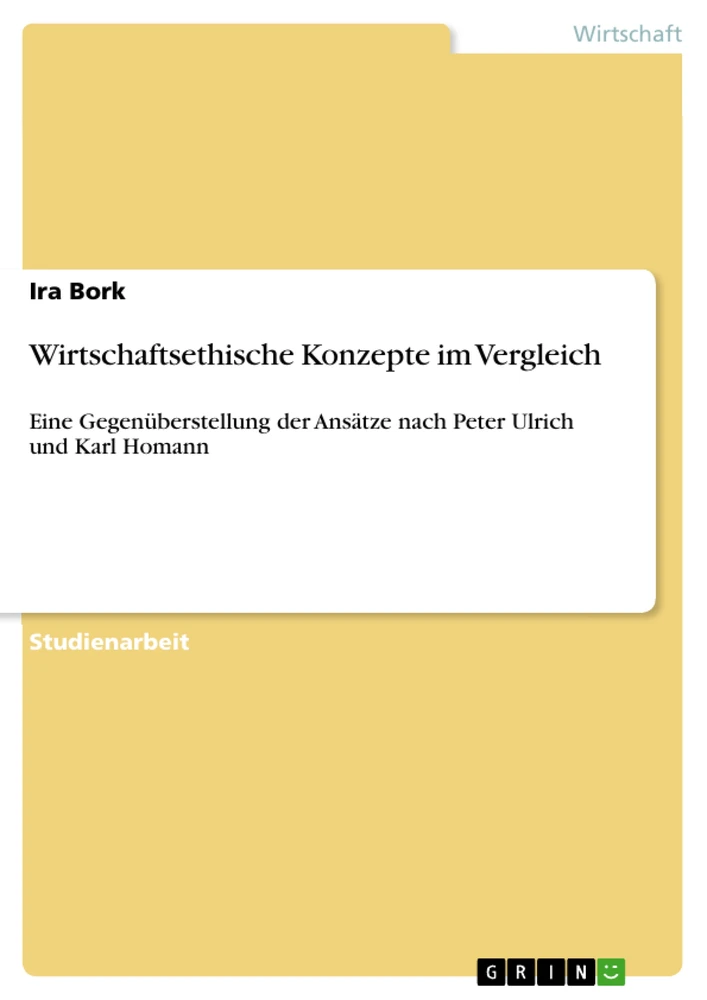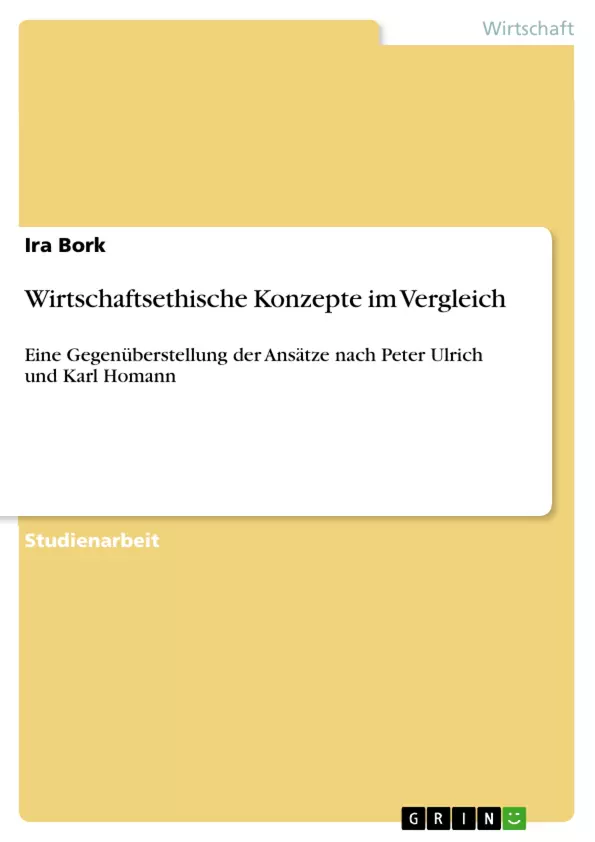Einleitung
„To be ethical because it is profitable is not ethical. But
to be ethical is profitable.“
Das Thema der Wirtschaftsethik hat in den letzen Jahren eine immer
stärkere Beachtung in Wissenschaft und Praxis erfahren. In einer internatio¬nal vernetzten Weltwirtschaft mit vielen noch nicht gelösten tiefgreifenden sozialen und ökonomischen Problemen wie z.B. Hunger, Armut, Kindersterb¬lichkeit, Kriminalität, wachsender Massenarbeitslosigkeit, Korruption,
zunehmender Umweltzerstörungen und Shareholder Value stellt sich die Frage nach tragfähigen wirtschaftsethischen Konzepten heute wieder neu.
Bei den vorliegenden Missständen handelt es sich nicht nur um systemati¬sche Wirtschaftsprobleme, sondern vielmehr auch um tiefgreifende morali¬sche Probleme. Dadurch wird die Frage nach normativen Grundlagen des
Wirtschaftens aufgeworfen, welche wichtig ist, damit jeder Einzelne die An¬forderungen, die durch die Globalisierung entstehen können, handhaben kann.
Der Begriff Wirtschaftsethik lässt sich folgendermaßen definieren: Vor dem Hintergrund der Ethik versucht die Wirtschaftsethik praktisch anwendbare Lösungsansätze für moralische Probleme der Wirtschaft zu formulieren.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zwei wirtschaftsethische
Ansätze, zum einen der nach Peter Ulrich und zum anderen der nach Karl Homann nicht ausführlich vorgestellt, sondern während des Vergleichs inte¬grativ beschrieben.
Ziel dieser Arbeit ist es die markantesten Divergenzen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Begonnen wird mit der Vorstellung von Peter Ulrich und Karl Homann. Anschließend werden die beiden Konzepte miteinander vergli¬chen, wobei zunächst auf Divergenzen und danach auf Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte eingegangen wird, bevor die Arbeit mit einem Kapitel zu den Schlussfolgerungen schließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 ,,To be ethical because it is profitable is not ethical. But to be ethical is profitable.\"
- 2 Vorstellung von Peter Ulrich und Karl Homann
- 2.1 Zur Person Peter Ulrich
- 2.2 Zur Person Karl Homann
- 3 Divergenzen in den Konzepten von Peter Ulrich und Karl Homann
- 4 Gemeinsamkeiten in den Konzepten von Peter Ulrich und Karl Homann
- 5 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die wirtschaftsethischen Konzepte von Peter Ulrich und Karl Homann vergleichend gegenüberzustellen und ihre wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Ansätze und ihrer Implikationen für die Wirtschaftsethik.
- Vergleich der wirtschaftsethischen Konzepte von Peter Ulrich und Karl Homann
- Analyse der Divergenzen zwischen den beiden Konzepten
- Identifizierung der Gemeinsamkeiten beider Ansätze
- Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen
- Reflexion der Bedeutung der Konzepte für aktuelle wirtschaftsethische Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 ,,To be ethical because it is profitable is not ethical. But to be ethical is profitable.": Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der Wirtschaftsethik ein und betont deren wachsende Bedeutung angesichts globaler sozialer und ökonomischer Herausforderungen wie Armut, Umweltzerstörung und Korruption. Es wird die Notwendigkeit tragfähiger wirtschaftsethischer Konzepte hervorgehoben und der Begriff der Wirtschaftsethik definiert als die Suche nach praktisch anwendbaren Lösungen für moralische Probleme in der Wirtschaft. Das Zitat im Kapiteltitel verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen Ethik und Profitabilität.
2 Vorstellung von Peter Ulrich und Karl Homann: Dieses Kapitel präsentiert biographische Informationen über Peter Ulrich und Karl Homann, die beiden zentralen Figuren der Arbeit. Es beschreibt den akademischen Werdegang und die beruflichen Stationen beider Autoren, unterstreicht ihre Expertise im Bereich der Wirtschaftsethik und hebt deren Bedeutung für das Verständnis ihrer jeweiligen Konzepte hervor. Der Fokus liegt auf der Darstellung ihrer akademischen Laufbahnen und ihrer Positionierung im Feld der Wirtschaftsethik.
3 Divergenzen in den Konzepten von Peter Ulrich und Karl Homann: Dieses Kapitel, das im Originaltext nicht explizit beschrieben wird, wäre dem Vergleich der beiden Konzepte gewidmet. Es würde detailliert die unterschiedlichen ethischen Grundlagen, methodischen Ansätze und Schlussfolgerungen der Konzepte von Ulrich und Homann aufzeigen. Hier würden die spezifischen Argumente, die jeweiligen ethischen Prinzipien und deren Anwendung auf konkrete wirtschaftliche Fragestellungen untersucht und kontrastiert werden.
4 Gemeinsamkeiten in den Konzepten von Peter Ulrich und Karl Homann: Analog zu Kapitel 3, würde dieses Kapitel (ebenfalls nicht explizit im Originaltext erwähnt), die Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte untersuchen. Es würde die Übereinstimmungen in den ethischen Prinzipien, den Zielen und den methodischen Ansätzen herausarbeiten. Es würde untersucht werden, inwieweit die Konzepte trotz ihrer Unterschiede zu ähnlichen Schlussfolgerungen oder Empfehlungen in Bezug auf ethisches Handeln in der Wirtschaft gelangen.
Schlüsselwörter
Wirtschaftsethik, Peter Ulrich, Karl Homann, ethische Konzepte, Unternehmensethik, moralisches Handeln, Globalisierung, soziale Verantwortung, ökonomische Probleme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Vergleich der Wirtschaftsethischen Konzepte von Peter Ulrich und Karl Homann
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die wirtschaftsethischen Konzepte von Peter Ulrich und Karl Homann. Sie analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ansätze und deren Implikationen für die Wirtschaftsethik.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die wirtschaftsethischen Konzepte von Peter Ulrich und Karl Homann gegenüberzustellen, ihre wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu bewerten. Die Bedeutung der Konzepte für aktuelle wirtschaftsethische Herausforderungen wird reflektiert.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit umfasst eine Vorstellung von Peter Ulrich und Karl Homann, eine detaillierte Analyse der Divergenzen und Gemeinsamkeiten ihrer Konzepte, sowie eine Schlussfolgerung. Einleitend wird die Bedeutung von Wirtschaftsethik im Kontext globaler Herausforderungen betont.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 führt in die Thematik ein. Kapitel 2 stellt Peter Ulrich und Karl Homann vor. Kapitel 3 vergleicht die Divergenzen ihrer Konzepte. Kapitel 4 analysiert die Gemeinsamkeiten. Kapitel 5 beinhaltet die Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche konkreten Aspekte der Konzepte von Ulrich und Homann werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die ethischen Grundlagen, methodischen Ansätze und Schlussfolgerungen beider Konzepte. Untersucht werden die spezifischen Argumente, ethischen Prinzipien und deren Anwendung auf konkrete wirtschaftliche Fragestellungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Wirtschaftsethik, Peter Ulrich, Karl Homann, ethische Konzepte, Unternehmensethik, moralisches Handeln, Globalisierung, soziale Verantwortung, ökonomische Probleme.
Was ist die zentrale Aussage des einleitenden Kapitels?
Das einleitende Kapitel betont die wachsende Bedeutung von Wirtschaftsethik angesichts globaler Herausforderungen und die Notwendigkeit tragfähiger Konzepte. Das Zitat „To be ethical because it is profitable is not ethical. But to be ethical is profitable.“ verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen Ethik und Profitabilität.
Was wird in Kapitel 2 über Peter Ulrich und Karl Homann dargestellt?
Kapitel 2 präsentiert biographische Informationen, akademischen Werdegang und berufliche Stationen von Peter Ulrich und Karl Homann, um deren Expertise im Bereich der Wirtschaftsethik und die Bedeutung für das Verständnis ihrer Konzepte hervorzuheben.
- Quote paper
- Ira Bork (Author), 2011, Wirtschaftsethische Konzepte im Vergleich , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176667