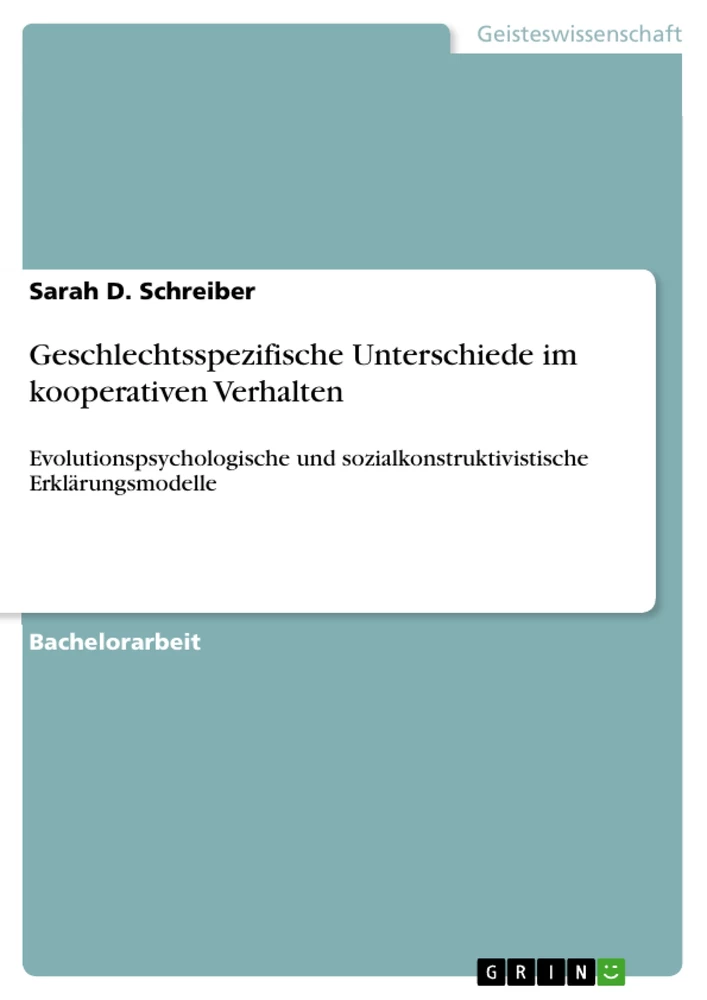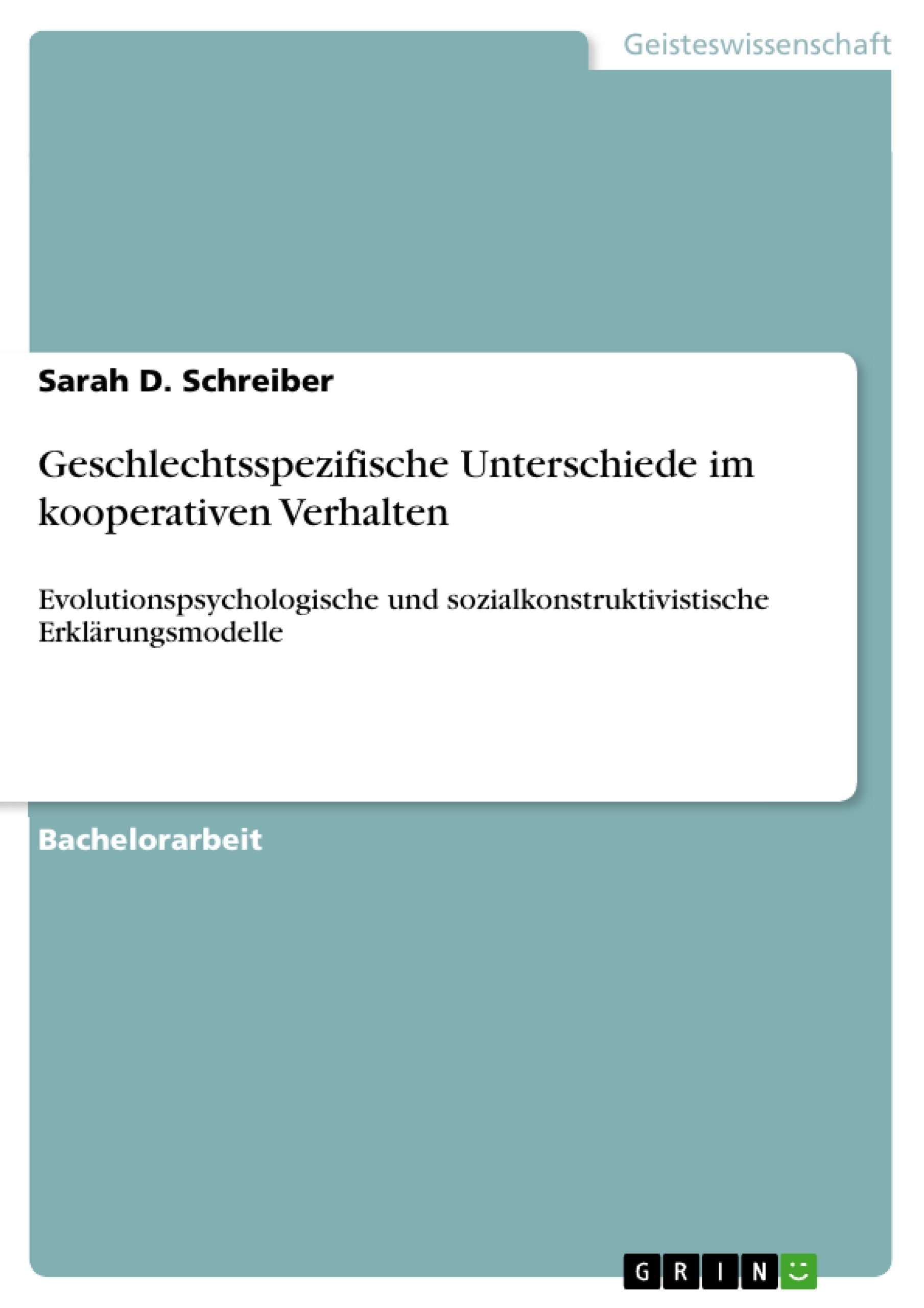Die Frage nach den Geschlechterunterschieden ist genauso alt wie aktuell. Obwohl sich bereits Generationen von Philosophen und Wissenschaftlern mit der Verschiedenheit von Männern und Frauen beschäftigt haben, gibt es immer noch keine einheitliche Antwort auf die Frage, ob diese Differenzen tatsächlich existieren, oder ob sie nicht eine Illusion darstellen und lediglich durch die Sozialisation in unserer Gesellschaft aufrechterhalten werden.
Dabei scheinen Anhänger des Sozialkonstruktivismus vordergründig politische Interessen zu verfolgen. Sie glauben, ihr Ziel nur erreichen zu können, indem sie
naturgegebene Unterschiede zwischen Männern und Frauen größtenteils negieren und auf rein gesellschaftliche Ursachen zurückführen. Auf der anderen Seite postulieren Evolutionspsychologen, dass sehr wohl biologische Differenzen bestehen. Diese angeborenen geschlechtsspezifischen Unterschiede dürften indes nicht zu dem naturalistischen Fehlschluss (Moore, 1903) führen, dass alles Natürliche auch als gut, richtig und unabänderlich betrachtet werden sollte.
Um eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen der wahrgenommenen Geschlechterunterschiede im Hinblick auf kooperatives Verhalten finden zu können, beschäftigt sich die Arbeit mit den grundlegenden Annahmen der Evolutionstheorie. So wird geklärt, warum es evolutionspsychologisch durchaus adaptiv sein kann, dass Männer und Frauen unterschiedliche soziale Verhaltensweisen entwickelt haben, obwohl sie sich im Großen und Ganzen mit ähnlichen Problemen im Kampf ums Überleben auseinandersetzen mussten. Außerdem ist zu klären, wie kooperatives Verhalten in einer Welt entstehen konnte, in der es zunächst am sinnvollsten erscheint, egoistisch zu handeln, um das eigene Überleben zu sichern.
Auf der anderen Seite bietet die Sozialisation ein alternatives Erklärungsmodell, wie es durch das Erlernen sozialer Rollen und Identitäten zu den unterschiedlichen Verhaltensweisen von Männern und Frauen kommen kann, ohne dass hierfür biologische Unterschiede verantwortlich sind.
Es wird sich zeigen, dass die scheinbar einfache Frage, ob eines der beiden Geschlechter im Durchschnitt kooperativer ist als das andere, nur schwer zu beantworten ist. Deshalb werden in dieser Arbeit Studien mit verschiedenen Motivations- und Sozialstrukturen vorgestellt. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob die Evolutionspsychologie oder der Sozialkonstruktivismus die gefundenen Geschlechterunterschiede besser erklären kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Evolutionspsychologischer Ansatz
- 2.1 Grundlagen der Evolutionstheorie
- 2.2 Wie konnten unterschiedliche Verhaltensweisen zwischen den Geschlechtern evolvieren?
- 2.2.1 Elterliche Investitionen
- 2.2.2 Partnerwahlstrategien von Männern und Frauen
- 2.3 Evolution der Kooperation
- 2.3.1 Reziprozität und Unterstützung von Verwandten
- 2.3.1 Altruismus als Costly Signal
- 2.4 Evolutionspsychologische Vorhersagen für geschlechtsspezifische Unterschiede im kooperativen Verhalten
- 3. Sozialkonstruktivistischer Ansatz
- 3.1 Grundlagen des Sozialkonstruktivismus
- 3.2 Sozialisation der Geschlechterunterschiede
- 3.2.1 Soziale Rollen
- 3.2.2 Soziale Identitäten
- 3.3 Sozialisation der Kooperation
- 3.3.1 Helden und Gentlemen
- 3.3.2 Fürsorgliche Mütter und selbstlose Freundinnen
- 3.4 Vorhersagen der Theorie der sozialen Rollen für geschlechtsspezifische Unterschiede im kooperativen Verhalten
- 4. Empirische Studien
- 4.1 Motivationsstruktur
- 4.1.1 Furcht vor der Ausbeutung
- 4.1.2 Streben nach dem eigenen Vorteil
- 4.2 Soziale Struktur
- 4.2.1 Kooperation in Gruppen und interpersonale Kooperation
- 4.2.2 Geschlechterzusammensetzung der Gruppe und Beobachtereffekt
- 4.3 Biologische Studien
- 5. Ergebnisse
- 6. Fazit und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach den Ursachen der wahrgenommenen Geschlechterunterschiede, insbesondere im Hinblick auf kooperatives Verhalten. Sie untersucht, ob diese Unterschiede auf biologische Faktoren oder auf soziale Konstruktionen zurückzuführen sind. Dabei werden die evolutionspsychologische und die sozialkonstruktivistische Perspektive gegenübergestellt und die Vorhersagen beider Theorien anhand empirischer Studien analysiert.
- Evolutionäre Grundlagen von geschlechtsspezifischem Verhalten
- Soziale Rollen und Identitäten als Einflussfaktoren für Geschlechterunterschiede
- Empirische Studien zu Motivations- und Sozialstrukturen im Kontext von Kooperation
- Bewertung der evolutionspsychologischen und sozialkonstruktivistischen Erklärungsmodelle
- Zusammenhang zwischen biologischen und sozialen Faktoren im kooperativen Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Geschlechterunterschiede in den Kontext aktueller wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Debatten. Sie beleuchtet die Kontroverse zwischen evolutionspsychologischer und sozialkonstruktivistischer Sichtweise und führt die wichtigsten Themen der Arbeit ein.
Das zweite Kapitel widmet sich dem evolutionspsychologischen Ansatz. Es erläutert die Grundlagen der Evolutionstheorie und untersucht, wie geschlechtsspezifische Unterschiede im Verhalten evolutionär entstanden sein könnten. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Konzepten der elterlichen Investition, Partnerwahlstrategien und der Evolution der Kooperation.
Das dritte Kapitel präsentiert den sozialkonstruktivistischen Ansatz. Es erklärt die grundlegenden Prinzipien des Sozialkonstruktivismus und analysiert, wie die Sozialisation von Geschlechterrollen und -identitäten zu unterschiedlichen Verhaltensweisen bei Männern und Frauen führen kann. Die Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von sozialen Rollen, Identitäten und der Sozialisation von Kooperation.
Das vierte Kapitel befasst sich mit empirischen Studien, die sich mit der Frage nach den Ursachen von Geschlechterunterschieden im kooperativen Verhalten befassen. Es werden Studien vorgestellt, die verschiedene Motivations- und Sozialstrukturen untersuchen und die Auswirkungen dieser Strukturen auf das prosoziale Verhalten von Männern und Frauen beleuchten.
Schlüsselwörter
Geschlechterunterschiede, kooperatives Verhalten, Evolutionspsychologie, Sozialkonstruktivismus, Elterliche Investition, Partnerwahlstrategien, soziale Rollen, soziale Identitäten, Motivationsstrukturen, Sozialstrukturen, empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es echte Geschlechterunterschiede im kooperativen Verhalten?
Die Forschung ist uneins; während Evolutionspsychologen biologische Differenzen betonen, führen Sozialkonstruktivisten Unterschiede auf gesellschaftliche Rollen zurück.
Was sagt die Evolutionspsychologie zur Kooperation?
Sie postuliert, dass Männer und Frauen unterschiedliche adaptive Strategien (z. B. bei Partnerwahl und elterlicher Investition) entwickelt haben, die ihr soziales Verhalten beeinflussen.
Wie erklärt der Sozialkonstruktivismus unterschiedliches Verhalten?
Er sieht die Ursache in der Sozialisation, durch die Männer und Frauen soziale Rollen und Identitäten (z. B. „fürsorgliche Mutter“ vs. „Held“) erlernen.
Welche Rolle spielt die Gruppenstruktur bei der Kooperation?
Empirische Studien zeigen, dass Faktoren wie die Geschlechterzusammensetzung einer Gruppe und der Beobachtereffekt das kooperative Handeln maßgeblich beeinflussen.
Was ist der „naturalistische Fehlschluss“?
Dies ist die irrige Annahme, dass alles, was biologisch „natürlich“ ist, automatisch auch als moralisch gut oder unabänderlich betrachtet werden muss.
Wer ist im Durchschnitt kooperativer: Männer oder Frauen?
Die Arbeit zeigt, dass diese Frage schwer zu beantworten ist und stark von der jeweiligen Motivationsstruktur (z. B. Furcht vor Ausbeutung vs. Streben nach Vorteil) abhängt.
- Quote paper
- Sarah D. Schreiber (Author), 2011, Geschlechtsspezifische Unterschiede im kooperativen Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176668