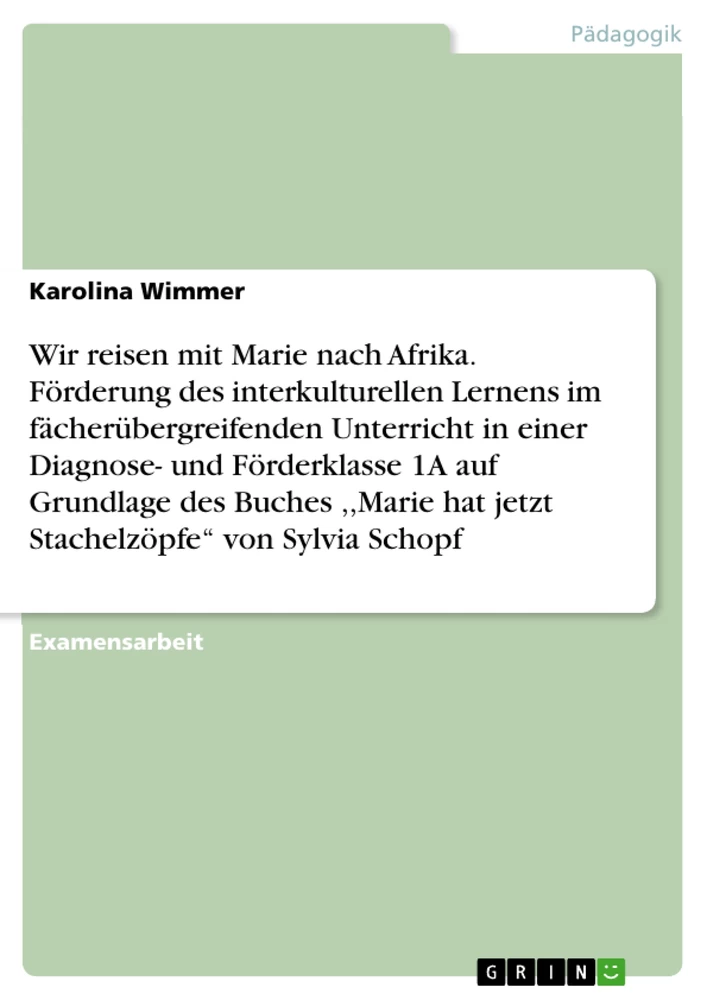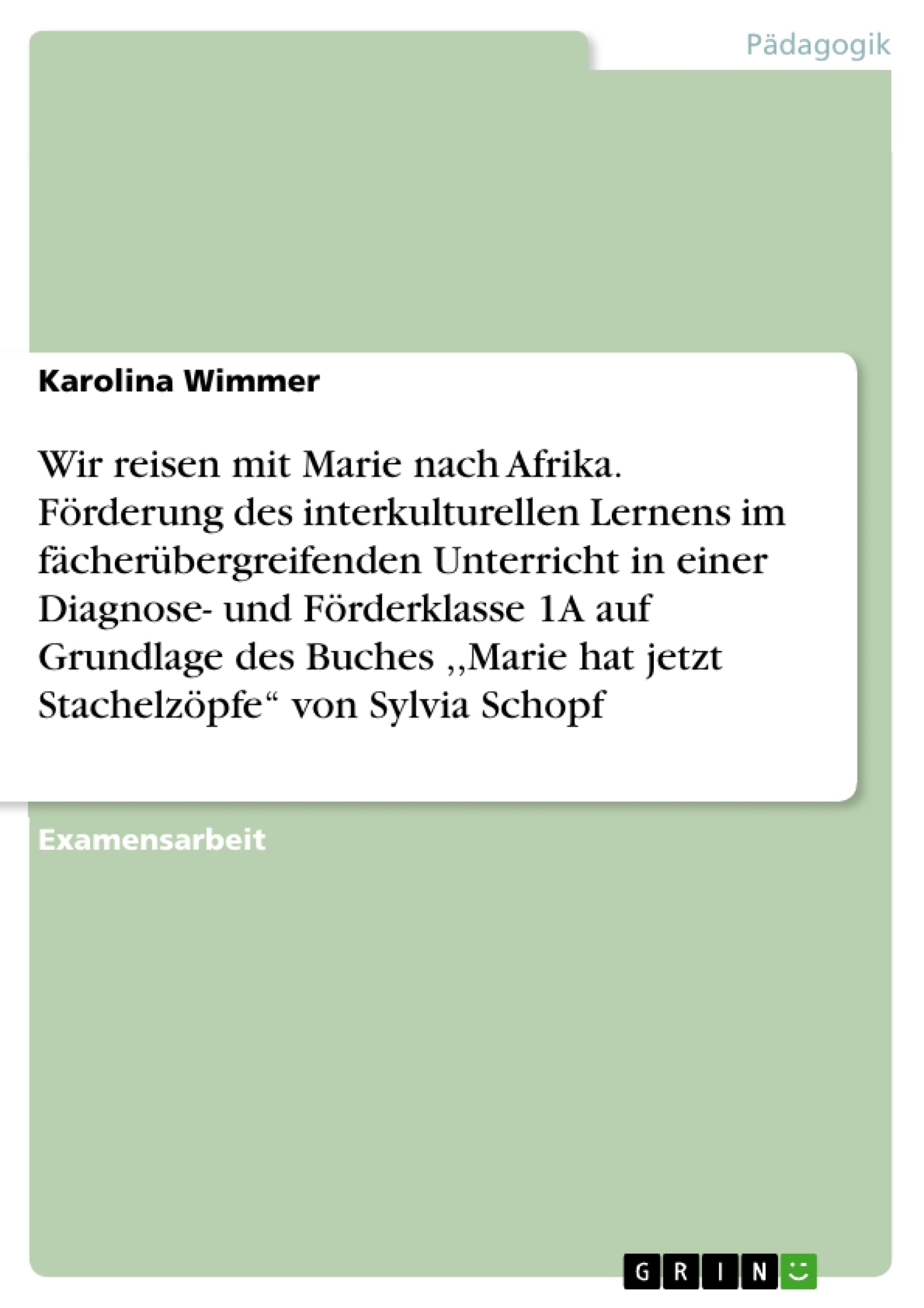Motivation zum Thema und Zielsetzung
„Juren ist ein Scheiß-Afrikaner!“ Die ständige Diffamierung der anderen Klassenkameraden gegen den aus Sri Lanka stammenden Jungen aufgrund seiner dunklen Hautfarbe und das geringe Vorwissen bzw. die Intoleranz der Kinder bezogen auf andere Kulturen, die sich in verschiedenen Alltagsituationen zeigten, beschäftigten mich schon seit Anfang des Schuljahres. Dies brachte mich auf die Idee mich näher mit der Thematik des Interkulturellen Lernens auseinanderzusetzen.
Interkulturelles Lernen wird aufgrund der zunehmenden weltweiten Migration und der Öffnung Europas immer wichtiger. Dessen Förderung ist insbesondere in der Sonderpädagogik wesentlich, da an Förderschulen der Anteil der Schüler mit Migrationsanteil hoch ist. Speziell die Sonderpädagogischen Förderzentren im Großraum München werden von einer großen Zahl von Schülern mit Migrationshintergrund besucht. Die Werte liegen in 27 von 29 untersuchten Klassen bei 21-100% (vgl. Foddis 2010 S. 45). Diese Situation spiegelt sich in meiner Klasse wider. Die Diagnose- und Förderklasse (DFK) 1 Aa besuchen derzeit 12 Schülern aus acht verschiedenen Ländern. Auch der Bayerische Grundschullehrplan spricht dem interkulturellen Lernen eine hohe Bedeutung zu: „Die besondere Aufgabe der Grundschule besteht dabei in der Entwicklung der Erkenntnis, dass Menschen und Kulturen in gleichberechtigter Weise nebeneinander und miteinander leben, dass man voneinander lernen kann und sich so gegenseitig bereichert“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2000, S. 14).
Zunächst hatte ich mir überlegt im Unterricht verschiedene Länder vorzustellen. Da die Fachliteratur jedoch empfiehlt, sich auf ein Land bzw. auf einen Kontinent zu beschränken und dieses dann intensiv zu behandeln, entschied ich mich aufgrund der nahenden Fußball-Weltmeisterschaft und meiner fußballbegeisterten Klasse für Afrika. Als Rahmenhandlung wurde das Buch „Marie hat jetzt Stachelzöpfe“ von Sylvia Schopf ausgewählt.
Im Rahmen dieser Hausarbeit bzw. der zugrunde liegenden Unterrichtseinheit kann interkulturelles Lernen nur initiiert werden, da es ein langfristiger Prozess ist, der sich im Laufe der Jahre nach und nach entwickelt. Daher sollen die Schüler zunächst die Andersartigkeit der fremden Kultur entdecken und sich in vielfältiger Weise mit allen Sinnen mit ihr auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation zum Thema und Zielsetzung
- I. Theoretische Hintergründe
- 1.0 Begriffsklärung
- 1.1. Interkulturelles Lernen
- 1.2 Fächerübergreifender Unterricht
- 2.0 Modelle interkulturellen Lernens
- 2.1 Interkulturelles Lernen als stufenweiser Prozess
- 3.0 Didaktisch-methodische Überlegungen zum interkulturellen Lernen
- 3.1 Aufgaben und Ziele interkulturellen Lernens
- 3.2 Umsetzung der Vorgaben im Lehrplan
- 3.3 Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Lernens im Unterricht
- 3.4 Kriterien für den Unterricht
- 3.5 Fächerübergreifende Umsetzung
- 1.0 Begriffsklärung
- II. Praxisteil
- 6.0 Methodische Vorüberlegungen zur Unterrichtssequenz
- 6.1 Zum Inhalt des Buches und Einschätzung seiner Eignung für das Ziel des interkulturellen Lernens
- 6.2 Lernvoraussetzungen der Schüler
- 6.2.1 Vorwissen über Afrika
- 6.2.2 Einstellungen zu Afrika
- 6.2.3 Individuelle Lernvoraussetzungen
- 6.3 Zielsetzungen der einzelnen Fächer im fächerübergreifenden Unterricht
- 6.4 Kurze Darstellung der Unterrichtssequenz
- 6.5 Darstellung der Durchführung
- 7.0 Diagnose und Auswertung des interkulturellen Lernens nach Durchführung der Fördersequenz
- 7.1 Wissen über Afrika
- 7.2 Einstellungen zu Afrika
- 8.0 Reflexion der Fördersequenz
- 6.0 Methodische Vorüberlegungen zur Unterrichtssequenz
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Förderung des interkulturellen Lernens im fächerübergreifenden Unterricht in einer Diagnose- und Förderklasse 1A. Ziel ist es, die Schüler mit der afrikanischen Kultur vertraut zu machen und ihnen auf diese Weise eine respektvolle Toleranz gegenüber anderen Kulturen zu vermitteln. Zudem soll den Kindern eine Haltung vermittelt werden, die zu einem respektvollen Umgang miteinander und einer besseren Alltagsbewältigung in einem multikulturellen Lernumfeld führt.
- Bedeutung und Begriffsklärung von interkulturellem Lernen
- Fächerübergreifende Unterrichtsgestaltung
- Didaktische und methodische Ansätze zum interkulturellen Lernen
- Analyse von Lernvoraussetzungen und -zielen im Hinblick auf die afrikanische Kultur
- Bewertung der Eignung des Buches „Marie hat jetzt Stachelzöpfe“ für die Förderung des interkulturellen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Motivation für die Thematik des interkulturellen Lernens im Kontext einer Diagnose- und Förderklasse 1A, die von Schülern mit unterschiedlichen Migrationshintergründen besucht wird. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Förderung von interkulturellem Lernen durch die Auseinandersetzung mit der afrikanischen Kultur. Der Praxisteil beschäftigt sich mit der Planung und Durchführung einer Unterrichtssequenz, die auf dem Buch „Marie hat jetzt Stachelzöpfe“ basiert. Im Mittelpunkt stehen die methodischen Überlegungen, die Lernvoraussetzungen der Schüler und die Zielsetzungen der einzelnen Fächer im fächerübergreifenden Unterricht.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Lernen, Fächerübergreifender Unterricht, Diagnose- und Förderklasse, afrikanische Kultur, „Marie hat jetzt Stachelzöpfe“, Lernvoraussetzungen, Einstellungen, Toleranz, Respekt, Multikulturelles Lernumfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des interkulturellen Lernens in dieser Förderklasse?
Ziel ist es, Vorurteile abzubauen, Toleranz gegenüber anderen Kulturen zu fördern und den Schülern einen respektvollen Umgang miteinander zu vermitteln.
Welches Buch dient als Grundlage für die Unterrichtseinheit?
Als Rahmenhandlung wurde das Buch „Marie hat jetzt Stachelzöpfe“ von Sylvia Schopf ausgewählt.
Warum wurde der Kontinent Afrika als Thema gewählt?
Ausschlaggebend waren das Interesse der fußballbegeisterten Klasse (im Kontext einer WM) und die Empfehlung, sich intensiv auf einen Kontinent zu konzentrieren.
Wie wird das interkulturelle Lernen im Unterricht umgesetzt?
Die Schüler setzen sich fächerübergreifend mit allen Sinnen mit der afrikanischen Kultur auseinander, um deren "Andersartigkeit" positiv zu entdecken.
Warum ist interkulturelle Bildung an Förderschulen besonders wichtig?
Da der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund an Förderschulen oft sehr hoch ist, ist die Förderung von Akzeptanz und Vielfalt essentiell für das Klassenklima.
- Quote paper
- Karolina Wimmer (Author), 2010, Wir reisen mit Marie nach Afrika. Förderung des interkulturellen Lernens im fächerübergreifenden Unterricht in einer Diagnose- und Förderklasse 1A auf Grundlage des Buches ,,Marie hat jetzt Stachelzöpfe“ von Sylvia Schopf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176884