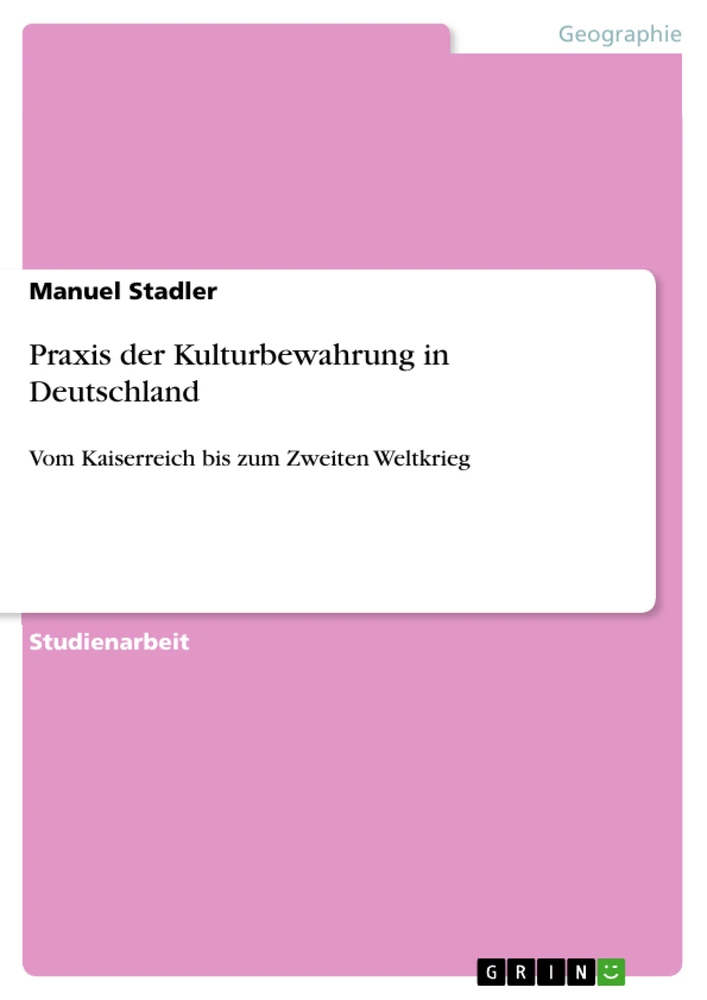Das Thema „Praxis der Kulturbewahrung in Deutschland vom Kaiserreich bis zum zweiten Weltkrieg bis zum Wiederaufbau und seiner moderne Gesetzgebung“ versteht sich als Binde-glied auf dem Weg von den sieben Weltwundern der Antike zur modernen international orga-nisierten Kulturbewahrung. Dabei unterlief sowohl die Theorie, als auch die Praxis des Schut-zes der Vergangenheit einen großen und stetigen Wandel.
Es ist die Aufgabe jeder Generation Schäden von Denkmälern und der Kultur, sei es durch Kriege oder dem natürlichen Lauf der Vergänglichkeit, fernzuhalten, um das Erbe der Ver-gangenheit auch für die Zukunft zu bewahren und den nächsten Generationen zugänglich zu machen. Waren die Gründe für den Schutz der Erinnerungen an die Geschichte doch immer die Gleichen oder Ähnlichen, so wandelten sich doch die Vorgehensweisen, wie diese be-werkstelligt werden sollten, oder bewerkstelligt wurden, sowohl als auch die Personen, Orga-nisationen und Institutionen, die sich für diese Aufgabe berufen fühlten, oder berufen wur-den.
Der geschichtliche Ausschnitt vom Kaiserreich bis nach dem Wiederaufbau der Kriegsschäden des zweiten Weltkriegs stellt einen Zeitraum mit weitreichenden politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Veränderungen dar. In gleicher Weise, wie sich Lebensweisen, Sichtweisen und Regierungssysteme änderten, waren auch die Praktiken der Kulturbewahrung einen Wandel unterworfen.
Spricht man in diesem Zusammenhang von Kulturbewahrung meint man zumeist die Denk-malpflege und den Denkmalschutz, welchen die größte Aufmerksamkeit zu Teil wurde.
Der Erste Teil dieser Arbeit stellt den oft schweren Weg der Praxis der Kulturbewahrung vom deutschen Kaiserreich (1871 – 1918), mit seinen weitreichenden gesellschaftlichen und wirt-schaftlichen Veränderungen, um die Jahrhundertwende dar. Über den verlorenen ersten Welt-krieg und die Selbstfindungsphase der deutschen Nation, nach der Gründung der Weimarer Republik (1919), hinaus, werden die Aktivitäten und Absichten der Länder und des Reichs bis hin zur Machtergreifung Adolf Hitlers (1933) und dem nationalsozialistischen Deutschland bis zum Ende des zweiten Weltkriegs (1939 – 1945) beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Praxis der Kulturbewahrung in Deutschland vom Kaiserreich bis zum zweiten Weltkrieg
- Die Situation der Denkmalpflege in Deutschland vor 1871
- Veränderungen in den Jahren 1871 – 1918
- Die Situation 1871
- Der Bedeutungsgewinn der Denkmalpflege in der Spätzeit des Deutschen Kaiserreichs
- Nationalisierung und Folgen der Denkmalpflege im ersten Weltkrieg
- Die Weimarer Republik (1919 – 1933)
- Die Situation nach dem Ende des Krieges und der Revolution von 1918
- Entwicklung des Denkmalrechts in der Weimarer Republik
- Gründe für die Weiterentwicklung des Denkmalrechts
- Art. 150 Weimarer Verfassung und Verordnungen zum Denkmalschutz
- Die nationalsozialistische Diktatur (1933 – 1945)
- Hitlers Kulturideologie
- Kulturpolitik und die Bedeutung der Denkmäler
- Die veränderte Aufgabe der Kulturbewahrung im Zweiten Weltkrieg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Praxis der Kulturbewahrung in Deutschland vom Kaiserreich bis zum Zweiten Weltkrieg. Sie verfolgt das Ziel, die Veränderungen in der Theorie und Praxis des Denkmalschutzes im Kontext der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen dieser Epoche aufzuzeigen. Dabei werden die Motive und Ziele der Denkmalpflege sowie die Rolle staatlicher Institutionen und Bürgerinitiativen in der Entwicklung des Denkmalschutzes analysiert.
- Die Entwicklung des Denkmalschutzes in Deutschland von seinen Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg
- Die Rolle des Staates und der Gesellschaft im Denkmalschutz
- Die Veränderung des Denkmalschutzes im Kontext politischer und gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Bedeutung der Kulturbewahrung für die nationale Identität
- Die Herausforderungen des Denkmalschutzes im Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Kulturbewahrung in Deutschland und stellt den historischen Kontext des Themas dar. Sie verweist auf die stetige Weiterentwicklung der Praxis der Kulturbewahrung von der Antike bis zur Moderne.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Situation der Denkmalpflege in Deutschland vor 1871. Es stellt die Anfänge des Denkmalschutzes im ausgehenden 18. Jahrhundert und die Bedeutung des Denkmalschützers Karl Friedrich Schinkel dar.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Veränderungen in der Denkmalpflege im Zeitraum von 1871 bis 1918. Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs und der Erste Weltkrieg führten zu neuen Herausforderungen und veränderten Sichtweisen auf die Bedeutung der Kulturbewahrung.
Das vierte Kapitel analysiert die Denkmalpflege in der Weimarer Republik (1919 – 1933). Die Revolution von 1918 und die Gründung der Republik führten zu einer Weiterentwicklung des Denkmalrechts und der Kulturpolitik.
Das fünfte Kapitel behandelt die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur (1933 – 1945). Die nationalsozialistische Ideologie und die Kriegshandlungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Praxis der Kulturbewahrung.
Schlüsselwörter
Kulturbewahrung, Denkmalpflege, Denkmalschutz, Deutschland, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Geschichte, Identität, Kulturpolitik, Staat, Gesellschaft, Bürgerinitiativen, Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Denkmalschutz im deutschen Kaiserreich?
Nach der Reichsgründung 1871 gewann die Denkmalpflege an Bedeutung, wurde jedoch im Zuge des Ersten Weltkriegs zunehmend für nationale Zwecke instrumentalisiert.
Welche Neuerungen brachte die Weimarer Republik für das Denkmalrecht?
In der Weimarer Verfassung (Art. 150) wurde der Schutz von Denkmälern erstmals rechtlich verankert, was zu einer Weiterentwicklung der Länderverordnungen führte.
Wie beeinflusste die NS-Ideologie die Kulturbewahrung?
Unter Hitler wurde Denkmalpflege als Teil der Kulturpolitik genutzt, um die nationalsozialistische Ideologie zu untermauern, während im Zweiten Weltkrieg der Schutz vor Kriegsschäden im Vordergrund stand.
Wer war Karl Friedrich Schinkel im Kontext des Denkmalschutzes?
Schinkel gilt als einer der Wegbereiter der modernen Denkmalpflege in Deutschland bereits vor der Reichsgründung von 1871.
Was ist das Ziel der Kulturbewahrung laut dieser Arbeit?
Ziel ist es, das Erbe der Vergangenheit vor Schäden und dem natürlichen Verfall zu bewahren, um es künftigen Generationen zugänglich zu machen.
Welchen Einfluss hatten politische Umbrüche auf die Denkmalpflege?
Jeder Systemwechsel – vom Kaiserreich über die Republik bis zur Diktatur – änderte die Motive, Vorgehensweisen und verantwortlichen Institutionen der Kulturbewahrung.
- Arbeit zitieren
- Manuel Stadler (Autor:in), 2008, Praxis der Kulturbewahrung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177077