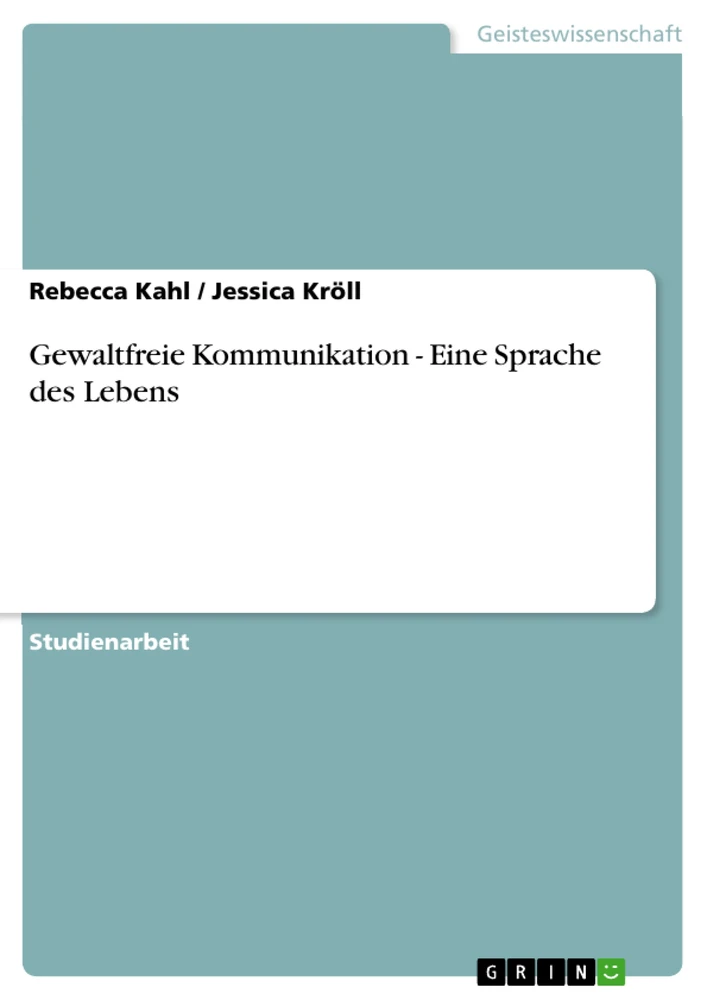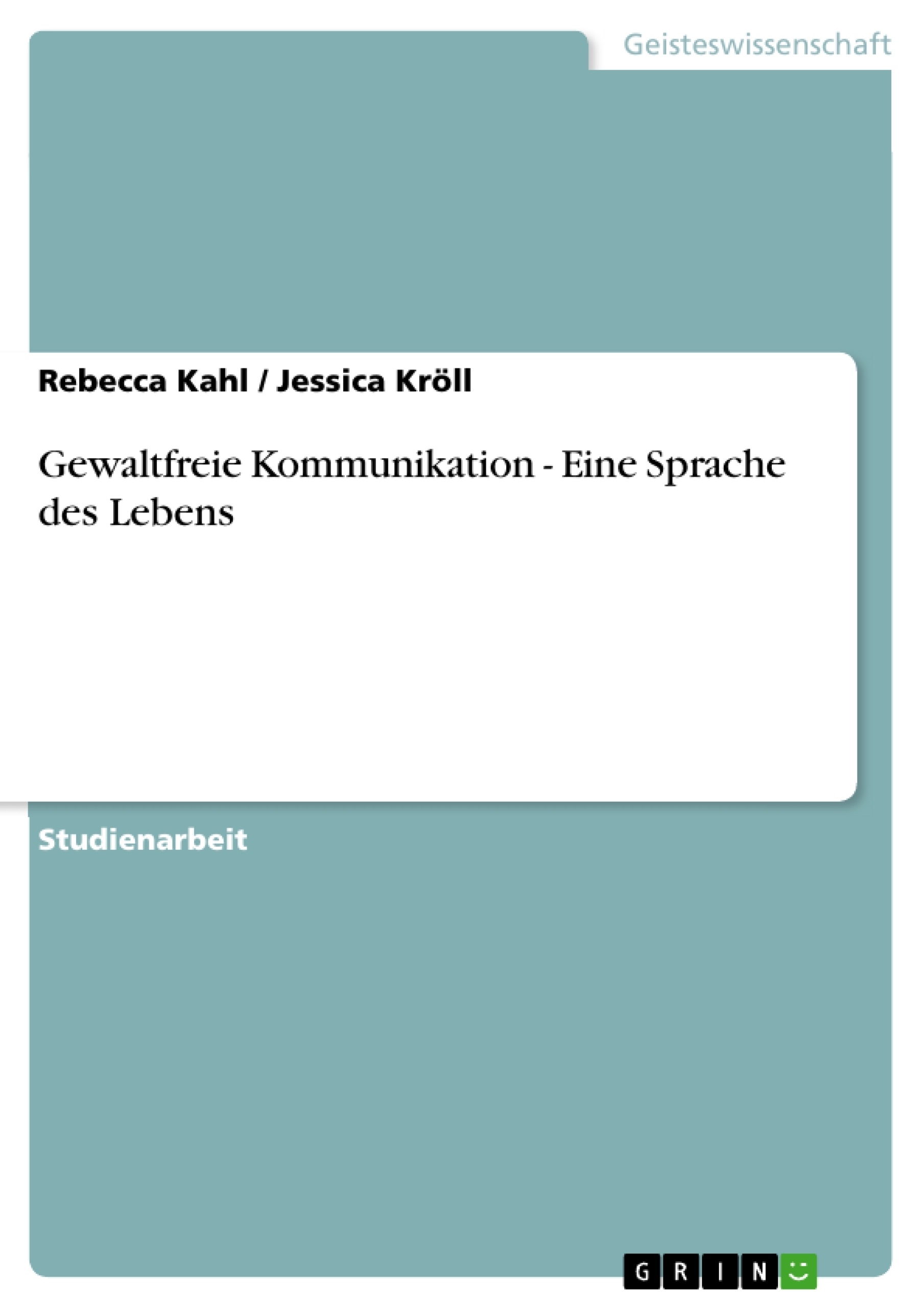In der Geschichte der Menschheit konnte man Gewalt in ihren unterschiedlichsten Ausformungen schon immer vorfinden. Sei es individuelle Gewalt, die es beispielsweise schon beim Brüdermord von Kain an Abel gab, oder kollektive Gewalt die man in den unzähligen Kriegen im Laufe der menschlichen Zivilisation erleben konnte.
Heute begegnen uns individuelle und kollektive Gewalt beispielsweise in Form von häuslicher Gewalt oder Mobbing am Arbeitsplatz und Schulen. Eine Gesellschaft ohne Gewalt erscheint utopisch. Jeder Mensch kennt Gewalt und die meisten Menschen haben, ob bewusst oder unbewusst, auch schon selbst Gewalt angewandt. Gewalt ist also universell verständlich und bedarf keiner kulturellen Voraussetzung. Da Gewaltanwendung weder vor bestimmten Altersgruppen, kulturellen Hintergründen oder vor sog. bildungsnahen Schichten halt macht, stellt der Umgang mit dieser auch die Soziale Arbeit ständig vor neue Herausforderungen. Als Sozialarbeiter / in kann man Gewalt oder Gewaltanwendung ignorieren, verharmlosen, verurteilen oder bestrafen, man kann allerdings auch versuchen, ihr mit ganz neuen und konfrontativen Ansätzen zu begegnen.
Ebenso wie Gewalt ist auch die Kommunikation ein alltäglicher und selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens. Doch was haben Kommunikation und Gewalt gemeinsam? Wir empfinden unsere Art zu kommunizieren vielleicht nicht als „gewalttätig“ und doch entstehen die meisten Verletzungen - bei uns selbst oder bei anderen – durch Worte.
Marshall Rosenberg den Begründer der „Gewaltfreien Kommunikation“ (abgekürzt GfK) beschäftigt vor allem die Frage, wie man trotz des hohen Gewaltanteils der Gesellschaft einfühlsam bleiben kann. Er betont dass die Sprache und der Gebrauch von Worten eine zentrale Rolle spielen um diese Fähigkeit zu erreichen. Mit der „Gewaltfreien Kommunikation“ hat Rosenberg ein Konzept geschaffen, das uns bei der Umgestaltung und Veränderung unseres sprachlichen Ausdrucks und unserer Art zuzuhören hilft. Es ist ein Modell, das dabei behilflich sein kann in Konfliktsituationen friedliche Lösungen zu finden.
Die Gewaltfreie Kommunikation wird als die verlorene Sprache der Menschheit bezeichnet. Als Sprache eines Volkes, das rücksichtsvoll miteinander umgeht und die Sehnsucht hat, in Balance mit sich selbst und anderen zu leben........
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Symbole der GfK
- Grundannahmen der GfK
- Ziele in der Gewaltfreien Kommunikation
- Lebensentfremdende Kommunikation
- Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (das Vier-Schritte-Modell)
- Der erste Schritt - Beobachtung / Wahrnehmung
- Der zweite Schritt - Gefühle
- Der dritte Schritt - Bedürfnisse
- Der vierte Schritt - die Bitte
- Der Prozess der Gewaltfreien Kommunikation
- Potential der Gewaltfreien Kommunikation in der Sozialen Arbeit
- Gewaltfreie Kommunikation im beruflichen Kontext von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
- Gefühle und Bedürfnisse am Arbeitsplatz
- Grenzen und Möglichkeiten der Empathie
- Das GfK-Modell in einem Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit
- Gewaltfreie Kommunikation in der Schulsozialarbeit
- Gewaltfreie Kommunikation im beruflichen Kontext von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
- Kritik an der theoretischen Konzeption der Gewaltfreien Kommunikation
- Kritik an den Grundannahmen
- Die Gewaltfreie Kommunikation sei formelhaft
- Rosenberg unterscheidet nicht zwischen „privaten“ und „professionellen“ Rollen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg und dessen Anwendbarkeit in der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, das Konzept der GfK zu erläutern, seine Anwendungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit aufzuzeigen und sowohl Vorteile als auch mögliche Nachteile zu diskutieren.
- Begriffsbestimmung von Gewalt und Gewaltfreiheit im Kontext der GfK
- Das Vier-Schritte-Modell der GfK und seine Anwendung
- Potential und Grenzen der GfK in der Sozialen Arbeit
- Kritikpunkte an der theoretischen Konzeption der GfK
- Lebensentfremdende Kommunikation im Gegensatz zur GfK
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewalt und ihrer verschiedenen Ausprägungen ein und stellt den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Gewalt her. Sie betont die Bedeutung einfühlsamen Umgangs trotz hoher Gewaltanteile in der Gesellschaft und stellt die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) als ein Konzept zur friedlichen Konfliktlösung vor. Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung der GfK und deren Anwendung in der Sozialen Arbeit, inklusive der Erläuterung der Grundbegriffe und des Vier-Schritte-Modells.
Begriffsklärungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Gewalt“, „Gewaltlosigkeit“ und „Gewaltfreiheit“ im Kontext der GfK. Es wird deutlich, dass Rosenberg Gewalt als Machtausübung und destruktive Kommunikation (Kritik, Vorwürfe etc.) versteht, während Gewaltfreiheit ein einfühlsames Miteinander bedeutet, bei dem die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden. Der Begriff der Gewaltfreiheit wird im Sinne Gandhis erläutert.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Gewaltfreie Kommunikation in der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg und ihre Anwendbarkeit in der Sozialen Arbeit. Sie erläutert das GfK-Konzept, zeigt Anwendungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit auf und diskutiert Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung von Gewalt und Gewaltfreiheit im Kontext der GfK; das Vier-Schritte-Modell der GfK und seine Anwendung; Potential und Grenzen der GfK in der Sozialen Arbeit; Kritikpunkte an der theoretischen Konzeption der GfK; lebensentfremdende Kommunikation im Gegensatz zur GfK; Gefühle und Bedürfnisse am Arbeitsplatz; Grenzen und Möglichkeiten der Empathie in der Sozialen Arbeit; Anwendung der GfK in der Schulsozialarbeit.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, Klärung zentraler Begriffe (Gewalt, Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit), eine Erläuterung der Symbole und Grundannahmen der GfK, die Darstellung des Vier-Schritte-Modells (Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitte), eine Auseinandersetzung mit dem Potential der GfK in der Sozialen Arbeit (inkl. Beispiel Schulsozialarbeit), Kritik an der GfK und ein Schlusswort. Kapitelzusammenfassungen sind ebenfalls enthalten.
Was ist das Vier-Schritte-Modell der Gewaltfreien Kommunikation?
Das Vier-Schritte-Modell der GfK umfasst: 1. Beobachtung/Wahrnehmung; 2. Gefühle; 3. Bedürfnisse; 4. die Bitte. Dieses Modell dient als strukturierter Ansatz für eine einfühlsame und gewaltfreie Kommunikation.
Welche Kritikpunkte an der GfK werden angesprochen?
Die Hausarbeit diskutiert Kritikpunkte wie die Formelhaftigkeit der GfK, die fehlende Unterscheidung zwischen privaten und professionellen Rollen und Kritik an den Grundannahmen des Modells.
Wo liegt der Fokus der Hausarbeit in Bezug auf die Soziale Arbeit?
Der Fokus liegt auf der Anwendung der GfK in der Sozialen Arbeit. Es wird untersucht, wie die GfK im beruflichen Kontext von Sozialarbeiter*innen eingesetzt werden kann, und ein Beispiel aus der Schulsozialarbeit wird genauer betrachtet.
Wie wird Gewalt in der Hausarbeit definiert?
Gewalt wird im Sinne Rosenbergs als Machtausübung und destruktive Kommunikation (Kritik, Vorwürfe etc.) definiert.
Wie wird Gewaltfreiheit in der Hausarbeit definiert?
Gewaltfreiheit wird als einfühlsames Miteinander beschrieben, bei dem die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden, im Sinne Gandhis erläutert.
- Quote paper
- Rebecca Kahl (Author), Jessica Kröll (Author), 2011, Gewaltfreie Kommunikation - Eine Sprache des Lebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177085