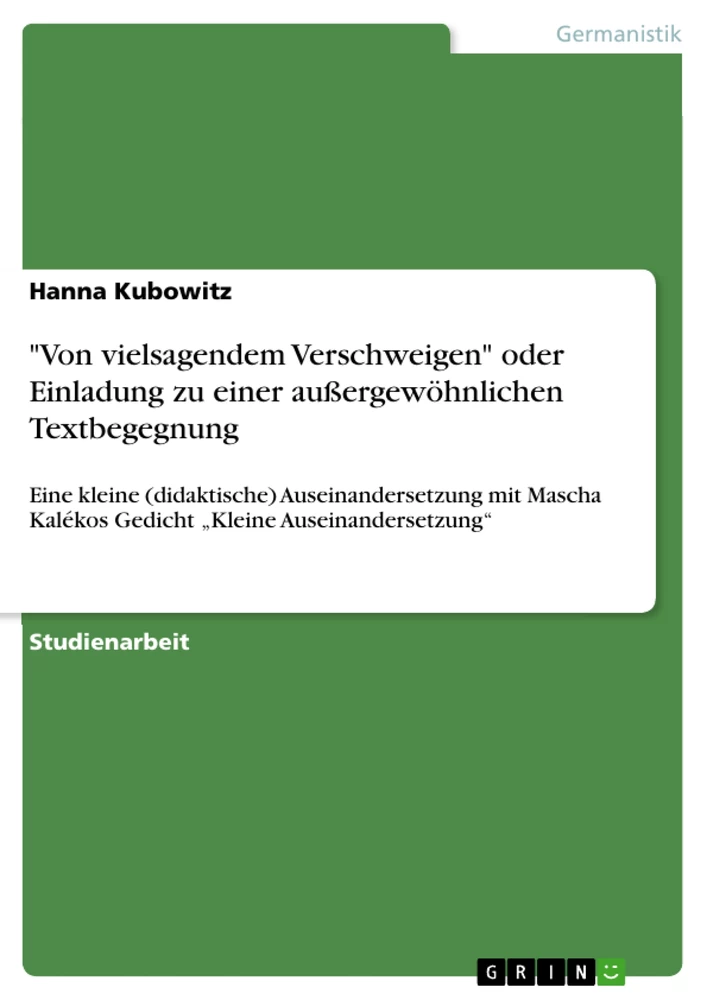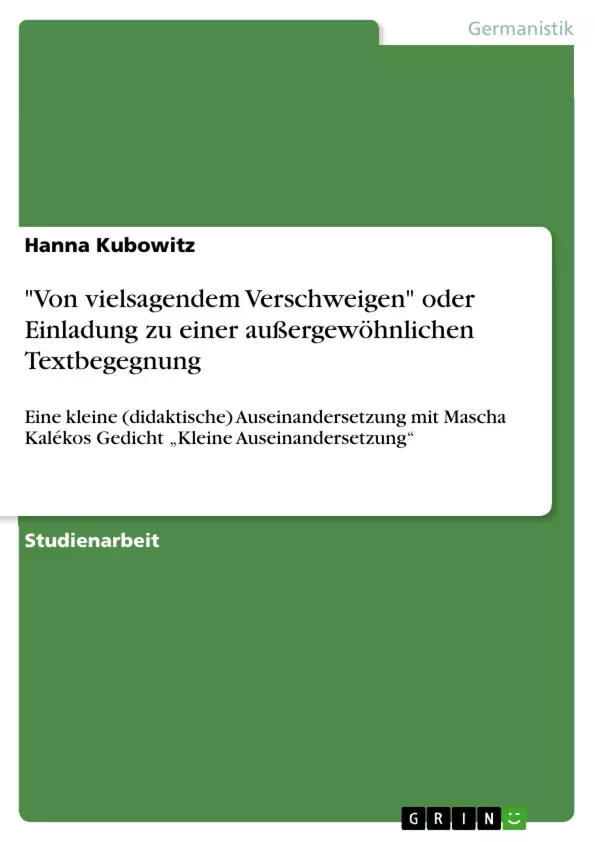„Es ist ein befreiendes Gefühl, seine eigensten Nöte in Versen ausgedrückt wieder zu finden“– so die bewegte Reaktion einer Leserin nach der Lektüre eines Gedichts von Mascha Kaléko. Ein Text, der eine solch begeisterte Reaktion auch nur in einer einzigen Rezipientin hervorruft, ist aufgrund seiner positiven (Ventil-)Wirkung zumindest in Bezug auf dieses eine lesende Subjekt ein persönlicher Glücksfall. Ein Text, der in kindlichen und jugendlichen Leserinnen und Lesern eine solch positive Reaktion hervorzurufen vermag, ist ein besonderer Glücksfall für den Deutschunterricht – ein Glücksfall, dessen pädagogisch-didaktischer Wert kaum überschätzt werden kann. Ein solcher Text ist Mascha Kalékos Gedicht „Kleine Auseinandersetzung“.
Die vorliegende Arbeit möchte entsprechend verstanden werden als eine kleine (didaktische) Annäherung die „Kleine Auseinandersetzung“. Dieses Gedicht wurde hier ausgewählt, da es trotz – oder möglicherweise wegen – seiner unprätentiösen und simpel anmutenden Oberflächenstruktur, d.h. trotz seiner scheinbaren Schlichtheit in Aufbau, Lexik, Stil und Syntax, Schülerinnen und Schülern tiefsinnige, wesentliche und ‚wissens-werte’ Erkenntnisse vermitteln kann. Dies gilt vor allem für den Themenkomplex Sprache als Mittel zwischenmenschlicher Kommunikation, dabei besonders Sprachverwendung sowohl als Ursache für Konflikte als auch als Instrument der Vermeidung und Bewältigung von Konflikten. Es gilt zudem hinsichtlich des Nicht-Ausgesprochenen wenngleich Mitzuverstehenden oder, um einen literaturwissenschaftlichen Begriff zu wählen, in Bezug auf das Phänomen der literarischen Leerstelle. Nicht zuletzt gilt es aber auch für weitere essentielle Aspekte menschlicher Identität, darunter vor allem das Verhältnis der Geschlechter in der vorherrschenden (heteronormativen) Geschlechterordnung und damit verbunden auch sexuelle Orientierung. Wie die nächsten Abschnitte zeigen wollen, lässt sich zu Recht behaupten: In der gemeinsamen Auseinandersetzung mit der „Kleine[n] Auseinandersetzung“ im Deutschunterricht können Schülerinnen und Schüler gleich in mehrfacher Hinsicht zu elementaren, fundamentalen und exemplarischen Erkenntnissen gelangen, von denen einige im Rahmen von Sprachkompetenz- und Literaturunterricht von Bedeutung sind (Stichwort Fach-, Sach- und Methodenkompetenz), während andere als für eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung unabdingbare Voraussetzungen gelten dürfen (Stichwort personale und Sozialkompetenz).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung oder „Du hast mir nur ein kleines Wort gesagt“..
- Hauptteil oder „Nun geht das kleine Wort mit mir spazieren“
- Sachanalyse oder „Was war es doch?“.
- Didaktische Analyse oder „Uns reift so manches stumm in Herz und Hirn“..
- Lernziele oder, Und werde dabei langsam Opti- und nicht Pessimist'.
- Schlussbetrachtung oder „- Ob dies das letzte Wort gewesen ist?“.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit soll eine kleine, didaktische Annäherung an Mascha Kalékos Gedicht „Kleine Auseinandersetzung“ darstellen. Sie analysiert die Textstruktur, die literarischen Mittel und die didaktische Relevanz des Gedichts und möchte zeigen, wie es in den Deutschunterricht einbezogen werden kann, um Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse zu vermitteln.
- Sprache als Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation
- Sprachverwendung als Ursache und Lösung von Konflikten
- Das Phänomen der literarischen Leerstelle
- Aspekte der menschlichen Identität, insbesondere das Verhältnis der Geschlechter
- Fach-, Sach- und Methodenkompetenz im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Gedicht „Kleine Auseinandersetzung“ von Mascha Kaléko vor und erläutert die Bedeutung des Textes für den Deutschunterricht.
- Im Hauptteil wird das Gedicht zunächst einer Sachanalyse unterzogen, die die Struktur, den Aufbau und die sprachlichen Besonderheiten analysiert. Die Didaktische Analyse untersucht die Möglichkeiten des Gedichts im Deutschunterricht und zeigt, wie es Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse vermitteln kann. Anschließend werden die Lernziele, die sich aus der Analyse ergeben, formuliert.
Schlüsselwörter
Mascha Kaléko, „Kleine Auseinandersetzung“, Sachanalyse, Didaktische Analyse, Deutschunterricht, Sprachkompetenz, Literaturunterricht, zwischenmenschliche Kommunikation, Konflikt, Leerstelle, Identität, Geschlechterverhältnis, Lernziele.
Häufig gestellte Fragen
Welches Gedicht steht im Zentrum dieser didaktischen Analyse?
Zentraler Gegenstand ist das Gedicht „Kleine Auseinandersetzung“ von Mascha Kaléko.
Warum eignet sich dieses Gedicht besonders für den Deutschunterricht?
Trotz seiner scheinbaren Schlichtheit vermittelt es tiefsinnige Erkenntnisse über Kommunikation, Konfliktbewältigung und die menschliche Identität.
Was wird unter dem Begriff der „literarischen Leerstelle“ verstanden?
Es bezieht sich auf das Nicht-Ausgesprochene im Text, das vom Leser mitverstanden oder interpretiert werden muss, was einen hohen pädagogischen Wert hat.
Welche Themen der Identität werden im Gedicht angesprochen?
Das Gedicht thematisiert das Verhältnis der Geschlechter in einer heteronormativen Ordnung sowie Aspekte der sexuellen Orientierung.
Welche Kompetenzen sollen Schüler durch die Auseinandersetzung erwerben?
Gefördert werden Fach-, Sach- und Methodenkompetenz sowie personale und soziale Kompetenzen zur ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung.
- Quote paper
- Hanna Kubowitz (Author), 2011, "Von vielsagendem Verschweigen" oder Einladung zu einer außergewöhnlichen Textbegegnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177170