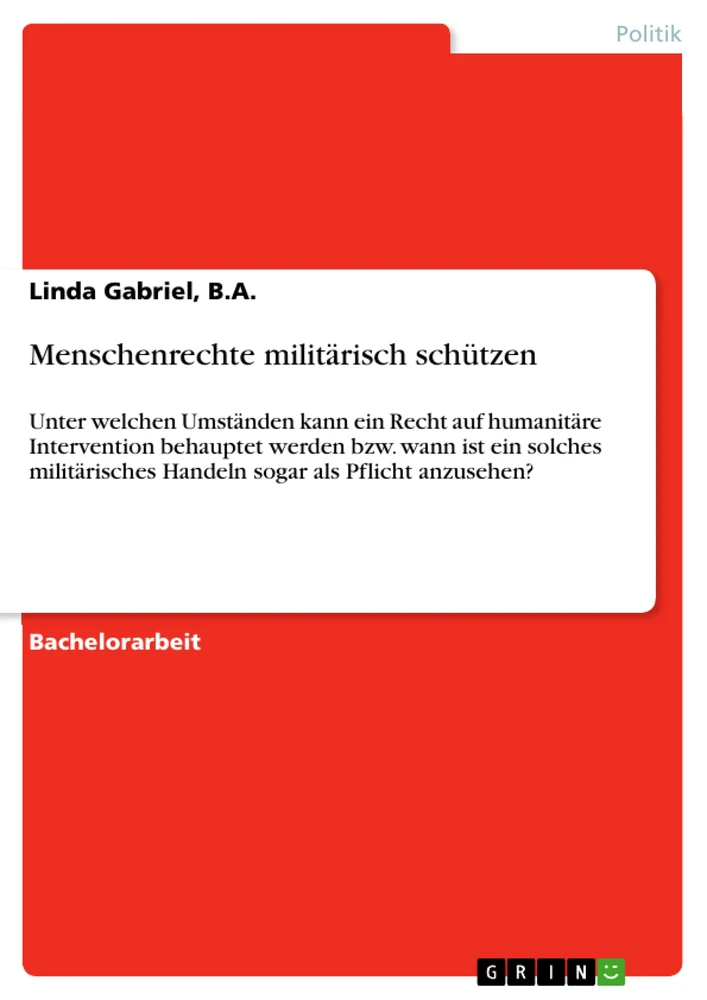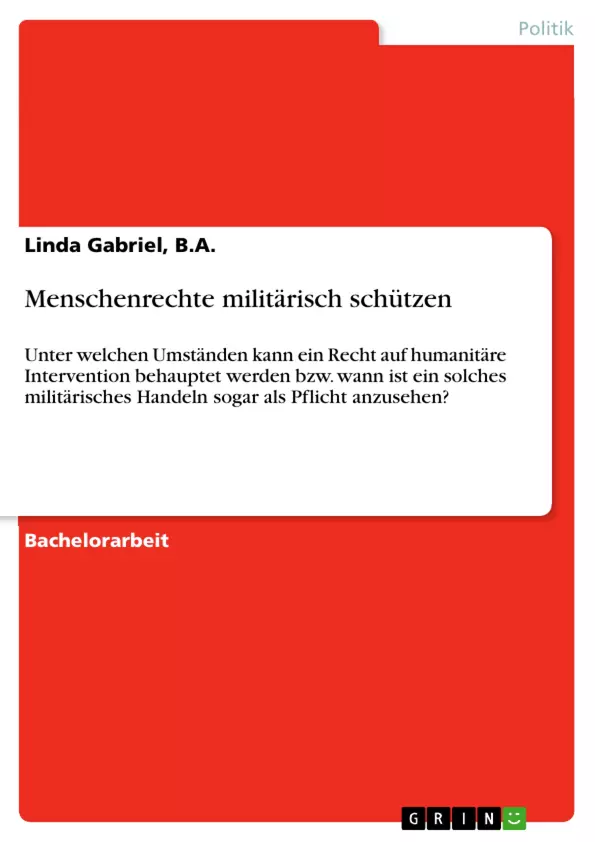“If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica - to gross and systematic violations of human rights that affect every precept of our common humanity?" (Kofi Annan) Dieses Zitat von Kofi Annan vor der UN-Vollversammlung soll einen ersten Eindruck von der Kontroverse geben, mit welcher sich dieses Essay beschäftigt. Es geht hierbei um die Frage, unter welchen Umständen ein Recht auf humanitäre Intervention behauptet werden kann bzw. wann ein solches militärisches Handeln sogar als Pflicht anzusehen ist.
Einer der Hauptkonfliktpunkte dabei dreht sich, wie es das obige Zitat anspricht, um das Verhältnis zwischen Souveränitätsprinzip und den Menschenrechten.
Diese Arbeit basiert auf der Annahme, dass es grundsätzlich Situationen gibt, in denen eine humanitäre Intervention notwendig ist, um Menschrechte (und vor allem Menschenleben) zu schützen; diese muss jedoch unter bestimmten Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Damit beschäftigt sich auch der Hauptteil der Arbeit. Aufbauend auf den Text von Michael Walzer soll dabei vor allem auf die Punkte des Anlasses, der Akteure und der Vorgehensweise sowie auf die Frage nach der Beendigung einer humanitären Intervention eingegangen werden.
Zunächst soll jedoch eine Definition des Begriffes „humanitäre Intervention“ gefunden und ein kurzer Überblick über die gegenwärtige völkerrechtliche Basis und spezifische Ereignisse in der Geschichte der militärischen Einsätze zu humanitären Zwecken gegeben werden.
Schließlich wird die Situation der Christen im Irak als ein aktuelles Beispiel genannt, in welchem - resultierend aus den davor ausgeführten Argumenten - eine Art der humanitären Intervention denkbar wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Humanitäre Intervention – Eine Begriffsannäherung
- Die Positionen des internationalen Völkerrechts
- Praxis der humanitären Intervention
- Theorie und Dilemmata der humanitären Intervention
- Vier aktuelle Standpunkte
- Die Idee des gerechten Kriegs
- Vier essentielle Fragen
- Gründe für eine Intervention
- Die Akteure bei einer Intervention
- Die Durchführung einer Intervention
- Der Rückzug bzw. die Sicherung des Friedens
- Schlussfolgerungen
- Casestudy: Die Lage der Christen im Irak
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, unter welchen Umständen ein Recht auf humanitäre Intervention beansprucht werden kann, bzw. wann eine militärische Intervention zur Wahrung von Menschenrechten sogar als Pflicht anzusehen ist.
- Der Konflikt zwischen Souveränitätsprinzip und Menschenrechten
- Die Notwendigkeit und Rechtfertigung von humanitären Interventionen
- Die Definition und Abgrenzung des Begriffs „humanitäre Intervention“
- Die Rolle des internationalen Völkerrechts und der Vereinten Nationen
- Die praktische Umsetzung und die ethischen und rechtlichen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Problemstellung der Arbeit vor und beleuchtet die Kontroverse rund um das Verhältnis von Souveränität und Menschenrechten. Die Arbeit geht von der Notwendigkeit humanitärer Interventionen zum Schutz von Menschenrechten aus, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit eines klar definierten Rahmens für solche Interventionen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Begriffsdefinition von „humanitärer Intervention“ und zeigt die Schwierigkeiten auf, die sich aus unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs ergeben. Es werden verschiedene Definitionen von prominenten Autoren vorgestellt und die damit verbundenen Fragen diskutiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Positionen des internationalen Völkerrechts zur humanitären Intervention. Der Fokus liegt auf den Grundsätzen der UN-Charta, die ein allgemeines Interventionsverbot beinhalten und den Schutz der Souveränität der Staaten betonen. Es werden die Ausnahmen von diesem Verbot, wie die Selbstverteidigung und Interventionen mit Zustimmung des Sicherheitsrates, erörtert.
Kapitel 4 widmet sich der praktischen Umsetzung von humanitären Interventionen. Es werden verschiedene historische Beispiele und die aktuelle Praxis militärischer Einsätze zu humanitären Zwecken analysiert.
Das fünfte Kapitel analysiert die Theorie und die Dilemmata der humanitären Intervention. Es werden verschiedene Standpunkte zur Rechtfertigung von Interventionen vorgestellt, die Idee des „gerechten Kriegs“ erläutert und vier wichtige Fragen zur Durchführung von Interventionen untersucht: die Gründe, die Akteure, die Vorgehensweise und die Frage nach dem Ende der Intervention.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Menschenrechte, Völkerrecht, Souveränität, UN-Charta, Sicherheitsrat, Selbstverteidigung, „The responsibility to protect“ (R2P), gerechter Krieg, Interventionismus, Dilemmata, Fallbeispiele, Christen im Irak.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine humanitäre Intervention?
Es handelt sich um militärische Maßnahmen, die zum Schutz von Menschenrechten und Menschenleben in einem fremden Staat durchgeführt werden.
Wie stehen Souveränität und Menschenrechte zueinander?
Dies ist ein Hauptkonfliktpunkt: Darf die Souveränität eines Staates verletzt werden, um systematische Menschenrechtsverletzungen zu stoppen?
Was besagt das Prinzip der 'Responsibility to Protect' (R2P)?
Es besagt, dass die internationale Gemeinschaft eine Schutzverantwortung hat, wenn ein Staat seine eigene Bevölkerung nicht schützen kann oder will.
Wann gilt eine humanitäre Intervention als legitim?
Die Arbeit diskutiert dies anhand der Idee des "gerechten Kriegs" und nennt Kriterien wie Anlass, Akteure und eine klare Vorgehensweise.
Welches aktuelle Beispiel wird in der Arbeit genannt?
Die Situation der bedrohten Christen im Irak wird als Fallbeispiel für eine mögliche humanitäre Intervention herangezogen.
- Citation du texte
- Linda Gabriel, B.A. (Auteur), 2010, Menschenrechte militärisch schützen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177177